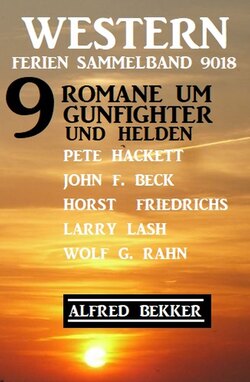Читать книгу Western Ferien Sammelban 9018 - 9 Romane um Gunfighter und Helden - Pete Hackett - Страница 49
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
ОглавлениеDie Hitze des Tages war vorüber. Allmählich legte sich der Staub. Man konnte wieder freier atmen. Die untergehende Sonne zeichnete um die Silhouette der Prieta Mountains einen feurigen Saum. Die vereinzelten Opuntien schienen zu glühen, Die Berge atmeten Ruhe und Frieden.
Aber es herrschte kein Frieden. Eine Gruppe von Männern hatte lediglich auf diese Stunde gewartet. Wie Krustenechsen krochen sie aus ihren Verstecken hervor und scharten sich um einen Mann, dessen glühende Augen ungeduldig auf den letzten seiner Leute warteten.
„Du lässt dir viel Zeit, Bolo“, tadelte er einen großen Mann mit struppigem Vollbart, der sich in leicht gebeugter Haltung näherte und einen mächtigen Knüppel wie etwas in der Faust hielt, das ihm zutiefst zuwider war.
Bolo Montana war vier Jahre älter, als Carlo Janos. Trotzdem nahm er den Tadel hin. Carlo war der Anführer. Er hatte sie über die Grenze nach Arizona geführt, er würde auch den weiteren Weg finden, sogar wenn sich seine Methoden immer weiter von dem entfernten, was Bolo Montana mit seinem Gewissen zu vereinbaren suchte.
,.Die Leute haben Kinder“, erklärte er. Es sollte wohl eine Entschuldigung sein. „Es ist nicht recht, Kinder zu bestehlen.“
Carlo Janos blitzte ihn wild an.
„Haben wir keine Kinder, Bolo? Ist es nicht die Schuld der Gringos, dass mein Chico fast den ganzen Tag weint, weil er Hunger hat?“
Der große Mexikaner nickte zustimmend mit dem Kopf.
„Du hast recht, Carlo. Doch es waren nicht diese Gringos, die wir überfallen wollten. Es waren Pistoleros, die uns aus unserer Heimat vertrieben haben. Es waren Männer, die unser eigener Gouverneur auf uns gehetzt hat, um uns zu bestehlen und alles, was wir zurücklassen mussten, zu verbrennen.“
„Das weiß ich selbst, Bolo. Aber willst du etwa den Gouverneur selbst zur Verantwortung ziehen? Willst du, dass wir mit unseren jämmerlichen Waffen den Kampf gegen seine Killer aufnehmen?“
„Das können wir nicht“
„Nein, das können wir nicht. Aber wir können alles tun, damit unsere Frauen und Kinder nicht verhungern. Das ist unsere Pflicht. Wir nehmen uns nur, was wir brauchen, und schon bald, so hoffe ich, wird auch das nicht mehr nötig sein.“
Bolo Montana seufzte schwer. Was hätte er dagegen sagen sollen? Wusste er denn einen anderen Weg? Keiner von ihnen war mit Begeisterung dabei, wenn sie den Gringos, die fast genauso arme Schweine waren wie sie selbst das Wenige wegnahmen, was sie besaßen. Aber die Americanos hatten etwas, was sie ihnen nicht rauben konnten und mehr wert war als die armseligen Kleidungsstücke, die Lebensmittel und Werkzeuge, die sie in Tinayas Altas und Last Deal erbeutet hatten. Sie hatten eine Heimat, aus der sie kein geldgieriger, machthungriger Gouverneur vertrieb.
Der Gedanke an das erlittene Unrecht brachte auch Bolo Montanas Blut zum Wallen. Sein Körper straffte sich. Er packte den Knüppel fester und nickte Carlo Janos entschlossen zu. Dieser lächelte. Es war kein frohes Lächeln und auch kein grausames. Es wirkte gequält und doch unerbittlich.
Es waren acht Männer, die, die langen Schatten nutzend, auf die ahnungslose Siedlung Cabeza Prieta zuschlichen und sich gegenseitig durch Blicke und Gesten verständigten. Carlo Janos ging als Erster. Er trug eine abenteuerliche Schrotflinte, die eher als Abschreckung, denn als echte Waffe geeignet war.
In Cabeza Prieta war man dabei, den Tag zu beschließen. Die knusprigen Tortillas ließen die Mühen mit dem kargen Boden vergessen. In einigen Hütten wurde der Tisch gar durch das köstliche süße Dulce aus dem Kugelkaktus bereichert.
Die Campesinos unter Carlo Janos verspürten keinen Appetit auf Dulce. Sie erreichten die erste Hütte, vor der ein hagerer Mann gerade dabei war, zwei Maultiere, die stumpf vor einem Karren ausharrten, auszuspannen. Wie ein wütender Wirbelsturm fielen sie über den Ahnungslosen her. Carlo Janos stieß ihm den Lauf der Schrotflinte in den Rücken und zischte drohend: „Wenn du schreist, bist du ein toter Mann!“
Juan Diego stand neben seinem Anführer. Selbst ohne den Knüppel in seiner Faust hätte er furchtbar ausgesehen. Seine Nase war gebrochen, das breitflächige Gesicht von Narben entstellt. In seiner Heimat in Mexiko war er nie ein Schläger gewesen. Erst die brutale Behandlung durch die Pistoleros des Provinzgouverneurs und die schreckliche Zeit im Kerker hatten auch in seiner Seele Narben zurückgelassen. Er schwang seinen Knüppel, und der hagere Mann stöhnte auf. Wenn er an Widerstand gedacht hatte, so verwarf er diesen Gedanken schleunigst.
„Nehmt mir nicht die Tiere!“, jammerte er nur. „Ich besitze sonst nichts.“
„Du besitzt immer noch mehr als wir, Gringo“, sagte Carlo Janos mitleidlos. Er stieß den Mann durch die Tür in die Hütte und griff den beiden Maultieren ins Geschirr.
Jetzt war der Bann gebrochen. Die mexikanischen Bauern schwärmten aus und drangen gleichzeitig in mehrere Häuser ein.
Bolo Montana blieb bei dem erbeuteten Karren. Er hörte vereinzelte Schreie, das Kreischen von Frauen und Kinderweinen. Jedes Mal zuckte er zusammen, und er verfluchte den Gouverneur und seine Mördergarde, die sie zu solchem Tun zwangen.
Die Campesinos schleppten herbei, was sie an Brauchbarem fanden. Sie stahlen nichts Glänzendes und auch kein Geld. Was sie brauchten, waren vor allem Lebensmittel. Aber auch Wäsche und Töpfe fanden ihr Interesse. Sie besaßen ja so gut wie nichts. Sie hatten auf ihrer Flucht alles zurücklassen müssen, um wenigstens ihr nacktes Leben zu retten. Ihre Ansprüche waren bescheiden, aber sie waren wild entschlossen, dieses erbärmliche Leben zu verteidigen.
Als Bolo Montana die Hacken und Spaten sah, die Enno Rico und Pablo Santos aus einem Schuppen trugen, glänzten seine Augen. Solche Geräte hatte er schon lange nicht mehr in den Händen gehalten. Sie versinnbildlichten für ihn die Heimaterde. Damit hatte er unermüdlich den Kampf gegen Staub und Dürre aufgenommen. Wann würde er das endlich wieder dürfen?
Er nahm den beiden Bauern die Werkzeuge ab und legte sie fast liebevoll auf den Karren, der sich allmählich mit nützlichen Dingen füllte. Eben wuchtete Juan Diego einen prall gefüllten Sack auf seinen Rücken. Die Maiskörner rieben gegeneinander. Jetzt brauchten sie nur noch ein Fleckchen Land, in das sie das Saatgut streuen konnten.
Juan Diego warf den Sack auf den Karren und zwinkerte Bolo Montana zu. Es klappte heute ausgezeichnet. Sie hatten in den vergangenen Tagen eine Menge gelernt, und es war ein eigenartiges Gefühl, dass es jetzt einmal die anderen waren, die zitterten und Angst hatten. Doch in diesem Gefühl lag kein Triumph.
Die Straßen waren wie leergefegt, seit die Mexikaner wie ein Unwetter über den Ort hereingebrochen waren. Die wilde Schar verbreitete Schrecken, so dass sogar der Wachtposten vor dem Gefängnis es vorgezogen hatte, nicht die Aufmerksamkeit der vermeintlichen Banditen zu erregen und eiligst weggelaufen war. Die Leute von Cabeza Prieta waren keine Helden. Das brauchten sie auch nicht zu sein, denn normalerweise geschah in dem Nest nichts, was Entschlossenheit und Waffengewalt erfordert hätten.
Sogar Tom Erdoes verwandte mehr Zeit auf seinen Beruf als Zimmermann als auf seine Marshal-Tätigkeit. Er wirkte eher wie der Wirt einer Bodega als wie ein grimmiger Gesetzeshüter. Sein gutmütiges Gesicht unter der Halbglatze und der beträchtliche Bauchansatz, der ihn zu wenig respektgebietenden Beinkleidern zwang, ließen keinen Kämpfer in ihm erwarten.
Und der war er auch nicht. Trotzdem wusste er, was er dem Stern an seiner Brust schuldig war. In seinen spärlichen Haaren hingen noch die Sägespäne von der Arbeit, als er über die knochenharte Plaza eilte. Der ungewohnte Lärm, mit dem die Fremden in die Häuser eindrangen, das Schreien und Poltern hatten ihn auf den Plan gerufen. Mit einem erleichterten Blick stellte er fest, dass es sich anscheinend nur um ein paar abgerissene Mexikaner handelte, denen vermutlich der Pulque in den Schädel gestiegen war. Jetzt gebärdeten sie sich allerdings wie die Eroberer unter Cortes.
Während des Laufens schnallte er seinen Revolvergurt um. Dabei schrie und brüllte er so kraftvoll, dass er erwartete, allein durch seinen Auftritt die Campesinos in eine heillose Flucht schlagen zu können.
Doch Carlo Janos und seine Männer befanden sich wie in einem Rausch. Sie ließen sich durch einen einzelnen Mann nicht einschüchtern. Und als Tom Erdoes es gar wagte, seinen Revolver Bolo Montana drohend unter die Nase zu halten und die sofortige Rückgabe des gestohlenen Gutes zu fordern, warf sich Juan Diego von hinten mit einem zornigen Aufschrei auf den wackeren Marshal und streckte ihn mit einem wuchtigen Hieb seines Knüppels nieder.
Bolo Montana stellte sich schützend vor die Spaten und das Saatgut und ließ mit finsterem Gesichtsausdruck erkennen, dass er diese Beute verteidigen würde. Notfalls wollte auch er mit seinem Prügel dazwischenfahren.
Doch das war nicht mehr nötig. Tom Erdoes lag zusammengekrümmt auf dem Boden und rührte sich nicht mehr. Ein paar Männer, die sich noch einen Rest Mut bewahrt hatten und ihrem Marshal zu Hilfe eilen wollten, wurden von den mexikanischen Bauern gebührend empfangen. Sie zogen sich hastig in ihre Häuser zurück und versuchten, ein Eindringen der Banditen zu verhindern.
Die entfesselten Campesinos brachen jeden Widerstand. Sie trieben ihre erbeuteten Maultiere ein Stück in das Städtchen hinein, damit sie das Geschirr und die gewebten Tücher nicht soweit zu tragen brauchten. Mit abschätzenden Blicken beurteilten sie die Häuser und entschieden sich für jene, in denen etwas zu holen war.
Dem kleinen Adobe-Gefängnis schenkten sie dabei keine Beachtung. Dort gab es nichts, was für sie von Wert gewesen wäre. Juan Diego erinnerte sich an den Kerker, in dem er gesessen hatte. Das waren andere Mauern gewesen als diese vergleichsweise harmlosen Lehmziegel. Er ahnte nicht, dass sich hinter diesen Wänden ein paar Männer aufhielten, die ihnen wesentlich mehr Interesse entgegenbrachten. Fünf wenig vertrauenserweckende Gesichter drängten sich hinter dem vergitterten Fenster, wobei ein Leuchten über diese Visagen ging, als Marshal Erdoes den Knüppel schmecken musste.
„Warum schlagt ihr ihn nicht tot?“, zischte der jüngste der Burschen enttäuscht. Er war hager und ging so krumm wie ein Greis, obwohl er gerade erst zweiundzwanzig war.
Al Burn stand neben ihm. Er massierte unaufhörlich seine schlanken Hände. Seine größte Sorge schien zu sein, dass er in dem schäbigen Gefängnis keine Möglichkeit fand, sein Äußeres in Schuss zu halten.
„Der kriegt schon noch seine Strafe, Fred“, sagte er und grinste gemein. „Er hat uns nicht umsonst eingebunkert.“
Henry Carter, ein Kerl mit einer Habichtsnase und tortillagroßen Händen, die zu seiner schlanken Gestalt so gut passten wie ein Gatling Gewehr in die Arme einer Muchacha, beobachtete gespannt die Mexikaner, die unablässig den Maultierkarren mit Beutestücken beluden.
„Die Burschen sind uns nicht fremd“, sagte er nachdenklich.
Maxwell Hook gab ihm recht.
„Vor ein paar Tagen, als sie von Mexiko über die Grenze flohen, schienen sie wesentlich hilfloser zu sein als jetzt.“
Jetzt dämmerte es auch Henry Carter.
„Stimmt! Wir haben sie beobachtet und dabei den verdammten Sheriff mit seinen Leuten überhört, die uns so schnell überrumpelten, dass wir nicht mal mehr Zeit für einen kräftigen Fluch hatten.“
Jetzt glaubte auch der fünfte der Gruppe, seinen Kommentar dazugeben zu müssen. Er sah ziemlich verwildert aus, aber das störte ihn offenbar nicht. Sein verfilztes, schwarzes Haar ging in einen struppigen Vollbart über und bedeckte den größten Teil seines Gesichtes, was durchaus kein Nachteil war.
„Demnach sind die Mexe schuld, dass wir hier hocken müssen“, brummte er und kicherte idiotisch.
„Da hast du gar nicht so unrecht, John“, erwiderte Maxwell Hook. „Deshalb ist es ihre verdammte Pflicht und Schuldigkeit, dafür zu sorgen, dass wir unser unfreiwilliges Hotel auch wieder verlassen können.“
Dieser Gedankenflug war für John Millis zu hoch. Er konnte gerade so weit denken, um seinem Zeigefinger den Befehl zu geben, den Abzugshebel zu betätigen. Alles andere besorgte Maxwell Hook für ihn. Wozu war er schließlich der Boss? Bevor es ihm noch gelang, eine Frage zu formulieren, erklärte der athletische Mann, der mit seiner dichten Körperbehaarung und den ungewöhnlich langen Armen wie ein Affe wirkte: „Ich habe keine Lust zu warten, bis Sheriff Brookson erscheint, um uns abzuholen.“
Nach dem aufgeregten Gemurmel zu schließen, hatten auch seine Kumpane keine Lust dazu.
„Der hat bestimmt ein Jail, das besser bewacht wird als dieses hier“, sagte Fred Steel.
„Eben! Und es ist wahrscheinlich auch nicht so leicht zu knacken.“
Al Burn verstand als Erster.
„Du bist ein verrückter Hund, Maxwell“, sagte er anerkennend. „Du willst also hier raus?“
„Jedenfalls habe ich nicht die Absicht, abzuwarten, bis die tapferen Leute dieses Kaffs ihren Marshal wieder gesundgepflegt haben.“
„Aber man wird uns nicht rauslassen“, sagte John Millis und wühlte verbissen in seinem Bart.
„Unsere mexikanischen Freunde werden uns dabei helfen.“
„Helfen?“
Henry Carter tippte sich gegen die Stirn. Manchmal war John aber auch zu begriffsstutzig. Zum Glück hatte er andere Qualitäten, die er besonders dann zeigte, wenn überdurchschnittliche Rücksichtslosigkeit und Brutalität verlangt wurden.
„Das ist doch klar“, erklärte er. „Diese Bauernlümmel sorgen für genügend Aufregung und Durcheinander. Außerdem vollführen sie einen Lärm, dass es keinem auffallen wird, wenn es auch in unserer Ecke ein bisschen lebendig wird.“
„Weißt du denn, wo der Schlüssel ist?“ John Millis ließ keine Gelegenheit aus, seine geistige Harmlosigkeit unter Beweis zu stellen. Henry Carter hielt ihm seine riesigen Fleischhauerhände unter die Nase.
„Hier!“, fauchte er. „Das ist unser Schlüssel. Und vielleicht bequemst du dich sogar, ein bisschen mit anzupacken.“
„Wenn wir alle helfen“, sagte Maxwell Hook ruhig, „dürfte dieses Gitter kein Hindernis für uns sein. Beeilen wir uns, Männer! Die Mexikaner haben ihren Wagen fast beladen. Wenn sie erst mal fort sind, wird es hier wieder ruhiger, und unsere Chancen sinken gewaltig.“ Er klammerte sich an dem Eisengitter fest, und alle anderen drängten sich heran und zerrten aus Leibeskräften an den Stäben.
Das nicht sehr stabile Gemäuer begann schon bald zu knirschen. Die Banditen unterdrückten einen Jubelschrei, denn noch saßen sie ja in diesem engen Viereck und mussten besorgt sein, dass sie ihren schmutzigen Auftrag nicht ausführen konnten und auf die ersehnten harten Dollars verzichten mussten. Doch diese Sorge war nur noch von kurzer Dauer. Als das Gitter mit einigen Ziegelresten aus der Mauer brach, stürzten die Männer übereinander. Sie hatten es geschafft.
Maxwell Hook riskierte einen ersten Blick durch die Öffnung, in der noch der Lehmstaub wie ein Schleier hing. Seine tückischen, kleinen Augen überrissen die Lage, und sie waren zufrieden mit dem, was sie sahen. Er wandte sich an Al Burn und befahl: „Du kletterst hinaus und kümmerst dich um die Tür. Aber beeil dich! Sonst klauen dir die Kerle da draußen noch deine elegante Uniform.“
Er lachte gutgelaunt, während Al Burn mit einem liebevollen Blick seinen Prince Albert Rock streifte. Er fürchtete nicht die Campesinos, sondern war über die Tatsache betrübt, dass er sich bei der Kletterpartie das gute Stück beschmutzen würde.
John Millis hob ihn mit einer Leichtigkeit in die Höhe, als bestände er nur aus Haut und Knochen. In Wirklichkeit verbargen sich unter seiner teuren Kleidung ein paar Muskelpakete, die er sich im unermüdlichen Kampf gegen Gesetz und Ordnung erworben hatte. Wie eine Schlange zog er sich durch die Öffnung und sprang auf der anderen Seite auf den Boden. Mit flinken Augen suchte er nach einem geeigneten Werkzeug, mit dem er der verschlossenen Tür zu Leibe rücken wollte. Er fand ganz in der Nähe eine Hacke, wie sie die Minenarbeiter benutzten. Die war genau richtig. Geduckt huschte er zu dem Schuppen, aber es achtete ohnehin niemand auf ihn. Die mexikanischen Plünderer waren viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt.
Mit wuchtigen Schlägen brach Al Burn die Tür des Gefängnisses auf. Die Banditen stürmten über die Trümmer ins Freie. Alles weitere war ein Kinderspiel. Die Berge lagen praktisch vor der Haustür. Dort gab es genügend Schlupfwinkel. Bevor jemand an ihre Verfolgung denken würde, waren sie längst untergetaucht und unauffindbar.
Während Maxwell Hook mit seinen Männern wie ein lautloser Spuk aus Cabeza Prieta verschwand, verließen in der anderen Richtung auch die Campesinos um Carlo Janos die Stadt. Sie waren so zufrieden, wie es die Umstände zuließen. Immerhin hatten sie jetzt ein Maultiergespann mit einem Wagen, und für das Nötigste zum Überleben war ebenfalls gesorgt. Vielleicht war dies der letzte Raubzug, zu dem sie gezwungen waren.
Die Sonne, die nur scheinbar in Mexiko jenseits der Grenze untergegangen war, obwohl sie selbstverständlich zu Arizona gehörte, war nicht mehr zu sehen. Nur zögernd verließen die Überfallenen ihre Häuser. Sie wehrten sich noch immer, ihr Unglück zu begreifen. Hilflos waren sie diesen entfesselten, brutalen Kerlen ausgeliefert gewesen. So mancher von den Männern hatte eine gehörige Tracht Prügel erhalten.
Marshal Erdoes war zum Glück nicht tot, doch die Banditen hatten ihn übel zugerichtet. Er wurde in ein Haus getragen, während man auf der Plaza aufgeregt diskutierte und über die Frevler schimpfte. Dass sogar das Gefängnis leer war, bemerkten die Verzweifelten erst viel später.