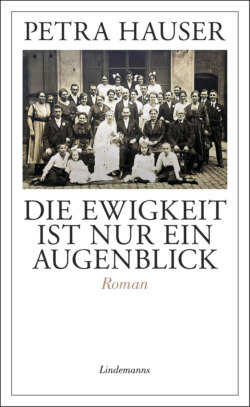Читать книгу Die Ewigkeit ist nur ein Augenblick - Petra Häußer - Страница 14
ОглавлениеSchwestern
28. Juni 1914
Sie wurden zusammen konfirmiert und beide wurden mit einem guten Zeugnis von der Schule entlassen. Johanna, weil sie sehr fleißig und pflichtbewusst war, Helene, weil sie intelligent war, schnell die richtigen Antworten parat hatte, weil ihre schwarzen Augen ihre Lehrer beunruhigten auf eine Art und Weise, die sich auch die älteren unter ihnen nicht erklären konnten. Hinter diesen Augen vermutete man eine unergründliche Tiefe an Gefühlen, an Leidenschaften, rahmensprengende Gedanken. Ihre trotzig aufgeworfenen Lippen ließen Eigenwille vermuten. Man horchte auf, wenn man zum ersten Mal ihre Stimme hörte. Das rauchige Timbre. Man musste sich sofort räuspern, weil man instinktiv annahm, das sollte sie eigentlich tun, Helene sollte sich ihre Kratzer von den Stimmbändern weghusten. Dabei ging das nicht und war auch nicht nötig. Ihre Singstimme nämlich klang klar und rein, schwang sich mühelos auf und auch die tiefen Töne kamen nicht gepresst oder gezwungen.
Im Jahr ihrer Konfirmation und Schulentlassung begannen beide eine Schneiderlehre im Mode-Atelier der Madame Wawrina, vermittelt durch ihre Tante Sofie, die dort bereits ihre Lehre gemacht und von Fräulein Wawrina insgeheim als Nachfolgerin auserkoren worden war. Sofie, die seit der Geburt ihres ersten Neffen Bertel Sofietante genannt wurde, war der Wawrina unentbehrlich geworden, eine zwar nur durchschnittlich gute aber äußerst zuverlässige Schneiderin, das hieß, sie beherrschte alle Arten von Nähten, konnte Schnittmuster anfertigen und den jeweiligen körperlichen Besonderheiten der Kundinnen anpassen. Sie vertrat die Ansicht, dass das lange schon Erprobte eine Dame von Stand immer noch am besten kleidete und ihr die Möglichkeit gab, sich auf ihre Kleidung so sehr verlassen zu können, dass sie sich, wenn sie sie einmal anhatte, nicht mehr darum sorgen musste, sondern ihre Energie und ihre Weiblichkeit ganz auf die anderen nicht selten doch wirklich schwierigen Elemente ihres Lebens konzentrieren konnte: Das Repräsentieren neben ihren bedeutenden Männern, das Erzwingen von Vorteilen, überall dort, wo viele Damen in Konkurrenz zueinander standen, das Beherrschen ihres Dienstpersonals, das Regieren ihrer Kinder und nicht zuletzt das Regieren ihres eigenen inneren Wohlbefindens, das sich sodann auf ihrem Gesicht ausdrücken und sie von innen her zum Leuchten bringen würde, so wie es ihr Stand und ihre Position im Leben verlangten. Sofie Walker hatte also ein Auge für das Machbare, das Modische wusste sie einzubeziehen, wenn es erwünscht war, sie war außerdem resolut und hatte kaufmännisches Geschick, sie handelte wie auf einem orientalischen Bazar, wo es den Rahmen des Schicklichen nicht sprengte, sie konnte mit genau dem richtigen Tonfall zu einem Mantel noch Lederhandschuhe, einen kapriziösen Schlangenledergürtel, einen seidenen Schal, vielleicht sogar ein Hütchen anbieten, wie nebenher ein paar Schuhe zeigen, hatte immer einige Modelle zum Anprobieren parat und zuvor mit dem entsprechenden Hersteller eine Provision vereinbart, wenn es ihr gelänge, ihm eine neue Kundin zuzuführen. Am bemerkenswertesten war ihre Wandelbarkeit, blitzschnell stellte sie ihren Tonfall auf ihr Gegenüber ein, schmeichelte oder verbarg das Schmeicheln unter scheinbar nüchternen Fakten, schürte in den Kundinnen, was ihnen gerade ermangelte, einen Sinn für Konkurrenz, für Selbstbewusstsein, für Einsicht in die körperlichen Unzulänglichkeiten und die absoluten Fähigkeiten einer guten Schneiderin, diese zu kaschieren. Sie war redselig oder wortkarg, je nach dem Gebot der Stunde und das Gebot der Stunde erkannte sie im Bruchteil einer Sekunde. Das Fräulein Wawrina hielt ihre Angestellte für ein Multitalent mit dem Schwerpunkt auf Kundenbetreuung und Verkauf. Künstlerinnen konnte man in diesem Beruf nur wenige gebrauchen. Im Modehimmel ging es eng zu, es gab dort viel Ehrgeiz und keine kommerziellen Sicherheiten. Das Fräulein Wawrina wollte und musste sowohl sich als auch ihre Angestellten schließlich ernähren.
Von ihrer Sofietante würden die beiden Nichten sehr viel Nützliches lernen können. Und das taten sie auch. Sie wussten, dass sie der Sofietante diese Lehrstelle in einem angesehenen Schneideratelier Mannheims zu verdanken hatten, ihr allein. Die Dankbarkeit für Erleichterungen aller Art wurde Wilhelmines und Pauls Kindern eingeimpft mit den ersten über das eigene kindliche Wohl hinausgehenden Gedanken; wenn wir höher hinaus oder zumindest nicht die soziale Leiter hinunterfallen wollen, brauchen wir Hilfe, hieß das Credo der Familie, wir sind viele, bei uns geht es eng zu, wir schaffen das Leben nicht allein.
So beugten also Johanna ihren blonden und Helene den kastanienbraunen Kopf über die Kapp-, Biesen, Paspel-, Stürz-, Kräusel- und Kedernähte, stachen sich die Finger blutig, wippten mit dem rechten Fuß nach vorne, dem linken zurück auf dem breiten Pedal, lernten Knöpfe mit und ohne Füßchen anzunähen und Knopflöcher einzusetzen, jedes exakt mit der gleichen Anzahl von Knopflochstichen, die Knötchen eng aneinandergeschmiegt. Aber sie lernten auch mit den anderen Näherinnen zu schwatzen und erweiterten damit ihren Horizont, denn das behütete Leben der Töchter des Hofmusikers und seiner Frau Wilhelmine, die mit einer Reihe sehr angesehener Mannheimer Bürgerfamilien verwandt und verschwägert waren, schloss vieles aus, worüber diese Mädchen und Frauen bestens Bescheid wussten, deren Mitteilungsbedürfnis so elementar war wie Hunger und Durst.
Am Wochenende trafen sie sich, diese Mädchen, wanderten am Rhein entlang oder den Neckar aufwärts, fuhren mit der Bahn in den Odenwald, spazierten, lagerten im Wald auf mitgebrachten Decken, manche brachten einen Bruder mit und vielleicht noch dessen Freund. Es wurde gelacht, geschwatzt, geflirtet.
Johanna tat nichts, was sie nicht jederzeit Mutter und Vater hätte erzählen können, ohne deren Wohlwollen einzubüßen. Sie war sich für manches eben einfach zu gut, das alberne Flirten, das Tratschen, das von einer Zukunft Träumen, die außerhalb jeglicher realer Normen lag.
Helene aber war noch nicht mit dem zweiten Lehrjahr fertig, da hatte sie schon einen echten Verehrer, den Sohn einer guten Kundin, einen Gymnasiasten, der nur einfach mit Stubs angeredet werden wollte, nicht mit Gerold von Stein, wie er eigentlich hieß. Helene kannte ihn vom Atelier. Seit er zu der Wandergruppe gestoßen war. Warum denn eigentlich? Welche Verbindung hatte er? Hatte er ihre Nähe gesucht? Ihre Nähe? Seit er dabei war, erschien er öfter im Atelier als zuvor, vielleicht auch bemerkte sie ihn jetzt erst? Er drängte sich in Helenes Gedanken, tauchte dort auf am Abend, wenn sie müde hinüberglitt in ihre Träume. Am Tag, viele Male, sie begann sich so zu verhalten, als ob er jederzeit neben ihr stehen könnte und sie beobachten würde. Wenn er seine Mutter begleitete, dann blieb es bei kleinen, wie zufälligen Berührungen der Finger, im Vorübergehen, bei einem tiefen Blick, Auge in Auge versenkt, einem Zucken der Lippen, so als ob sie sprechen wollten, oder vielleicht küssen?
Er wartete auf Helene im Schatten der gegenüberliegenden Häuser, noch im November, begleitete sie dann nach Hause. Und im Frühling ließ sie ihn wissen, dass es am Wochenende wieder in den Odenwald gehe.
Johanna bemerkte wohl das Spiel der beiden und sorgte sich um die Schwester.
„Ob das seiner Mutter recht ist?“
„Die weiß doch gar nichts davon.“
„Ob es unserer Mutter recht wäre?“
„Die wird auch nichts davon erfahren, wenn du es ihr nicht verrätst.“
Johanna presste die Lippen aufeinander.
„Er wird dich niemals heiraten, Helene, nie und nimmer wird er das können oder gar dürfen. Sei bloß vorsichtig.“
„Was soll das denn heißen?“
„Du weißt doch, was die Männer wollen. Alle wollen das. Und du weißt auch ganz genau, wo das hinführt. Wir sehen das schließlich seit Jahren. Ich finde es grässlich, dass der Vater die Mutter nicht endlich in Ruhe lässt.“
„Glaubst du denn, dass es die Mutter nicht vielleicht auch will?“
„Immer noch mehr Kinder?“
„Nein, ich meine das andere.“
Die beiden sahen einander stumm an, denn was benannt werden müsste, war doch für sie beide unaussprechbar. Darüber spricht man nicht, hieß das Motto.
Helene und Stubs gingen bald Hand in Hand. Beim nächsten Ausflug lag Stubs Kopf in Helenes Schoß und sie beugte sich über ihn, streichelte sein Gesicht, wuschelte durch sein Haar. Die Tage wurden länger, die Luft duftete im Wald und auf den Wiesen, es wurde heiß, man war so träge beim Wandern, Helene und Stubs blieben weit hinter der Gruppe zurück. Als es bei schon anbrechender Dunkelheit zurückging, hatte Stubs den Arm um Helene gelegt, er flüsterte ihr etwas ins Ohr, oder küsste er ihr Ohr oder hatte sie eben nicht das Gesicht ihm zugedreht und hatten sich nicht ihre Lippen berührt? Das war am Sonntag, den 28. Juni, Helene würde es nicht vergessen. Niemals, denn Stubs hatte ihr an diesem Tag einen Ring an den Finger gesteckt. Ein kleines Herz mit einer Gravur: ein S und ein H ineinander verschlungen. Jedoch dieser Tag brannte sich ohnehin in das Gedächtnis der Menschheit ein. Das österreichische Thronfolgerpaar wurde an jenem Tag von einem serbischen Attentäter ermordet und daraufhin nahmen die europäischen Länder Aufstellung, um sich in die Schlachten des Ersten Weltkriegs zu stürzen.
Stubs meldete sich mit den ersten Freiwilligen zum Dienst für das Vaterland. Die Ehre seiner Familie gebot es ihm. Er schrieb Helene Briefe, schickte Karten und sie trafen sich bei jedem seiner Heimaturlaube, bis er verwundet wurde und in der Zeit seiner Genesung die Freundin seiner ältesten Schwester, eine gewisse Adelheid Hattenberg, die Tochter des Kommerzienrates Hattenberg, ihm Gedichte vorlas, ihn stützte, als er seine ersten Schritte mit dem geschienten Bein versuchte, und überhaupt nicht mehr von seiner Seite wich, und die Eltern der beiden sie schließlich mit sanftem Druck vor den Traualtar lenkten. Das zahlte sich aus für alle Beteiligten, denn der seelisch und körperlich schwer beschädigte Gerold von Stein wurde von seinem Schwiegervater mit einem gut bezahlten und nicht sehr arbeitsintensiven Posten in den Mannheimer Chemiewerken dafür belohnt, die schon über 30-jährige Adelheid zur Ehefrau und Mutter eines kräftigen Sohnes zu machen. Helene blieb ein Ring und die Erinnerung an das Gefühl auf ihrer Haut, wenn Stubs sie berührt hatte, den Duft seiner Haare, den Geschmack seiner Lippen, das Kribbeln an ihrem ganzen Körper, wenn sein Blick und ihr Blick ineinander tauchten. Ihre Tränen wusste nur Johanna zu deuten und sie behielt ihr Wissen für sich: Ein Liebesbeweis unter Schwestern. Helene war unendlich dankbar dafür. Sie bewahrte ihre Dankbarkeit auf und wartete geduldig auf einen Moment, wo auch sie der Schwester einen Liebesdienst würde erweisen können. So einfach ist das allerdings nicht. Die Liebe ist kein Handel. Sie ist sehr eigenwillig, selten geht sie einen Weg hin und wieder zurück. Was sie Gutes bewirkt, kann nicht gespiegelt werden. Es verwandelt den Geliebten und befähigt ihn, auch zu lieben, aber er wird anders lieben oder sogar möglicherweise ein anderes Ziel suchen für seine Gefühle. Niemals kann der Geliebte für den Liebenden sein, was dieser ihm ist. Helene ist Johanna dankbar, aber sie liebt die kleine Paula. An sie verschwendet sie ihr kostbar und selten gewordenes Lächeln. Ihr singt sie mit ihrer warmen weichen Stimme Lieder, erzählt ihr Märchen und Geschichten, zeigt ihr, wie man Knopflöcher versäumt, Knöpfe annäht, wie man einen Hefeteig zubereitet, wie man ein Blumenkränzchen windet, es sich aufs Haar drückt, dass man aussieht wie eine Elfe. Helene wacht über Paula wie einst über das Richardle und lange Zeit braucht sie kein weiteres Liebesobjekt.