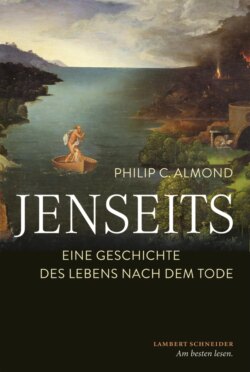Читать книгу Jenseits - Philip C. Almond - Страница 8
Prolog
ОглавлениеAls er erwachte, sah er sich erstaunt um. Er traute seinen Augen nicht. Sein alter Körper hatte eine erstaunliche Verwandlung durchgemacht. […] Schon bald hatte die Wärme der Sonne seinen feuchten Körper getrocknet. […] Er war eine Libelle geworden! In großen Bögen flog er auf und ab durch die Luft. Er fühlte sich in der neuen Atmosphäre überglücklich.
Doris Stickney, Waterbugs and Dragonflies: Explaining Death to Young Children (2009, Wasserkäfer und Libellen: Wie man kleinen Kindern den Tod erklärt)
Die britische Fernsehkomödien-Serie Rev erzählt die Geschichte eines anglikanischen Priesters, Adam Smallbone, der aus einer ländlichen Gemeinde nach St. Saviour in the Marshes umgezogen ist, einem heruntergekommenen Pfarrbezirk in Hackney im East End von London. Dort ist er für die Grundschule der örtlichen Pfarrei verantwortlich. Als einer der Lieblingslehrer der Schule tödlich verunglückt, fällt Adam die Aufgabe zu, zu den Kindern über seinen Tod zu sprechen. Er tut dies, indem er das Märchen von den Wasserkäfern und der Libelle erzählt. Er erzählt den Kindern von einem kleinen Volk von Wasserkäfern auf dem Grund eines Flusses. Von Zeit zu Zeit klettert einer der Käfer an einer Pflanze vom Wasser in das Licht hinauf und ist für immer verschwunden. Eines Tages entschied ein besonders kleiner Wasserkäfer, dass auch er eine Pflanze hinaufklettern wollte. Also kletterte er die Pflanze hinauf, durch die Oberfläche des Wassers und in die Luft. Und er verwandelte sich in eine wunderschöne Libelle. Er flog in der Luft herum und war so glücklich wie nie zuvor. Doch als er versuchte, wieder nach unten in das Wasser zu kommen, um seinen Käferfreunden zu erzählen, wie herrlich alles war, konnte er es nicht, da er kein Käfer mehr war. Er war eine Libelle. Dies machte ihn überaus traurig, bis er sich daran erinnerte, dass alle seine Freunde eines Tages ebenfalls die Pflanze hinaufklettern und zu ihm in die Sonne kommen würden.
Adam Smallbones Antwort auf die Frage, was mit uns geschieht, wenn wir sterben, ist eine sehr moderne, wie wir noch sehen werden. Doch die Fragen, mit denen er ringt, kehren immer wieder. Überleben wir den Tod? Werden wir uns wiedererkennen? Werden wir mit denen, die wir zurückgelassen haben, und denen, die uns vorausgegangen sind, wieder vereint sein? Werden unsere Taten, die wir in diesem Leben begangen haben, bestraft oder belohnt? Werden wir nach dem Tod die Gelegenheit haben, Dinge wieder gutzumachen oder uns zu ändern? Werden unsere Leben direkt nach dem Tod weitergehen, oder müssen wir auf ein endgültiges Ende der Geschichte warten? Welche Art von Körper könnten wir haben? Für die meisten von uns ist der Gedanke an das Ende unserer Existenz unerträglich. Andererseits ist der Gedanke, dass wir ewig leben werden, unvorstellbar.
Dies ist ein Buch über das, was auf den Tod folgt und nach dem Leben geschieht. Genauer gesagt ist es eine Geschichte über das Schicksal der Toten, darüber, wie wir dann beschaffen sein mögen oder was mit uns geschehen könnte, nachdem wir gestorben sind. Es ist auch eine Geschichte der Orte, an denen wir uns befinden könnten – im Himmel, in der Hölle oder im Fegefeuer, der Vorhölle oder in Abrahams Schoß, im Hades oder im Scheol, im Paradies, Tartarus oder auf der Insel der Seligen – und die komplizierte Geschichte der Verbindungen zwischen all diesen Orten.
Wir wissen über das, was nach unserem Tode geschieht, ebenso wenig wie über das, was unserem Leben vorausging. Daher handelt dieses Buch von den Vorstellungen über das Leben nach dem Tod von den antiken Griechen und Juden bis zur Gegenwart. Nach allem, was wir wissen, kann eine oder können mehrere oder kann keine dieser Vorstellungen der Wahrheit entsprechen. Doch was immer der Fall sein mag: Die Geschichte des Lebens nach dem Tod ist die Geschichte unserer Hoffnungen, dass es nach dem Tod etwas geben wird, und unserer Befürchtungen, dass es nichts geben wird. Und sie spricht – vorausgesetzt, dass es etwas statt nichts gibt – unsere Träume von ewigem Glück, unsere Albträume von ewiger Strafe sowie die zahllosen Variationen an, die sich im Laufe der Jahrhunderte daraus entwickelt haben.
Mit diesen Vorstellungen mehr oder weniger eng verwoben sind die beiden grundlegenden Erzählungen innerhalb des westlichen Denkens über das Leben nach dem Tod. Einerseits gibt es die Erzählung, die um die Erwartung gebaut ist, dass unsere Leben unmittelbar nach dem Tod eines jeden von uns weitergehen werden. Zum Zeitpunkt des Todes wird die Seele auf einer Waage gewogen und gemäß ihrer Lasterhaftigkeit oder Tugend in die Herrlichkeit des Himmels geschickt oder in den tiefsten Grund der Hölle gestoßen. Andererseits gibt es eine andere Erzählung, eine die durch die Erwartung gespeist wird, dass unser ewiges Schicksal nicht zum Zeitpunkt des Todes abschließend festgelegt wird, sondern zu der Zeit, zu der die Geschichte endet, wenn diese Welt nicht mehr sein wird und Christus wiederkehrt, um die Lebenden und die Toten zu richten. Da wird es nur zwei mögliche Endzustände für unsere dann mit ihren Leibern wiedervereinigte Seelen geben. Denn Christus wird die Seligen auffordern, in die ewige Freude einzutreten, und die Verdammten in das ewige Feuer werfen.
Nachdem sich diese Erzählungen in den ersten paar Jahrhunderten der christlichen Ära etabliert hatten, wurde im Westen die Geschichte des Lebens nach dem Tod die Geschichte einer ununterbrochenen, fortgesetzten Reihe kontroverser Gespräche, Auseinandersetzungen und Kompromisse zwischen diesen beiden Versionen über unsere Zukunft nach dem Tod. Die Mehrheit hielt fest entschlossen an der Notwendigkeit von beiden fest, und zwar in einem intellektuellen Kompromiss, der – wie es häufig bei solchen Anpassungen der Fall ist – immer kurz vor dem Scheitern stand. Dieser besondere Kompromiss zerfiel: zum einen dadurch, dass man ein fortdauerndes, bewusstes Leben des Individuums direkt nach dem Tod bestritt und leidenschaftlich das allgemeine Gericht am Jüngsten Tag behauptete, häufig im Kontext der Erwartung der unmittelbar bevorstehenden Wiederkehr Christi, während man zum anderen ebenso leidenschaftlich behauptete, dass unmittelbar nach dem Tode auf die Gerechten der volle Umfang der himmlischen Freuden und auf die Verdammten die vollen Schrecken der Hölle warteten, normalerweise in Erwartung einer langen Geschichte der Kirche auf Erden, verbunden mit einer völligen Missachtung der Möglichkeit eines unmittelbaren Endes der Geschichte.
Moderne Geschichten des Lebens nach dem Tod haben sich im Westen auf die eine oder die andere dieser beiden Erzählungen konzentriert. Im Unterschied dazu ist dieses Buch durch das Zusammenspiel, die Spannungen und Konflikte zwischen diesen beiden Erzählungen bestimmt, und zwar in einer Darstellung, die die Geschichte von beiden erzählt.
Ist die Geschichte des Lebens nach dem Tod in der westlichen Welt eine Geschichte der komplizierten und häufig unübersichtlichen Spannung zwischen dem Schicksal der Toten unmittelbar nach dem Tod und ihrem Schicksal nach dem Ende der Geschichte, so ist es ebenso die Geschichte des Konflikts über die Natur des Individuums sowie darüber, was in der Gegenwart dasjenige ist, das in die Zukunft überlebt. Mit dem Anfang des dritten Jahrhunderts übernahm das Christentum die traditionelle griechische Vorstellung, dass Individuen aus einem sterblichen Körper und einer unsterblichen Seele zusammengesetzt sind. Mit dieser Anthropologie ließ sich der Spannung zwischen dem Schicksal des Individuums nach dem Tod und nach dem Gericht ein Sinn verleihen. Was zwischen dem Tod und dem Jüngsten Gericht überlebte, war die Seele, und es war der Körper, der am Jüngsten Tag auferstand und mit der Seele wiedervereinigt wurde. Daher ist die Geschichte des Lebens nach dem Tod auch die Geschichte des Konflikts zwischen dem Körper und der Seele als dem Wesen dessen, was es heißt, ein Mensch zu sein, manchmal die Behauptung der Notwendigkeit von Leib und Seele, gelegentlich auch die Anerkennung des einen bei Ausschluss des anderen.
Dieser Gegensatz zwischen Körper und Seele ließ sich mit denkerischen Mitteln nur schwer aufrechterhalten, und so erzählt dieses Buch auch die Geschichte davon, wie instabil dieser Gegensatz zwischen Körper und Seele war, und über die Wahrscheinlichkeit, dass der eine Teil im jeweils anderen aufging und der Unterschied zwischen den beiden so praktisch redundant wurde. Die Seele wurde „verkörperlicht“ und der Körper „spiritualisiert“. Einerseits wurde es notwendig, der Seele diejenige Art von Quasi-Körperlichkeit zuzugestehen, die es erlaubte, ihr einen geografischen Ort nach dem Tod entweder über oder unter der Erde zuzuweisen. Dies führte dazu, dass sie körperliche Eigenschaften annahm – man gab der Seele ein Geschlecht, einen Rang und einen Status. Andererseits war es unerlässlich, den Körper zu „spiritualisieren“ – ihn nicht so wiederauferstehen zu lassen, wie er zum Zeitpunkt des Todes war, sondern in einer idealen Form, in der er sich an den Glückseligkeiten des Himmels erfreuen oder die Schmerzen der Hölle erleiden konnte. Diese Ambivalenz in Bezug auf das Wesen von Körper und Seele wurde durch Spannungen zwischen den verschiedenen Ansichten über den Zweck des Lebens nach dem Tode noch verstärkt – zwischen der passiven Kontemplation Gottes auf der einen Seite und dem aktiven Leben in der Gemeinschaft mit den himmlischen Gefährten, den Heiligen, den Engeln und Märtyrern auf der anderen; zwischen dem Fortschreiten in Richtung auf größeres Glück und höhere Vollkommenheit und dem Erreichen dieser beiden unmittelbar nach dem Tod. Unterschiedliche himmlische Bedürfnisse erforderten unterschiedliche himmlische Körper.
Die himmlischen Bedürfnisse unterlagen auch dem Wandel, und so ist im Westen die Geschichte des Lebens nach dem Tod auch diejenige einer Spannung zwischen zunächst einem ewigen Leben, in dessen Mittelpunkt die Liebe und Verehrung Gottes stehen, mehr oder weniger zum Ausschluss menschlicher Beziehungen, und des Weiteren einem Leben, in dessen Mittelpunkt menschliche Beziehungen stehen, als dem Beispiel göttlicher Liebe, und schließlich einem Leben, das auf menschliche Beziehungen konzentriert ist, bis hin zum faktischen Ausschluss Gottes. In den letzten zwei Jahrtausenden fand ein Gang durch diese drei Ideen statt: von einem um Gott zentrierten Himmel zu einer Abfolge profaner Himmel, die sowohl diesseitige als auch jenseitige Merkmale aufwiesen.
Gleichzeitig enthält dieses Buch auch eine Geschichte des menschlichen Verlangens nach Gerechtigkeit. Es erzählt von der Überzeugung, dass es den Bösen auf Erden gut zu ergehen scheint, während die Guten schmachten. Es überdenkt die Erkenntnis, dass – da die Tugend offenbar nicht ihr eigener Lohn ist – die beste Lösung für die Ungerechtigkeiten auf dieser Seite des Grabes darin besteht, sie auf der anderen auszugleichen. Daher berichtet es von der Schaffung von Orten, wo die Gerechten nach dem Tod ihre wohlverdiente Belohnung empfangen und die Bösen ihre wohlverdiente Strafe, sowie von Belohnungen und Strafen, die den Lastern und Tugenden angemessen sind.
Die Geschichte des menschlichen Verlangens nach Gerechtigkeit im Leben nach dem Tod ist auch eine Geschichte bestimmter Schlüsseleigenschaften Gottes, wie man ihn im Okzident während der letzten 2000 bis 2500 Jahre verstanden hat. Es war Gott, der die Guten belohnen und die Bösen bestrafen würde, der die Seelen zum Zeitpunkt des Todes auf die Waage legte und ihr ewiges Schicksal bestimmte. In der Geschichte des Lebens nach dem Tod tat er dies auf verschiedene Weise und zu verschiedenen Zeiten, je nach den verschiedenen Graden seiner Güte, seiner Gerechtigkeit und seines gerechten Zorns. Insbesondere die Frage nach dem Wesen Gottes führte zu der Frage, ob seine Güte die letztendliche Erlösung aller Menschen erfordere, trotz seiner Gerechtigkeit und seines Zorns, oder ob seine Gerechtigkeit und sein Zorn dazu führen würden, dass die Bösen eine ewige Strafe zu erleiden haben oder zumindest am Ende vernichtet werden würden – trotz seines Willens, dass alle Menschen errettet werden sollen.
Wie dem auch sei, und unabhängig davon, welches göttliche Attribut das göttliche Wesen am meisten bestimmte: Es wurde doch größtenteils akzeptiert, dass Gott die Toten, entsprechend ihrer Tugenden oder Laster, erretten oder verdammen würde. Doch manchmal wurde auch die Ansicht verteidigt, dass er ewiges Glück oder ewige Qual einfach aufgrund eines arbiträren Akts seines souveränen Willens zuteilte, unabhängig von den Tugenden oder Lastern einer Person. Kurz gesagt, Gott konnte tun, was immer ihm gefiel, und man behauptete, dass er genau dies tat. Dies war eine Ansicht, die nicht eben dazu beitrug, in diesem Leben nach Tugend zu streben, in der Hoffnung auf Belohnung im nächsten.
Und schließlich erzählt dieses Buch, inmitten all dieser Spannungen und Komplexitäten im Lauf der Jahrhunderte, die Geschichte dessen, was im westlichen Denken all diese Variationen in den beiden Großerzählungen über das Lebens nach dem Tod letztlich motiviert hat und was sie letztlich vereint. So erzählt die Geschichte des Lebens nach dem Tod davon, dass wir entschlossen sind, Sinn und Zweck in der Geschichte zu finden, verstanden von ihrem Ende her. Sie findet einen Widerhall in der Überzeugung, dass Sinn und Zweck des einzelnen Lebens aus der Perspektive der Ewigkeit gefunden werden können, von der man glaubte, und im Allgemeinen immer noch glaubt, dass sie auf den Tod folgt – diesen Moment zwischen Zeit und Zeitlosigkeit, diesem Leben und dem Jenseits, der droht, das gesamte Leben zu einer „Eitelkeit und einem Haschen nach Wind“ (Pred 2,11) zu machen.