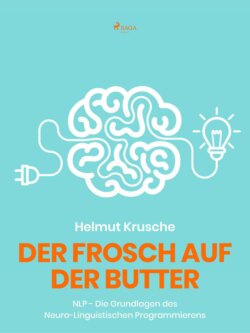Читать книгу Der Frosch auf der Butter - NLP - Die Grundlagen des Neuro-Linguistischen Programmierens - Prof. Helmut Krusche - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Das Meta-Modell
ОглавлениеBei jeder Kommunikation ist die Sprache von großer Bedeutung, weil die subjektiven Erfahrungen der Menschen, die sich in dem Modell von der Welt niedergeschlagen haben, durch die Sprache und den Körper ausgedrückt werden. Die Sprache repräsentiert die Erfahrungen, sie ist aber nicht die Erfahrung selbst. Diese Unterscheidung ist sehr wichtig.
Aus der Sprache erfahrt man, nach welchem Modell sich ein Mensch verhält. Kennen wir das Modell, das einem Verhalten zugrunde liegt, so werden wir auch den Menschen besser verstehen.
Ein praktisches Instrumentarium, mit dem man herausbekommen kann, wie Menschen ihre Modelle bilden, liefert das sogenannte Meta-Modell. Das Meta-Modell ist sozusagen ein Modell des Modellierungsprozesses. Mit seiner Hilfe kann man einerseits die notwendigen sprachlichen Informationen gewinnen und andererseits anderen Menschen helfen, ihre eigenen Modelle von der Welt zu verändern und ihr Leben zu bereichern. Um das Modell eines Menschen zu verstehen, muß man vor allem hinterfragen, welche Gestaltungsprozesse bei der Modellbildung mitgewirkt haben. Das Meta-Modell geht davon aus, daß drei Prozesse überwiegend in Frage kommen: Generalisierung, Tilgung und Verzerrung.
Generalisierung heißt, daß eine ursprüngliche Erfahrung, die in einem bestimmten Fall gültig war, verallgemeinert wird. Generalisierung ist für unser Leben und Überleben notwendig, da nur so Erfahrungen zu Regeln werden, die die vielen Entscheidungen im Leben vereinfachen.
Wer als Kind einmal gelernt hat, daß man eine Schraube rechts herum reindreht und nach links herausdreht, der wird diese Erfahrungen generalisieren. Ob es sich um einen Wasserhahn, das Heizungsventil oder den Korkenzieher handelt, langes Nachdenken ist dann in Zukunft nicht mehr notwendig. Generalisierung kann aber den Menschen auch einschränken. Das kann sogar bei Schrauben mit Rechtsgewinde der Fall sein. Im allgemeinen sieht man auf die Schraube von oben herab und dreht sie dann nach rechts hin. Was aber, wenn Sie von unten auf eine Schraube schauen? Neulich versuchte ich, den Duschschlauch an der Badewannenarmatur abzuschrauben. Er ist unterhalb des Hahns angebracht, und ich mußte von unten nach oben schauen. Prompt drehte ich ihn in die falsche Richtung und zog ihn immer fester an, statt ihn zu lösen.
Besonders einschränkend können Generalisierungen wirken, wenn es sich um ein gefühlsmäßiges Erleben handelt. Wenn eine Frau zum Beispiel von einem Mann sehr verletzt wurde und sie das Gefühl dieser Erfahrung auf alle Männer überträgt, also alle Männer für sie schlecht sind, dann schränkt sie damit ihr zukünftiges Leben drastisch ein. Solche Generalisierungen finden wir in großer Zahl im Leben vieler Menschen.
Bestimmte Wörter deuten auf Generalisierungen hin: das muß man, soll man, das tut man, immer, niemals, jeder ...
Tilgung bedeutet, daß wir aus der Vielzahl von Informationen, die uns laufend erreichen, nur einige wenige auswählen und in unser Bewußtsein dringen lassen. Das Beispiel schwerhöriger Menschen, die ein Hörgerät tragen, zeigt, was geschieht, wenn ein Mensch alle Geräusche aufnehmen muß, ohne sich auf einige wenige konzentrieren zu können. Das Hörgerät erlaubt keine Tilgung. Der Träger des Hörgeräts kann nicht auswählen, sondern alle Geräusche in seiner Umgebung dringen an sein Ohr. Ein Schwerhöriger in einer Gruppe von Menschen, die sich laut und lebhaft unterhalten, kann das Stimmgewirr als reine Folter empfinden.
Während es aber einerseits absolut notwendig ist, daß wir aus der Flut von Informationen die unwichtigen von uns femhalten, so kann eine solche fast schon gewohnheitsmäßige Tilgung andererseits dazu führen, daß wir auch Teile unserer Erfahrungen ausklammem, die unbedingt zu unserem Modell der Welt gehören sollten.
Auseinandersetzungen zwischen Partnern sind ein vortreffliches Beispiel für vorgenommene Tilgungen. Schuld hat ja immer der andere! Die eigenen Fehler oder Handlungen, die zu der verfahrenen Situation geführt haben, werden in der Regel getilgt, häufig ohne sich dessen bewußt zu sein. Kinder sind Meister im Tilgen. Sie überhören ganz einfach das, was sie nicht hören wollen.
Verzerrungen gehören auch zum Prozeß der Gestaltung und damit zu unserem normalen Leben. Wir verzerren oder verfälschen in vielen Fällen die Wirklichkeit, wenn wir sie mit unseren Sinnen erfassen.
Verzerrungen erkennt man zum Beispiel an Nominalisierungen. Nominalisierungen entstehen, wenn aus Verben Nomina gemacht werden und damit aus einem Prozeß, der verändert werden kann, ein Ding oder Ereignis, das der Kontrolle entzogen ist. »Ich bedaure meine Entscheidung« wäre eine solche Nominalisierung, entstanden aus dem Verb »entscheiden«. Entscheidung ist etwas Abgeschlossenes, entscheiden kann man sich dagegen immer wieder.
Neben Generalisierungen, Tilgungen und Verzerrungen gibt es noch eine ganze Zahl weiterer Gestaltungsprozesse. Sehr aufschlußreich finde ich das Gedankenlesen, denn besonders Partnerkonflikte werden dadurch häufig verschärft.
»Ich weiß genau, daß sie mich nicht liebt.« Woher weiß du das? Kannst du Gedanken lesen? Der umgekehrte Fall ist die Annahme, daß die anderen wissen müßten, wie wir fühlen oder denken. Woher aber sollen sie es denn wissen, wenn wir es ihnen nicht sagen? Können sie Gedanken lesen?
Mit Hilfe der Methoden des Meta-Modells können Sie die Einschränkungen hinterfragen und Ihre Kommunikation verbessern. Ich werde jetzt an einigen Beispielen illustrieren, wie dieses sehr vielseitige Modell funktioniert.
»Niemand mag mich.« »Niemand« ist eine Generalisierung. Eine ursprüngliche Erfahrung wurde so generalisiert, daß sie den wirklichen Gegebenheiten nicht entspricht. Wer genau ist denn »niemand«? So notwendig Generalisierungen in unserem Leben sind, wenn sie nicht mehr in den jeweiligen Kontext passen, sind sie nicht nützlich.
Wie schon erwähnt, erkennt man Verallgemeinerungen an Wörtern wie niemand, jeder, alle, immer, nie, man ...
»Ich mache immer alles falsch.«
»Ich kann mir nie etwas merken.«
Eine wirkungsvolle Art, Generalisierungen zu hinterfragen, besteht darin, diese Wörter in der Frage besonders zu betonen.
»Machen Sie immer alles falsch?« »Können Sie sich nie etwas merken?«
Jemand sagt: »Ich fürchte mich«. Diese Information ist nicht vollständig. Hier liegt eine Tilgung vor. Erst wenn Sie erfahren, vor wem oder was er sich fürchtet, haben Sie die getilgte Information wiederentdeckt.
Durch gezieltes Fragen kann man erreichen, daß Tilgungen aufgehoben werden. »Das gefällt mir nicht.« Die Frage dazu: »Was genau gefällt Ihnen nicht?«
Oder: »Ich verstehe nicht.« Und die Frage: »Was genau verstehen Sie nicht?«
Nun zu den Nominalisierungen als Ausdruck einer Verzerrung. Jeder gute Redner achtet darauf, daß er Nominalisierungen vermeidet. Sie machen den Stil einer Rede oder auch eines Berichtes schwerfällig und unverständlich. Durch Verben wird der Stil dagegen lebendig und dynamisch. »Ich möchte meiner Freude Ausdruck geben ... « Das ist hölzern. Statt dessen kann man schlicht und einfach sagen: »Ich freue mich.«
Auch Nominalisierungen kann man hinterfragen. »Ich bekomme keine Hilfe ... «
»Wie möchten Sie, daß Ihnen geholfen wird?«
»Ich habe Angst.«
»Was ängstigt Sie?« Oder: »Wovor ängstigen Sie sich?«