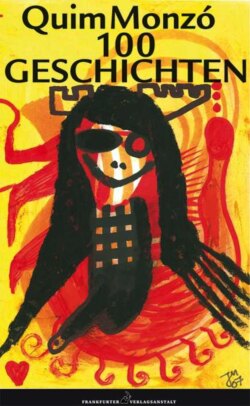Читать книгу Hundert Geschichten - Quim Monzo - Страница 17
Über die Nichtigkeit menschlicher Wünsche
ОглавлениеAls ich die Insel erreichte, wähnte ich mich dem Tode nah und zweifelte an meiner Fähigkeit, so viel rote Sonne und ebenso viel Einsamkeit zu ertragen: überall Wasser, Wasser im Norden, im Süden, im Osten, im Westen, wohin auch immer sich mein Blick wandte, blaues oder graues oder grünes oder schwarzes Wasser, ein verschlafener Horizont und der kalte Klang der Wellen, die das Weiß des Sandes tränkten. Ich schwamm ans Ufer, völlig erschöpft, und als ich mich umdrehte, sah ich gerade noch, wie der hintere Teil des Schiffes (das man Heck nennt) endgültig in der Tiefe versank. Ein paar riesige Luftblasen stiegen vom Meeresgrund empor, und schon gab es kein Schiff mehr. Jetzt war ich völlig allein und überlegte, ob vielleicht irgendeine andere Person die Tragödie überlebt hatte, doch offenbar war ich der einzige Überlebende, der Einzige, der es geschafft hatte, diese Insel zu erreichen, auf der weit und breit keine Menschenseele zu sehen war. Demnach waren alle tot: der Tod, Herr der Dämmerung, die über meinen Kopf und meinen Körper hereinbrach. Wundgescheuert und zermürbt, war ich überzeugt, dass diese klitzekleine Insel nicht meine Rettung war, sondern vielmehr das Hinauszögern meines endgültigen Todes, mein zukünftiges Grab, der Stein, der mein Grab nach ein oder zwei Tagen verschließen würde, je nachdem, wie lange mein Körper kämpfte. In meiner Hoffnungslosigkeit nahm ich an, keine Nahrung zu finden, doch die Insel war voller Früchte und Pflanzen und seltsamer Tiere (beispielsweise Kaninchen mit Entenköpfen und Greifzungen). Am zweiten Morgen (ich hatte den ganzen Tag und die ganze Nacht geschlafen) schlug ich die Augen auf und hatte das Gefühl, Feuer peitsche meine Haut: Es war die Sonne, die mich verbrannte. Bald sah ich ein, der einzige Ausweg war Überleben. Und Überleben bedeutete zu lernen, mit dieser Einsamkeit, diesem heißen Wind und der ewigen über dem Meer vor meinen roten Augen schwebenden Zeit zu leben. Ich wanderte am Strand entlang, ging schwimmen, kühlte meinen verbrannten Rücken mit Wasser und kehrte an den Strand zurück. Und da fand ich die Leiche, eine alte, traurige Leiche, an eine glitschige Holzplanke geklammert, die genauso nutzlos war wie sie selbst. Ertrunken und namenlos lag sie nun ausgestreckt im Sand. Mit der Fußspitze drehte ich sie auf den Rücken und erkannte einen der Matrosen vom Schiff: mit Augen wie Nacktschnecken und einem dunklen, aufgeblasenen Kindergesicht. Ekel. Vielleicht würden noch weitere Leichen angeschwemmt werden, doch weit und breit war nichts zu sehen. Alle anderen sind im Meer, sagte ich zu mir und schubste ihn dabei mit dem Fuß ins Wasser, in der Hoffnung, die Wellen trügen ihn mit sich fort (eine sinnlose Hoffnung, denn die Leiche kam immer wieder, ein ums andere Mal, jeden Tag). Manchmal blieb sie eine Weile verschwunden, und wenn ich schon dachte, ich sähe sie nie wieder, lag sie am Tag darauf wieder am Strand, zehn Meter weiter vielleicht oder gar auf der anderen Seite der Insel. Diese verrückte, schmutzige, alte, traurige und dumme Leiche ließ mich einfach nicht in Ruhe, so oft ich sie auch ins Meer schubste, sie kam immer wieder, bis sie eines Tages dann doch wegblieb, so als hätten die Fische sie endlich aufgefressen. Mit ihrem Verschwinden wurde mir erst bewusst, wie allein ich war, mir fiel (wie könnte es anders sein?) Robinson Crusoe ein, und ich machte mich auf die Suche nach einem Freitag, aber es gab hier nicht eine verdammte Menschenseele. Ich begann die winzige, aber hügelige Insel zu erforschen, mit ihren kleinen Anhöhen und den Buchten durchsichtigen, rosigen Wassers, den weißen Stränden und lilliputanischen Felsenküsten. Ich entdeckte eine kühle Höhle, die ich umgehend zu meiner Behausung machte. Allerdings lief sie bei Regenwetter mit Wasser und Schlamm voll. Ich aß Früchte vom Baum, seltsame Fische und zwischendurch auch mal eines dieser behaarten Entenkaninchen, das ich mit Steinen jagte. Ich stellte mir auf niedrigstem Niveau ein Programm für ein zufriedenstellendes Leben zusammen: Ich schlief viel, ging schwimmen, doch vor allem dachte ich nach (es ist schrecklich, wie viel Zeit man unter solchen Umständen zum Überlegen hat, alles wie in einem Film, den man mal in einem Kiezkino gesehen hat, mit dem einzigen Unterschied, dass hinterher nicht die Lichter angehen und wir nicht das Kino verlassen, denn dieser Film lief ununterbrochen Tag und Nacht, er war meine alltägliche Existenz). Meine ganze Umgebung schien nichts anderes als Kulisse zu sein, so als müsste ich eines Tages aufstehen, in die Hände klatschen und ausrufen: Auf, es reicht jetzt, Schluss mit dem Theater. Und danach wäre alles wieder normal. Das heißt: Ich würde wieder ein Standardleben in einer fernen Standardstadt leben. Doch aus Angst vor der schlimmsten aller Enttäuschungen konnte ich mich nicht dazu durchringen, in die Hände zu klatschen. Auf der ganzen Insel fand ich nie eine menschliche Fußspur. Nichts. Da die Gegenwart sich für mich eher verdrießlich darstellte, pflegte ich die Erinnerung an vergangene Zeiten: als ich klein war und in die Schule ging, an die Schulfreunde, an meine Zeit bei der Armee, an die Straßen voller Menschen, an meine Kinobesuche, an Vanilleeis und Orangeade, literweise Orangeade, holländisches Bier, Omelett aus zwei Eiern und Tomatenbrot, Salat, Schneckennudeln, Paprikawurst, Filetsteaks, Seehecht auf baskische Art, Schokolade mit Sahne in der Petritxolstraße, Mandelmilch und Coca-Cola, ans Fernsehen und ans Einschlafen beim Radiohören, wenn ich es satt hatte, spätnachts mit Unbekannten in lauten Kneipen zu reden. Beim Onanieren denke ich an all die namenlosen Frauen, mit denen ich im Bett war. Wie weit entfernt diese Welt doch war und wie gruselig, den Samen auf den weißen Sand des Strandes spritzen zu müssen. Die Landschaft vor mir verändert sich kein bisschen: monoton und konzentrisch, gleichgültig und geschlechtslos. Eines Tages sah ich ein Flugzeug, das den Himmel von einem Horizont zum andern durchquerte. Nach ein paar kurzen Sekunden verschwand es. Am nächsten Tag kehrte ich an denselben Ort zurück und beobachtete den ganzen Tag lang den Himmel. Es ödete mich an, von morgens bis abends dieses selbe fade Blau zu sehen, welches sich verdunkelte und zu einem besternten Schwarz wurde. Ich sah nie wieder ein Flugzeug. Verrücktes Flugzeug, enigmatisches Charterflugzeug, das sich in der Route geirrt hatte.
An dem Tag, an dem in Erfüllung ging, was ich mir so lange erträumt hatte, war ich wie an jedem Morgen der vielen tausend Morgen meiner wilden Existenz aufgestanden. Ich hatte in den durchsichtigen Gewässern gebadet und wollte gerade ein paar Früchte essen. Da merkte ich plötzlich, wie ich meine Augen überrascht aufriss: Vor mir lag ein riesiges, weißes, schweigendes Schiff. Das Wunder verschwand nicht, als ich meine Augen rieb. Ich rannte ins Wasser und machte vor lauter Freude Luftsprünge, während sich ein Boot mit vier oder fünf Männern an Bord, die mir Handzeichen machten, langsam dem Strand näherte. Ich weinte vor Freude: Bald wären das Vanilleeis, das holländische Bier, die heiße Schokolade mit Sahne in der Petritxolstraße, die Nächte, in denen ich bei Radio Joventut einschlief, wieder da. Nach ihrer Ankunft am Strand mit den vorhersehbaren Umarmungen und den Versuchen, in einem Kauderwelsch ein Gespräch zustande zu bringen, gab man mir ich weiß nicht was für Pillen gegen alle Krankheiten der Welt, ein Arzt untersuchte mich von oben bis unten und erklärte schließlich, ich sei vollkommen gesund. Doch sie schauten mich alle etwas komisch an. Ich dachte, das läge vielleicht an meiner Magerkeit oder an meinem Bart . . . Unterdessen landeten sie weiter an (sie waren viele: Dutzende von Personen, Männer und Frauen) und durchforschten das Gelände. Ich fragte mich, warum sie in so großer Zahl an Land gingen und was sie hier wollten, anstatt mit mir ins Boot zu steigen und zum Schiff zu fahren, das uns ein für alle Mal heimbringen würde (und heim bedeutete jeden Ort, an dem ich die Möglichkeit hatte, mich in einem Bad mit glänzenden Kacheln zu duschen, mich mit einem Handtuch abzutrocknen, deutsche Küche zu essen, Leute zu treffen, wieder ins Kino zu gehen und mich zu besaufen). Weitere Boote landeten an, voll bepackt mit riesigen Bündeln und Kisten. Ich näherte mich dem, der aussah, als habe er am meisten zu sagen, und fragte ihn, wann wir abfahren würden. Wir werden nicht mehr von hier fortgehen, antwortete er. Wir haben uns entschlossen, vor dem Wahnsinn der jetzigen Welt zu fliehen und an einem fernen Ort, ohne Qualm und Neid, Furcht und Angst, eine Gemeinde zu gründen, eine neue Welt, in der wir alle Brüder sind (dabei öffnete er lächelnd seine Arme, schaute eine lange Weile in den Himmel und fuhr fort): Wir sind hierhergekommen, um unsere Gemeinde aufzubauen. Während er das sagte, nahmen seine Gefährten schon das Schiff auseinander und begannen, mit den Brettern Wände und Dächer zu errichten.