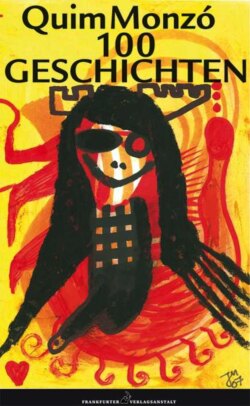Читать книгу Hundert Geschichten - Quim Monzo - Страница 9
Über das Nichterscheinen zu Verabredungen
ОглавлениеIch gehe nur selten in die Stadt hinunter: Nur, wenn ich einkaufen oder mit jemanden reden muss; denn zwischen dem einen und dem anderen Ort liegen zwei lange Stunden im Zug durch Minzwiesen und Krokantberge hindurch, obendrein stört mich das Reisen, es ist anstrengend, nimmt mich mit, mir wird dabei schlecht und mein Gesicht leichenblass. Natürlich bleibt einem manchmal nichts anderes übrig, als sich in den Zug zu setzen, ausgerüstet mit Reisetabletten und einem Riechfläschchen, so wie eben heute, denn man kann ja nicht immer nein sagen. Zudem werden wir in der letzten Zeit ja nicht gerade verwöhnt, und kaum hast du dich auf einen der roten Sitze gesetzt, bist du auch schon eingenickt. So vergeht die Zeit schneller, und ehe du dich versiehst, bist du angekommen, selbst wenn du dann bemerkst, dass du viel zu früh da bist. Denn erst als ich aus dem Zug stieg (ein Fuß auf dem Trittbrett, den anderen auf dem Bahnsteig) schaute ich auf die Uhr, doch mit reichlich mehr als genügend Zeit anzukommen, ist ein so in mir verwurzeltes Laster, dass es mich nicht mehr aus der Ruhe bringt: Es war halb eins, und ich war erst um fünf verabredet, was hieß, dass ich eine lange, langweilige Zeit vor mir hatte, eine Aussicht, die mich dazu veranlasste, Zeitungen zu kaufen; in der Nähe des Bahnhofs sah ich einen Kiosk und einen Platz, auf den eine sengende Sonne knallte (ich setzte mich auf eine silberne Bank unter Ulmen aus metallischem Schweigen). Am anderen Ende des Platzes spielten unter den diskreten Blicken ihrer jungen, rosafleischigen Mütter, denen der Geruch von frischem Stroh anhaftete, ein paar krummbeinige Bürschchen Fangen, was mich auf die Idee brachte, Spielsachen und Kuchen zu kaufen. Deshalb machte ich mich auf den Weg zu den Riesenkaufhallen, diesen Betonmassen, die mein Geld verschlangen und mich später mit einem trommelnden Kopf aus kunterbunten Melodien wieder ausspieen. In der verbleibenden Zeit ließ ich mich an den Schaufenstern, den Luftballons und explosiven Distelfinken vorbeitreiben, die Lupinenkerne zum halben Preis anpriesen, und gesellte mich zu einer Gruppe von Leuten: Sie bildeten einen Kreis, in deren Mitte zwei Quallen mit majestätischer Gewalt gegeneinander kämpften, sie bewegten dabei Arme, Beine, Flügel und Saugnäpfe. Es war wie bei den mexikanischen Hahnenkämpfen; Staub an den Kehlen der schwitzenden Zuschauer in geblümten Hemden. Eine der beiden Medusen umklammerte die andere und schien ihr Blut auszusaugen, ein nicht existierendes gelbes, stinkendes Blut, das unaufhörlich kochte, bis sie zu Boden fiel und nicht mehr aufstand (der Besitzer der Siegerin sammelte stolz sein Tier ein: Er griff es mit der Hand und zeigte es in Siegerpose lächelnd dem Publikum, die Scheine in der Tasche; der Verlierer weinte mit der toten Qualle im Arm). Die Leute liefen allmählich auseinander und ich mit ihnen. Ich bekam Hunger, warf die unangetastete Papiertüte mit den Lupinenkernen weg, betrat ein Restaurant und bestellte Sauerkraut, Mineralwasser und einen doppelten Espresso (der letztendlich ein Brandy auf Eis war und öligbitter wie Benzin schmeckte). Ich betrat das Gebäude (mit einer riesigen Uhr an der Fassade), als es fünf vor fünf war. Alles schien verlassen: die Eingangshalle, der lange, verglaste Flur, der in einen kalten Garten mündete, die seitlichen Säle voll gesalzener Elektrizität und bar jeglicher Aktivität. Auf einer Theke fand ich ein schlafendes Pförtnergesicht. Als ich nach dem Herrn Oliver fragte, schaute der Concierge schläfrig zu mir hoch und versicherte mir apathisch, dieser sei nicht da, er habe ihn den ganzen Tag nicht gesehen. Trotz dieser ganzen Beteuerungen insistierte ich weiter, sodass er mich schließlich einließ. Dann schauen Sie eben selbst nach, sagte er (mit einer Spur Häme in der Stimme), mal sehen, ob Sie ihn finden; mehr kann ich nicht für Sie tun. Und er legte seinen Kopf wieder auf dem Marmortisch ab und machte die Augen zu, während ich mich entschloss, durch die mephistophelischen Schatten eines modernen Märchens zu schweifen: Finsternis und Rasiermesserstille, leichte Fußspuren auf dem glänzenden Boden, alles gewürzt mit einem Duft von Magenta, von fauligen, blau bemalten Granatäpfeln, eine lange Kamerafahrt, ich weiß nicht, ob parallel oder frontal, unter Sonnendächern, durch kalte Räume und zwischen eingestaubten Kulissen hindurch: große Balkone über einem Ganges aus Plastik, eingerissene Dünen aus gelbem Karton, Papieravenuen in New Yorks vom Trödel, Gefängnisse aus Pappe mit Drahtfenstern, Styroporschnee und Papiereis und darüber: ein einziges schwarzmechanisches Netz unter einer unsichtbaren Decke. Das Rauschen unsäglicher Flüsse, von hochspezialisierter Polizei bewacht (die Studios verlassen: keine einzige Kontrolle im ganzen Gebäude). Durch Porzellanflure hindurch erinnert der Hunger der Motten an vergessene Erzählungen Poes: kalte Apparate, Kameras über Kameras, Galgen, verrostete Mikros, alles düster und dunkel (keine Spur einer menschlichen Seele). Ab und zu ein stummes Fernsehgerät, wo dunkle Schatten mit menschlichem Antlitz tanzen, die Lippen bewegend und unhörbare Worte sagend, wo sich glückliche Paare ohne Musik drehen, wo Stoffcowboys lautlose Schüsse abfeuern (Stille in einem Meer aus süßem Eis). Ich schaue auf die Uhr: viertel sechs, und noch ist keiner da (sie haben sich verspätet, denke ich, vielleicht kommen sie noch). Ich gehe weiter, nun durch ein Indianerdorf. Eine Kamera ist auf einen Stuhl gerichtet, der von einem weißen Scheinwerfer angestrahlt wird. Ich setze mich. Schaue. Vor mir reproduziert ein kleiner Bildschirm mein Bild: Wenn ich mich bewege, bewegt sich eine kleine Kopie von mir; wenn ich tanze, tanzt sie; wenn ich lache, lacht sie; wenn ich ruhig ins Objektiv schaue, bleibt sie stumm und schaut mir in die Augen. Sechs Uhr. Ich gehe. Jede Geduld hat mal ein Ende. Ich laufe die Treppe hinunter, komme in die Halle: Der Pförtner ist nicht mehr da. Alles ist leer. Ich öffne die Tür und dann sehe ich den kleinen, blassen Mann dahinter, der mich mit gesenktem Kopf beobachtet. Und Sie?, frage ich ihn. Sind Sie auch wegen der Aufnahmen gekommen? Haben Sie Herrn Oliver gesehen? Was für eine Unverschämtheit! Und da er nicht antwortet, packe ich ihn am Kragen und hebe ihn hoch (die Füße zappeln durchsichtig). Ich bin hier, um das Haus abzuschließen, antwortet er und schaut mir dabei in die Augen. Ich stelle ihn wieder auf den Boden, und er fügt hinzu: Um diese Uhrzeit gehen sie alle, sie haben es satt, noch länger zu warten. Dann komme ich und schließe ab. Das Männchen hat mir anscheinend nichts mehr zu sagen und bewegt sich nervös, so als sei es zu spät und daher in Eile oder als trage es auf seinen Schultern eine große Last, die durch meine Fragen noch größer wird. Ich mache mich auf den Weg und suche ein Taxi, das mich zum Bahnhof bringt.