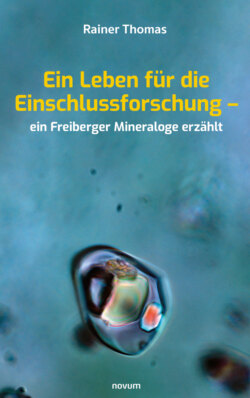Читать книгу Ein Leben für die Einschlussforschung – ein Freiberger Mineraloge erzählt - Rainer Thomas - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDas Studium
Im September 1964 begann ich das Studium der Mineralogie an der Freiberger Bergakademie. Vorher gab es auch einen Versuch der Stasi-Dienststelle in Löbau, mich für eine Offizierslaufbahn zu gewinnen. Ich habe meine Interessen dargelegt und abgelehnt. Es gab nie wieder irgendwelche Kontakte.
Wir waren eine kleine Gruppe von 10 Studenten und einer Studentin, Constanze von Engelhart. Nur die wenigsten waren über das Hobby zur Mineralogie gekommen. Die ersten Vorlesungen bei Professor Hans-Jürgen Rösler (1920–2009) waren nicht sehr motivierend. Ihm fehlte das Gespür, die unterschiedlichsten Facetten einer interessanten und schönen Wissenschaft uns jungen und wissbegierigen Menschen nahe zu bringen. Er hätte sicherlich mit Gewinn den bemerkenswerten Roman über eine Wissenschaft von Hermann Tertsch (1880–1962) „Das Geheimnis der Kristallwelt“ aus dem Jahr 1947 gelesen. Aber Professor Rösler hatte prinzipiell etwas gegen Popularisierung seiner Wissenschaft. Viel später habe ich einmal dieses Buch Professor Eduard Woermann (1929–2008) aus Aachen nach einer interessanten Diskussion zur Stellung der Mineralogie in den Naturwissenschaften geschickt – er war mehr als begeistert!
Schon im ersten Studienjahr hatte der aussichtsreichste Kandidat, ein Hobby-Mineraloge mit einem profunden mineralogischen Wissen, Dieter Götz aus Weinböhla, das Handtuch mit der Begründung „ich lasse mir doch die Freude an der Mineralogie nicht durch Professor Rösler versauen“ hingeworfen.
Am Ende des ersten Studienjahres, am 16. Juli 1965, fiel ich durch die allererste Prüfung mit einem „Hurra“ durch. Es war das Prüfungsfach „Allgemeine Geologie“ bei Professor Günter Viete (1920–1974). Der Prüfungstag war ein verregneter Freitag und die Prüfung fand im Humboldt-Bau statt. Vom Dauerregen abgesehen, braute sich an diesem Tage etwas zusammen. Der erste Prüfling Siegfried Hahn kam mit hängenden Ohren zurück. Er war durchgefallen. Ich war mit Thomas Reich in der Mittagszeit „fällig“. Um gestärkt anzutreten, habe ich mir ein Ei braten wollen – drei Versuche gingen schief. Alle drei der vorhandenen Eier waren faul. Die Nervosität stieg. Am Humboldtbau angekommen, fiel ich erst einmal die nasse Außentreppe hoch. Ich war praktisch am Boden zerstört. In der Prüfung hatten wir u. a. die Aufgabe, sechs vorgelegte Gesteinsproben zu erkennen. Das sollte eigentlich für mich eine leichte Übung sein. Aber ich begann mit einem Kardinalfehler. Ich erkannte fünf Proben sofort. Bei einer Probe war ich mir nicht sicher und stupste Thomas Reich fragend an. Er tippte mit dem Finger auf die Tischkante und wollte zu verstehen geben, dass es sich um Holzgneis handelt. Schusselig, wie ich nun durch vorangegangene „Events“ war, antwortete ich auf die Frage, worum es sich nun handelt, mit „versteinertes Holz“. Professor Viete sprang vor Begeisterung auf, wieder hatte er einen so seltenen Idioten erwischt und dann auch noch unter den Mineralogen, nicht unter irgendwelchen Nebenfächlern, von denen man solche Fehlbestimmungen eher erwartet hätte. In den Übungen hatten wir eine ganze Reihe solcher Fallstricke kennengelernt. Das „versteinerte Holz“ war wahrscheinlich der Höhepunkt in seiner Prüfungsgeschichte. Zu meinem 65. Geburtstag habe ich von Wolfgang Seifert als Erinnerung an diese Begebenheit ein Stück Holzgneis geschenkt bekommen. Dieses Exemplar ähnelt dem Prüfungsstück bis ins Kleinste – kommt wahrscheinlich aus der Gegend um Kutna Hora.
Wolfgang Seifert (geb. 16. Juli 1947), aus Sebnitz stammend, hat auch in Freiberg Mineralogie studiert – zwei Studienjahre unter uns. Nach dem Studium hat er eine Tätigkeit bei der Wismut aufgenommen und ist kurze Zeit danach an das ZIPE in Potsdam gelangt (1979). Mit Dieter Rhede hat er das Elektronenstrahl-Mirokrosonden-Labor aufgebaut und betreut. Viele Mineralberechnungen der Nutzer der Mikrosonde stammen von ihm – seine innere Ruhe und Gelassenheit waren dafür prädestiniert. Ein Jerewan-Witz, manchmal von ihm zum Besten gegeben, ist typisch für ihn:
Frage: Kann ein Hund Geologie studieren?
Antwort: Im Prinzip ja, aber es muss schon ein ganz dummer Hund sein.
Generell war das Studium nicht sehr erbauend. Was wir gelernt haben, war zwar solides Handwerk, das einigen von uns in der späteren beruflichen Praxis von Nutzen werden sollte – aber eine Empfehlung, sich mit der Wissenschaft näher zu beschäftigen, war es nicht. Selbstverständlich waren die Vorlesungen in den Hauptfächern, insbesondere Physik und Chemie, wichtig. Neben dem allgemeinen Bildungsauftrag sind aber oft nur skurrile Erinnerungen geblieben. Solch eine Begebenheit sehe ich heute noch bildlich vor den Augen – eine nette Anekdote. Der Mathematiker Prof. Dr.-Ing. Alfred Kneschke (1902–1979) trat in den recht gefüllten Vorlesungssaal und bemerkte drei Schwarze in der ersten Reihe. Er ging auf sie zu und fragte: Seid ihr aus Thüringen oder Sachsen? Schüchtern kam zurück: Nein, wir kommen aus Ghana und Guinea. Nächste Frage von Prof. Kneschke: Wie könnt ihr mich denn da überhaupt verstehen? Legendär sind auch seine abgebrochen Montags-Vorlesungen nach einer durchzechten Nacht im Waldkaffee. Er trat in den Vorlesungssaal, blickte kurz und ziemlich frustriert in die Runde, trat an die Tafel, Halt suchend, und fragte: Sinus, wo bist du? Er fand ihn nicht und ist gleich wieder verschwunden. Die Vorlesung wurde nach kurzer Pause von Dr. Hans Bandemer fortgesetzt.
Neben den Vorlesungen zur anorganischen und analytischen Chemie bei den Professoren Schrader und Ackermann im Clemens-Winkler-Bau an der Leipziger Straße begann dort zu Beginn des Studiums im Jahre 1964 die praktische Arbeit jedoch mit der Lötrohrprobierkunde bei Dr. Gerhard Thieme. Diese Technik hatte ich schon vor Ende der Grundschulzeit für die Mineralbestimmung zu praktizieren begonnen und war damit recht gut vertraut. Leitfaden waren die von Leutwein, Edelmann und Krüger verfassten Lehrbriefe „Allgemeine und spezielle Lötrohrprobierkunde“, herausgegeben in den Jahren 1954 bis 1960 von der Abteilung Fernstudium der Bergakademie Freiberg.
In der Chemievorlesung hat Prof. Dr.-Ing. Richard Schrader den manchmal trockenen Stoff auf seine Weise aufgelockert. Wenn die Tafel vollgeschrieben war, forderte er seine Assistentin auf: Fräulein Jänsch, machen sie doch mal oben frei! Berühmt war seine Weihnachtsvorlesung. Manchmal lockerte er den spröden Stoff mit solchen Sätzen wie „Minimax ist großer Mist, wenn man nicht zuhause ist“ auf.
Er war oft sehr direkt. Die politische Obrigkeit bezeichnete er stets als Bonzen. Im Jahr 1968 musste er wegen solcher Äußerungen seine Professur niederlegen – er wurde fristlos entlassen. Er wurde offensichtlich von Studenten denunziert und von der Partei in die Industrie verbannt – ich glaube nach Coswig. Professor Schrader wurde durch seine Arbeiten zur mechanischen Aktivierung von Festkörperreaktionen bekannt. In einer kleinen Arbeit aus dem Jahr 1969 haben Schrader und Kollegen dieses Gebiet eindrucksvoll beleuchtet. Ein schönes, selbsterlebtes Beispiel der mechanischen Aktivierung ist die Aufnahme von Kobalt als wasserlösliche Phase in das Fluorit-Mahlgut in einer Kugelmühle mit Wolframkarbid-Kugeln während meiner Diplomarbeitszeit. Kurzfristig hatte diese Beobachtung zu geistigen Höhenflügen meines Betreuers geführt.
Seine Prüfungen waren auch etwas gefürchtet. Sie begannen mit ganz überraschenden Fragen der Art: Stellen sie sich vor – Bitterfeld – großer brauner Haufen – was ist das? Wenn man da keinen einigermaßen brauchbaren Vorschlag gemacht hat, war man bei ihm schnell durch. Man konnte sehr freizügig eine Auswahl treffen – es musste sich nur eine interessante chemische Geschichte ableiten lassen.
Analytische Chemie wurde von Professor Gerhard Ackermann (geb. 1922 in Dresden) gelesen. Seine obligatorische Fliege ist aus der Erinnerung nicht wegzudenken. Er war Spezialist für die Spektralphotometrie. Unter seiner Leitung wurde eine Vielzahl von organischen Reagenzien als Komplexbildner für die Metallbestimmung untersucht und analytisch bewertet. Hier bin ich indirekt wieder auf das Dithizon gestoßen (s. Jahresarbeit zum Abitur). Auch Dr. Werner Schrön hat sich 1960 in einer kleinen Arbeit der Anwendung der Dithizonchemie bei der geochemischen Prospektion gewidmet.
Aus dem analytischen chemischen Praktikum ist mir, gleich am Anfang, meine fehlerhafte Arsenanalyse in guter Erinnerung geblieben. Ich hatte ein schwarzes Pulver auf Arsen zu untersuchen. Als Methode war die Destillation vorgeschrieben. Ich war schnell fertig und hab das Ergebnis abgegeben. Resultat: falsch! Wiederholungsuntersuchungen, ich glaube es waren 15 an der Zahl, immer wieder falsch! Letztlich war die Probe fast aufgebraucht und kein vernünftiges Ergebnis war zustande gekommen. Was war passiert? Bei der Probe handelte es sich um eine übereinander geschüttete schwarze Mischung, die ich vor der Analyse nicht homogenisiert hatte. Jede weitere Analyse musste also falsch werden. Möglicherweise hätte hier der Mittelwert aller falschen Analysen ein richtiges Ergebnis gebracht. Trotz des negativen Ergebnisses war das für mich eine wichtige Lehre. Man lernt eben auch aus Fehlern! Die anderen Bestimmungen, wie die komplexometrische Titration, haben mich wieder mit der analytischen Chemie versöhnt.
Organische Chemie war nicht Bestandteil des Studienplanes für Mineralogen. Ich habe die didaktisch gut aufgebaute Vorlesung bei Professor Günter Henseke (1917–1991) dennoch, zusammen mit Uli Recknagel, besucht. Diese Vorlesung war für mich ein großer Gewinn.
Von der physikalischen Chemie bei Professor Walter Mannchen (1905) ist nicht viel in Erinnerung geblieben. Auf dem Weg zum Institut hat er häufig Studenten in seinem Auto, einem P70, mitgenommen. Seine Prüfungen waren berühmt. Er fragte die Prüflinge in einem sehr ungezwungenen Gespräch nach ihrer Herkunft oder nach bestimmten Städten. Landete man zum Beispiel in Zittau, kam das Gespräch ganz sicher auf die dortige Blumenuhr und dann direkt auf die Osmose. Die Aussage: „nicht viel in Erinnerung geblieben“ ist nicht als fachliche Wertung zu verstehen. Die Vorlesung war solide, hat uns die notwendigen Grundlagen vermittelt, aber spektakuläre Versuche, wichtige Aussagen, eben der letzte Pfiff fehlten.
Vertiefende physikochemische Kenntnisse und insbesondere die Anwendung der Thermodynamik in den Geowissenschaften wurden uns im vorletzten Studienjahr 1968 durch Dr. Dieter Harzer (Jahrgang 1937), damals Mitarbeiter von Dr. Joachim Pilot (1928-2020) im Isotopenlabor in der Brennhausgasse 14, vermittelt.
Wenn ich aber heute auf diese Zeit zurückschaue, muss ich klar feststellen, dass die vermittelten Grundlagen als völlig unzureichend eingeschätzt werden müssen. Im Laufe der Jahre habe ich immer wieder feststellen müssen, dass die im Studium gelegte wissenschaftliche Basis sehr schwach war, wodurch ich oft bedauert habe, dass die erforderliche Tiefe nur schwer zu erreichen war und durch einen immensen Mehraufwand kompensiert werden musste. Der Grund dafür ist in dem generellen Ziel des Studiums zu sehen. Das Studium war nicht vordergründig für eine akademische Laufbahn (Hochschule, Forschungsinstitute) gedacht, sondern hat doch vor allem Praktiker ausgebildet. Zumindestens bei der Geologie war ein Hauptziel der Einsatz im Bergbau, aber auch bei den Behörden und Ämtern.
Mein Interesse an Chemie ebbte eigentlich nie ab. Beeindruckt und beeinflusst haben mich neben dem Trzebiatowski (Lehrbuch der anorganischen Chemie) die beiden Bücher von Linus Pauling „Grundlagen der Chemie“ und insbesondere „Die Natur der chemischen Bindung“, beide im Verlag Chemie in Weinheim 1964 erschienen. Diese beiden Bücher habe ich intensiv durchgearbeitet und habe dabei den eigentlichen Lernstoff etwas vernachlässigt. Ein anderes Buch hatte ich aus der Bibliothek oft ausgeliehen: Fritz Feigels „Quantitative Analyse mit Hilfe von Tüpfelreaktionen“. Auf dieses Buch bin ich bei meiner Chemie-Jahresarbeit in der ABF gestoßen und habe daraus viele Anregungen für die Mineral-Mikroanalyse erhalten, später (1980) habe ich z. B. den Nachweis von Bor in Flüssigkeitseinschlüssen in Mineralien vom Schneckenstein diesem Buch entlehnt.
Experimentalphysik hatten wir bei Professor Dr.-Ing. Rudolf Liebold (1903–1990). Diese Vorlesung hat erstaunlicherweise, außer einer schlechten Note, überhaupt keine Spuren hinterlassen. Nicht einmal eine Anekdote ist geblieben. Im physikalischen Praktikum wurden wir jeweils in Zweiergruppen betreut, zuletzt von Dr. Beckmann. Mein Partner war Uli Recknagel. Mit ihm habe ich viele Praktika gemeinsam absolviert. Beckmanns seltsame Einstellung zu uns Studenten ist in Erinnerung geblieben. Er sagte einmal: Die „Eins“ ist für mich, die „Zwei“ für die Assistenten und für euch bleibt die „Drei“, wenn ihr gut seid. Anfang 1967 hat er eine Professur an der Ingenieurschule in Zittau angenommen. Die armen Studenten dort!
Erwähnenswert ist noch die Röntgenstrukturanalyse im Studienjahr 1966/1967 bei Dr. Peter Klimanek (1935–2010). Klimanek war Physiker am Institut für Metallkunde und Materialprüfung an der Bergakademie. Er war an der Entwicklung und Anwendung von Methoden zur Beugung von Röntgenstrahlen an gestörten Kristallen interessiert. In den 70er-Jahren haben wir für ein Semester seine Vorlesung zur Feinstrukturanalyse zusammen mit Dr. Beyrich, Karl-Heiz Zeun und Hans Markus besucht. Die oft komplizierten mathematischen Gleichungen hat er stets aus dem Kopf an der Tafel entwickelt. Seine einzige Hilfe war ein kleiner, vielleicht 9 x 6 cm großer Zettel. Es kam vor, dass am Ende ein falsches Ergebnis an der Tafel stand. Darüber erschrak er und brach die Übung mit dem Hinweis ab, genau hier setzen wir in der nächsten Woche fort. Sein und mein Sohn Steffen besuchten gemeinsam die Körnerschule in Freiberg und waren lange befreundet.
Von den geologischen Fächern hat uns insbesondere die Vorlesung „Regionale Geologie“ bei Professor Adolf Watznauer (1907–1990) stark beeindruckt. Insbesondere vor der Prüfung in diesem lernintensiven Fach hatten wir Respekt. Die Prüfung fand in seinem Zimmer im Humboldt-Bau in gemütlicher Atmosphäre statt. Er kam in Filzlatschen ins Zimmer geschlurft. Als erstes fragte er uns, ob wir genau so doof sind wie die Vorgänger. Wider Erwarten haben alle in unserer Dreiergruppe eine „Eins“ erhalten.
Während des Studiums haben wir nichts von der neuen Theorie der Plattentektonik gehört. Auch Alfred Wegener wurde noch verlacht und bestenfalls als Kuriosum genannt. Die Gebirgsbildung wurde u. a. durch Isostasiestörung und Unterströmungstheorien erklärt. Begriffe wie Geosynklinalstadium, Tektogenese und Morphogenese standen im Mittelpunkt bei der Entstehung von Orogenen.
Am Ende des Studiums, es war wohl im Frühjahr 1969, wurden die Freiberger Geologen und Mineralogen im großen Hörsaal in der Brennhausgasse auf einen neuen Kurs der Regierung eingeschworen: Erkundung von Erdöl und Erdgas auf dem Territorium der DDR – eine Forderung der Sowjetunion. Alle Vortragenden waren euphorisch – nur Professor Adolf Watznauer wagte Widerspruch und meinte, auf dem geologisch und tektonisch stark gegliederten Terrain ist mit ergiebigen Lagerstätten prinzipiell nicht zu rechnen – er sollte Recht behalten. Natürlich wurden kleine Lagerstätten gefunden und auch ausgebeutet. Auch viele neue Erkenntnisse zur Geologie im Norden der DDR wurden gewonnen. Aber letztlich war das Unternehmen ein Milliardengrab und schwächte empfindlich die Wirtschaft der DDR. Es war wohl ein Ansinnen der damaligen Sowjetunion, einen möglichen und zu großen wirtschaftlichen Aufschwung auszubremsen. Man könnte auch fragen: Wo geht‘s denn hier zum Fortschritt? Antwort: Immer den Bach runter.
Mit der politisch erzwungenen Erkundung von Erdgas und Erdöl auf dem Territorium der DDR ergeben sich auch einige moralische Fragen mit gesellschaftlicher Relevanz. Haben nicht die Förderer und Nutznießer dieser Entwicklung erhebliche Schuld auf sich geladen? In den beiden Bänden der Schriftenreihe für Geowissenschaften unter dem Titel „Zur Geschichte der Geowissenschaften in der DDR“ ist davon nichts zu spüren. Natürlich wurden Arbeitsplätze geschaffen, neue Institute gegründet oder erweitert, Institutsdirektoren eingesetzt usw. usf., aber was unter dem Strich herauskam, war letztlich doch eine Belastung der Gesellschaft, die letztlich zum Untergang dieser Jasagenden Elite führte.
Das eigentliche Fachstudium war in der Regel sehr langweilig und trocken. Die Vorlesungen und Übungen zur magmatischen und metamorphen Petrologie waren ziemlich antiquiert. Nur die mikroskopischen Übungen, einschließlich der U-Tisch-Methoden, machten hier eine Ausnahme. Die gelehrte, etwas „hinterwäldlerische“ Petrologie ist auch im 1981 im Akademie-Verlag erschienenen Lehrbuch „Einführung in die Petrologie“ von Pfeiffer, Kurze und Mathé manifestiert. Nach dem Erscheinen nannten wir dieses Lehrbuch: Pfeiffers kurze Mathe-Einführung in die Petrologie. Mathematische Methoden der Petrologie fehlen aber vollständig.
In keiner Phase des Studiums wurde von Seiten des Lehrkörpers versucht, die Mineralogie ins rechte Licht zu setzen oder gar die schönen Seiten zu beleuchten. Dazu kam auch noch politisch motiviertes Drangsalieren seitens einiger Assistenten. Unser Betreuungs-Assistent Günter Lasch, später (1977–1991) im Institut für mineralische Rohstoff- und Lagerstättenwirtschaft (IfR) in Dresden tätig, hatte kaum einen positiven Einfluss auf unsere Seminargruppe. Auch die Studenten des jeweiligen dritten Studienjahrs – sie waren immer für die Neueinsteiger zuständig – haben nur blasse Erinnerungen hinterlassen. Es gab kaum Rückkopplung. Sprecher war Bernd Adamski. Ihm habe ich frühzeitig das folgende Dissertationsthema angedichtet: „Die Geochemie des menschlichen Kot-Stickstoffes und seine Migration“. In seiner späteren Dissertation hat er sich tatsächlich mit der Geochemie des Stickstoffes befasst.
Irgendwann im zeitigen Frühjahr 1966 musste jeder von uns auf Anordnung von Dr. Bernd Voland seine eigene persönliche Beurteilung schreiben. Diese wurde dann im Mikroskop-Übungszimmer von jedem selbst vorgelesen. Von eigener Lobhudelei, über recht realistische bis zu selbstzerstörerischen Einschätzungen war alles dabei. Und diese oft fraglichen Selbsteinschätzungen wurden offensichtlich unverändert in die Personalakten übernommen. Das brachte mich ganz nahe an eine Exmatrikulation, die vom FDJ-Gruppensekretär Eberhard Klöden, einem Kommilitonen vom Typus „Polit-Streber“, beantragt wurde, da ich am Ende meiner Selbstbeurteilung handschriftlich schnell noch den Satz „ich bin ein unzuverlässiges Element“, in Analogie zu Handlungen während der Kulturrevolution in China, hingeschrieben hatte. Wegen dem Antrag auf Exmatrikulation durch Eberhard Klöden hatte ich mich an der Ingenieurschule für Stahlgewinnung in Henningsdorf beworben. Professor Baumann und Dr. Leeder haben diesen Schritt und Schlimmeres verhindert. Nach dieser Aktion war für mich Eberhard Klöden einfach Luft. Ihn gab es nicht! Notwendige Informationen gingen nur noch über Dritte. Alle, auch der Lehrkörper, haben hier „mitgespielt.“ Auf den Tag genau nach einem Jahr habe ich das Schweigen per Handschlag beendet.
Professor Rösler war damals durch die Herausgabe verschiedener Bücher, wie dem „Betechtin“ (1964) und dem „Bulach“ (1969) sowie den Arbeiten an seinem „Lehrbuch der Mineralogie“ stark beansprucht. Die Vorlesung „Spezielle Mineralogie“ hat er einfach vergessen und es erst am Ende des Semesters, während der Prüfung zum Fach, gemerkt, obwohl wir mehrmals nachgefragt hatten. Ich hatte in Mineralogie, zusammen mit Ulrich Recknagel, eine Meldearbeit zu einem Normalprofil zu schreiben. Nach Abgabe dieser Gemeinschaftsarbeit wurden wir zu Professor Rösler zitiert. Das versprach nichts Gutes. Nach wenigen Minuten waren wir mit Hut nur noch paar Zentimeter groß. Dann kam die überraschende Frage: Wer hat denn diese Arbeit betreut? Ganz kleinlaut antworteten wir: Sie Herr Professor. Wir erhielten eine „Eins“.
Seine Vorlesung zur speziellen Mineralogie, sie fand immer am Montag am frühen Morgen statt, haben wir anfänglich alle ziemlich oft geschwänzt. Irgendwann, recht spät, ist das auch Prof. Rösler aufgefallen und er hat uns in sein Zimmer zitiert.
Prof. H. J. Rösler während der Harz-Exkursion 1969. Die von ihm geleitete Exkursion am Ende des Mineralogie-Studiums war ein unvergesslicher Höhepunkt.
Dort standen wir nach dem Alphabet geordnet in Reih und Glied. Jeder wurde nach seinen Beweggründen gefragt, weshalb die Vorlesung so oft geschwänzt wurde. Nicht abgesprochen kamen die unmöglichsten Antworten – niemand ist dabei ausgeschert: ich komme am Montag nie so zeitig aus dem Bett, die Vorlesung ist extrem langweilig usw. Er hörte sich das an und wir konnten ohne Gardinenpredigt sein Zimmer verlassen. Von da an fehlte kaum noch jemand in seiner Vorlesung. Generell kann man sein Verhalten gegenüber unserer Seminargruppe als sehr reserviert bezeichnen – das hielt bis zum Ende des Studiums an. Erst auf der Abschlussexkursion in den Harz hat sich seine Einstellung beim gemeinsamen Kirschenklauen und Fachdiskussionen sehr zum Positiven gewandelt. Das war aber leider zu spät!
Für unsere beachtliche Ignoranz hat er sich an uns mit seiner Frau zur Abschlussparty in seinem Garten noch mal richtig gerächt – beide haben uns allesamt ordentlich eingeseift. Auf dem Heimweg sind wir, meist volltrunken, alle neben dem Tor über den Zaun gestiegen – das Tor wurde als solches nicht erkannt. Uli Recknagel hat mich auf der Lomonossowstrasse 14 – ich war ziemlich angeschlagen – bei meiner damaligen Frau abgeliefert.
Positive Erlebnisse während des Studiums waren die Vorlesung „Spezielle Geochemie und Metallogenie“ durch den Gastdozenten Gerhard Tischendorf (1927–2007), die Mineralogie der Salze durch Dr. Vogel und Dr. Klaus Koch sowie die Übungen zur Mikroskopie gesteinsbildender Minerale, die Prof. Rösler oft selbst geleitet hatte – das waren dann richtige Höhepunkte. Den anderen Fachvorlesungen kann man kaum Positives nachsagen. Die allgemeine Mineralogie, auch von Prof. Rösler gelesen, war eine einzige Katastrophe. Der dazugehörigen „Klötzelkunde“ und dem Goniometerpraktikum bei Dr. Leeder haben wir keine besonders guten Seiten abgewinnen können. Schuld war eigentlich die Vorlesung, die Prof. Rösler, warum auch immer, ziemlich unvorbereitet abhielt. Manchmal hat er minutenlang und verzweifelt ein Kristallmodell unter den vielen, wahllos auf dem Hörsaaltisch vom Kalfaktor Seidel ausgebreiteten Exemplaren gesucht – wir haben oft lange Strichlisten seiner „äh’s“ geführt. Damals stand ich den vermittelten Methoden sehr skeptisch gegenüber, habe aber nach dem Studium, sicherlich als einziger der Seminargruppe, viele Jahre lang Zweikreisreflexionsgoniometer in der täglichen Arbeit genutzt und die erworbenen Kenntnisse waren dabei nützlich und sehr hilfreich. Auch selbst gebaute Kristallmodelle, insbesondere des kubischen Systems, wurden später ganz entscheidend für Diskussionen zur Orientierung der Verbindungshalbleiter oder der Silizium-Einkristalle, die in der Regel nach den [111] und [100] Richtungen gezüchtet wurden. Die Physiker, die in den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen im VEB Spurenmetalle dominierten, hatten von kristallografischen Grundlagen absolut keine Ahnung. Sicherlich waren während des Physikstudiums Vorlesungen und Übungen zu dieser Thematik obligatorisch – aber hängen geblieben war meistens nichts.
Auch das exakte Anbringen einer Hilfsphase an den Kristallstäben war von großer ökonomischer Bedeutung, da das Vereinzeln der fertigen Bauelemente im starken Maße von der Desorientierung, hier der Abweichung von der kristallografischen Spaltrichtung, beeinflusst wurde. Selbst die Standzeit der Diamant-Ritzwerkzeuge wurde von dieser Abweichung erheblich beeinflusst.
Sehr positiv kann man die vielen Tages- und Mehrtagesexkursionen ins Erzgebirge, nach Thüringen, der Oberlausitz und dem Harz bewerten. Bei Mehrtagesexkursionen teilte ich meist ein Zimmer mit Uli Recknagel. Einen nachhaltigen Eindruck hat auf mich die Granitexkursion in das Westerzgebirge unter der Leitung von Dr. Gerhard Herrmann – auch „Granit-Herrmann“ – von der SDAG Wismut ausgeübt. Die von ihm vorgeführten, zum Teil recht bescheidenen Aufschlüsse überzeugten mich nicht besonders. Schon damals regte sich in mir ein gewisser Widerstand gegen die Gliederung der Granite des Erzgebirges, die ziemlich schematisch von den Russen übernommen wurde. Die sehr schönen Arbeiten von Ernst Otto Teuscher (1907–1990) ignorierte man aus politischen Gründen; sie spielten während des Studiums keine Rolle. Aber irgendwie bin ich doch auf diese Arbeiten in der Zweigstelle der Bibliothek im Wernerbau gestoßen. Daraus entwickelte sich eine gesunde Skepsis, die ich bis heute bewahrt habe. E.O. Teuscher promovierte im Januar 1936 mit der Gesamtnote „sehr gut“ zum Dr. phil. am Institut für Mineralogie und Petrographie der Universität Leipzig. Nach kurzen Tätigkeiten in Freiberg und Berlin landete er 1943 auf eigenen Wunsch in Bayern und vertrat nach dem Krieg in der Lesart des ZGI die Geologie des Klassenfeindes, zumal er dort bis zu seinem Ausscheiden in den Ruhestand hohe Ämter bekleidete, so z. B. als Oberregierungsdirektor im Bayerischen Geologischen Landesamt diente. Es ist interessant, dass diese Einstellung auch in die Nachwendezeit übernommen wurde. Man findet im Beitrag zur Geschichte der Magmatitpetrologie in der DDR, die ja auch die Vorkriegswurzeln der Universitäten und Akademien beleuchtet, keine Hinweise auf Teuscher. Er war ein fleißiger Arbeiter und hat bereits 1933 die Zweiteilung der Granite des Erzgebirges abgelehnt. Seine Arbeiten zu den westerzgebirgischen Graniten sind noch heute wegweisend.
Bis etwa Mitte des Studiums war ich eifriger Mineraliensammler. Ich habe sehr viel international getauscht – oft Minerale gegen Fachbücher. Tauschpartner waren beispielsweise David New aus Scottsdale, Arizona, Pio Mariani aus Milano, Dr. Hans Joachim Meyer-Marsilius aus Hogen in der Schweiz, Emil Raab aus Führt, Egbert Potratz aus Villingen und Erwin Moser aus Fischbach/Nahe. Bis April 1961 habe ich auch die Zeitschrift „Der Aufschluß“ bezogen. Im Heft 5 des Jahrganges 1961 wurde in einer Bildunterschrift auf Seite 131 die Gebietsangabe „Sudetengau“ verwendet. Das war dem Deutschen Kulturbund, Abteilung Natur- und Heimatfreunde, Anlass, den Bezug dieser Zeitschrift für DDR-Bürger zu unterbinden.
Ein wichtiger Tauschpartner war damals David New aus Scottsdale in Arizona. Die Adresse fand ich in einem Heft des American Mineralogist. In dieser Zeit habe ich Uranminerale gesammelt. Ich hatte damals viele Belegexemplare aus dem Kunkelbachtal bei Menzenschwand im Schwarzwald und von Colorado. Ein großer Teil stammte von Egbert Potratz aus Villingen und Emil Raab aus Fürth. Ich hatte eine sehr große Sammlung solcher Minerale, die ich meist durch Tausch gegen Stufen von Königshain erworben hatte. Meine Sammelleidenschaft nahm ein jähes Ende, als ich ein Tauschgeschäft für einen sehr betagten Sammler aus Altenburg mit der Mineralogischen Sammlung der Bergakademie und dem Naturkundemuseum in Freiberg (damals von Herrn Braun geleitet) vermittelt hatte. Es waren darunter sehr schöne Stufen, die der Sammler gegen Silberminerale aus dem Erzgebirge tauschen wollte. Es kam zu dem Tausch. Der Sammler war aber mit dem Ergebnis absolut nicht einverstanden und wollte die Aktion rückgängig machen. Beide Stellen haben sich aber mit Händen und Füßen gesträubt. Ich war der Leidtragende und habe das „Minus“ mit meinen schönsten Stufen kompensiert. Das war bitter und zugleich auch das Ende meiner Sammelleidenschaft. Eine Gesteinssammlung und die Uranminerale hatte ich noch bis zum Reaktorunfall in Tschernobyl am 26. April 1986. Erst damals wurde mir richtig klar, auf was für einem gesundheitlichen Pulverfass ich eigentlich saß. Ich habe dann vieles vertauscht und entsorgt.
Einen Teil meiner petrografischen Gesteinssammlung mit vielen Belegstücken aus den Schweizer Alpen stammte von Dr. Hans Joachim Meyer-Marsilius aus Horgen in der Schweiz. Einen Teil der Gesteinssammlung habe ich nach der Wende für den Aufbau einer Übungssammlung für die Universität Potsdam in Golm „gespendet“. Jetzt habe ich nur noch ein paar Reste. Gesammelt habe ich praktisch nicht mehr. Nur gelegentlich fanden oder finden einige Erinnerungsstücke ihren Platz im Schrank.
In die gleiche Zeit fiel auch ein „DDR-interner“ Beschluss, dass privates Sammlungsmaterial, welches zum Tausch über die Grenze gehen sollte, von den Zollbehörden ohne Mitteilung einfach zu beschlagnahmen ist. Dieser Aktion sind einige meiner gewichtigen Postsendungen, zum Teil mit sehr schönen Pegmatitstufen von Hilbersdorf in den Königshainer Bergen, zum Opfer gefallen. Wie mir später mitgeteilt wurde, ging diese Aktion von Freiberger Mineralogen aus, die Prof. Rösler beim Zoll untergebracht hatte. Das war überhaupt so eine Macke von ihm, er wollte überall Mineralogen unterbringen – aber selbst durften wir uns nicht um eine Stelle kümmern oder bemühen. In gewisser Weise waren wir somit „Leibeigene“ des Institutsdirektors. Es war natürlich keine persönliche „Macke“ von ihm, sondern eine Vorgabe im Rahmen der Dritten Hochschulreform 1968, deren Auswirkungen auf den Studienbetrieb erst richtig nach unserem Diplomabschluss zum Tragen kamen (siehe Anke Geier, 2011). Jedoch spürten wir als Studenten von Anfang an den Druck, der seitens der SED-Kader auf das Leben an der Hochschule ausging. Der erste Forschungsstudent aus unseren Reihen war Eberhard Klöden. Nach der III. Hochschulreform sollten wissenschaftlich begabte Studenten am Diplom vorbei innerhalb von drei Jahren zur Promotion geführt werden (siehe Lambrecht, 2007). Eberhard war sicherlich nicht besonders begabt, er gehörte zur Kategorie „Streber“ und erfüllte durch seine Ansichten die politisch-ideologischen Kriterien der Partei. Sein Weg war bis zur politischen Wende eng verbunden mit der Kariere als Parteisekretär, zuerst im VEB Präzisionsmechnik Freiberg, dann im Bergbau- und Hüttenkombinat „Albert Funk“ in Freiberg und zum Abschluss als Kreisparteisekretär in Freiberg.
Eine wichtige Lehre in mehrfacher Hinsicht war das Ingenieurpraktikum 1968, das mich mit Ulrich Recknagel und Friedrich Naumann zur SDAG Wismut nach Grüna bei Karl-Marx-Stadt führte. Ursprünglich sollte ich dort mit Uli zusammen eine petrografische Thematik bearbeiten (Verteilungsparameter der Gehalte von chemischen Elementen im Porphyrkomplex von Halle), auf die wir uns schon gefreut hatten. Aber die zuständigen Betreuer bei der Wismut haben alles geändert. Unter der Leitung von zwei Russen – Belinsky und Schischkin – musste ich eine recht uninteressante Kartierungsarbeit mit geochemischem Ausblick nördlich von Görlitz durchführen. Vor der eigentlichen Arbeit an der geänderten Thematik war ich wochenlang mit den Russen im Gelände. Wir haben mit dem Gammaspektrometer alle wichtigen Lamprophyrgänge in der Oberlausitz „abgearbeitet“. Dabei wurde die Strahlung von Uran, Thorium und Kalium vermessen. Bei den Besuchen von Steinbrüchen oder beim Kontakt mit der Bevölkerung musste ich immer erzählen, dass wir nach Gold suchen – was uns selbstverständlich niemand abnahm. Das war mir eigentlich sehr peinlich. Der Umgang mit den beiden Russen war für mich ein weiterer „Kulturschock“. Wenn beide gleichzeitig mit im Gelände waren, habe sie sich wie Feinde belauert, sind nicht aus sich herausgegangen, eine Unterhaltung war praktisch nicht möglich. In Groß Särchen stand eine Gaststätte unter Vertrag mit der Wismut AG. Wenn beide anwesend waren, gingen sie um 17 Uhr zu Bett. Mit Schischkin allein sah es ganz anders aus. Wir haben diskutiert und ich war auch Berater für seine Einkäufe, da sich seine Frau zu Besuch angemeldet hatte. Vor ihr hatte er großen Respekt. Damals war ich in Russisch ganz gut. Durch das Ingenieurpraktikum musste ich den von mir belegten Russisch-Intensivkurs vorzeitig beenden. Macht nichts, dachte ich mir, kann ich bei der Wismut AG viel besser praktizieren. Das war eine komplette Fehleinschätzung. Die beiden Russen wollten nicht! Es kam kaum zu fachlichen oder privaten Gesprächen.
Beinahe wäre es auch zur Katastrophe gekommen. Beim recht langweiligen Vermessen der Lamprophyrgänge mit der Gammasonde in der Nähe von Oppach wollte ich Belinsky mal richtig hochnehmen. Intuitiv habe ich das aber mit dem Geologen Schischkin abgesprochen. Bei der Aufnahme mit dem Zählrohr haben wir immer 40 cm tiefe Löcher gegraben und dann erst gemessen. In so einem Loch habe ich geschickt ein größeres Stück Pechblende mit Torbernit aus dem Kunkelbachtal bei Menzenschwand/Südschwarzwald versteckt und Belinsky messen lassen. Die Gammasonde spielte verrückt und auch Herr Belinsky. Wenn ich nicht die Sache mit Schischkin abgesprochen hätte, wäre es das Ende gewesen. So einen Wutausbruch hatte ich noch nie erlebt – Rumpelstilzchen ist nichts dagegen.
Während der ganzen Geländearbeiten haben wir in der Oberlausitz viele kleine, meist in den Wäldern versteckte Kommandotrupps der Roten Armee beobachtet. Den ersten umgestürzten Panzer habe ich dann kurz vor dem 21. August 1968 bei Groß Särchen an der Fernverkehrsstraße 96 gesehen. Mit den Ereignissen um den Prager Frühling wurde auch das Ingenieurpraktikum vorzeitig beendet. In der Geologie-Abteilung in Grüna wurde mobil gemacht. Alle Russen waren plötzlich bewaffnet. Auch Panzerspähwagen standen in Bereitschaft.
Es gab aber auch Lichtblicke. In Karl-Marx-Stadt/Grüna lernte ich Dr. Popov aus Leningrad kennen. Er sprach ein akzentfreies Deutsch, das er sich autodidaktisch beigebracht hatte. Er verwendete dazu kleine Zettel mit Sätzen aus deutschen Märchen in beiden Sprachen. Diese Zettel führte er ständig bei sich, um jede Gelegenheit nutzen zu können, komplette Sätze zu lernen. Bei unseren täglichen Mittags-Spaziergängen führte er mich in die Welt der Flüssigkeitseinschlüsse ein. Uli Recknagel hatte durch Geschick die Diplom-Themen frühzeitig über Fräulein Neubert (Neuberin), der Sekretärin von Professor Rösler (kurz Profi), in Erfahrung gebracht. Ich hatte mich mit Flüssigkeitseinschlüssen in Fluoriten auseinanderzusetzen und Uli mit der Zinnführung der Altenberger Erze. Diese knappe, aber leidenschaftlich vorgetragene Einführung in die Welt der Einschlüsse war für mich der Startpunkt einer über 50 Jahre währenden Beschäftigung mit dieser Mikrowelt.
Dass so ein Einschluss-Thema ausgegeben wurde, ist auf das II. Symposium der „International Association on the Genesis of Ore Deposits“ (IAGOD) in St. Andrews, Schottland zurückzuführen, an dem Prof. Ludwig Baumann und Gerhard Tischendorf teilnahmen. Auf dieser Tagung wurden mehrere Beiträge mit Einschlussthemen vorgetragen und es wurde in dem Bericht von Baumann und Tischendorf (Z. für angewandte Geologie, Bd. 14, Heft 3, 1968) mitgeteilt, dass unter der Leitung von Prof. N.P. Yermakov und Dr. Edwin Woods Roedder (1919–2006) seit 1964 eine „Commission on Ore-Forming Fluids in Inclusions“ aktiv arbeitet. Eine erste Zusammenfassung des Standes und der inhärenten Möglichkeiten der Einschlussmethode zur Entschlüsselung der Beschaffenheit mineralbildender Lösungen wurde 1968 von Dr. Herbert Reh aus Jena verfasst. In der gleichen Zeitschrift erschien 1969 ein Beitrag von Naumov und Mironova zum Verhalten der Kohlensäure in hydrothermalen Lösungen bei der Bildung der Quarz-Nasturan-Kalzit-Gänge des Erzgebirges (Nasturan = Uraninit).
Trotz der mündlichen Einführung in diese Methode war aller Anfang schwer. Niemand wusste, wie die Proben präpariert werden mussten und wie die Einschlüsse unter dem Mikroskop tatsächlich aussehen. Publizierte Strichzeichnungen halfen hier wenig. Im Jahr 1961 hatte Fräulein G. Scheumann (später Frau Mund) die überhaupt erste Einschlussarbeit an der Bergakademie – eine unveröffentlichte Meldearbeit – mit dem Thema „Libellenschließtemperaturen von Baryten“ verfasst. Die darin beschriebene Präparation der Schliffe für die thermometrischen Messungen unter Verwendung von Gips ist mehr als abenteuerlich.
Auch ich brauchte ein paar Tage, um die kleinen Dinger überhaupt zu erkennen. Wie ich aus vielen späteren Gesprächen erfuhr, ist das den meisten Studenten in Ost und West so gegangen. Aber wenn man dann eines Tages einen Einschluss als solchen erkannt hatte, war man von der Brownschen Bewegung der kleinen Dampfblasen fasziniert und in ihren Bann gezogen. In der Anfangsphase fertigte ich viele Dickschliffe von den verschiedensten Mineralisationen an und bekam dadurch einen ersten Überblick über die Mannigfaltigkeit der Einschlusstypen aus erster Hand. Besonders eindrucksvoll waren die CO2-reichen Einschlüsse im Kryolith von Ivigtut in West-Grönland. Wie von Geisterhand dirigiert bewegten sich die kleinen CO2-Dampf-Bläschen stetig nach einer unbekannten Melodie im flüssigen CO2 und diese gemeinsam wiederum in der wässrigen Hauptphase. Was war das für ein Bild, wenn in einer Wachstumsebene des Kristalls, gefüllt mit zahllosen Einschlüssen, diese Bewegung ins Auge sprang! Auch die an Tochtermineralen reichen Einschlüsse im Pyknit von Altenberg (selbst im Juli 1957 gesammelt) haben „visuelle“ Spuren hinterlassen. Apropos visuelle Spuren: In den Pioniertagen der Einschlussforschung stand die Mikrofotografie noch in den Kinderschuhen. Einschlussfotos für die Diplomarbeit und auch für die spätere erste Veröffentlichung wurden in der Bildstelle der Bergakademie gemeinsam mit Herrn Braun aufgenommen. An eine generelle fotografische Ausrüstung der Mikroskope war noch lange nicht zu denken.
Meine Beobachtungen am Pyknit wurden von Uli Recknagel in seiner Diplomarbeit „Die Zinnführung der Altenberger Erze in mineralogischer und petrografischer Hinsicht“ verwendet und kurz diskutiert. Eine erste große Enttäuschung blieb nicht aus. Ich untersuchte so nebenbei u. a. auch Quarz aus dem grafischen Granit von Königshain. Dabei fand ich nur Flüssigkeitseinschlüsse mit Homogenisierungstemperaturen wenig über 100° C7. Mein von Fersmann geprägtes Weltbild über die Pegmatitgenese drohte einzustürzen. Die Arbeit von Jürgen Schädel (1962) brachte mich kurz, aber nicht nachhaltig, den Ideen von Drescher-Kaden (1894–1988) näher. Wenn man darüber nachdenkt, kommt man schon ins Grübeln. An was für dünnen Fäden am Ende eines fünfjährigen Studiums doch die damaligen Überzeugungen so hingen!
7 Nach Fersmann (1931) ist für den Beginn der Pegmatit-Bildung eine Temperatur von 700° C anzusetzen.