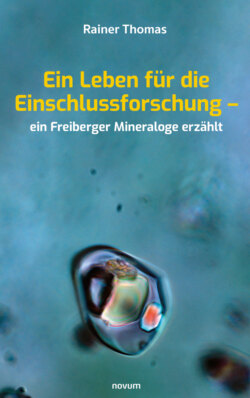Читать книгу Ein Leben für die Einschlussforschung – ein Freiberger Mineraloge erzählt - Rainer Thomas - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDer Anfang in Sachen Geologie
Es war ein herrlicher Morgen im späten Frühjahr des Jahres 1952, als unsere kindliche Neugierde uns in eine nahe gelegene Sandgrube an der Kastanienallee führte. Der schräge Lichteinfall überhöhte die kaum wahrnehmbare Schichtung des Sandes an einer nahezu senkrechten Wand. Nur wenige größere, meist abgerundete Steine unterbrachen das regelmäßige Bild. Einen dieser Steine pulte ich heraus: es war ein braun gefärbter Feuerstein mit zwei nicht übersehbaren markanten Abdrücken, die unsere Fantasie in Bewegung setzten.
Stein des Anstoßes: Im späten Frühjahr 1952 fand ich beim Spielen in der kleinen Sandgrube an der Kastanienallee in Oppach (in der Nähe des ehemaligen Rittergutes) diesen kleinen braun-gefärbten Feuerstein mit einem Abdruck eines Seelilienstielgliedes (Basislänge: 5 cm). Das war der Anfang einer lebenslangen Beschäftigung.
Unser kleines Rätsel wurde schnell gelöst. In unserer Nachbarschaft, in der Zumpestraße wohnte ein älterer „Steinesammler“ – Christian Adler. In dem kleinen, innen düsteren Haus hatte er auf der Sonnenseite einen hellen Raum mit Schränken voller Mineralen, Versteinerungen und botanischen Schaukästen. Alles hatte er selbst gesammelt und liebevoll zusammengestellt. In dieser Welt fand er seine innere Ruhe. Sein Handicap – er war Epileptiker – war in diesem Raum wie weggeblasen. Wenn er von seinen Steinen erzählen konnte und wissbegierige Zuhörer vor sich hatte, glänzten seine Augen und sein Feuer übertrug sich auf uns Kinder. Bei vielen aus meiner Klasse war es sicherlich nur ein Strohfeuer, das aber bis zum Ende der Grundschulzeit unterhalten wurde. Zu nennen sind hier Walter Fiebig, nach dem Studium Lehrer für Olympia-Kader in Leipzig, Hartmut Michold, später Facharzt für Innere Medizin in Rostock, beide aus der gleichen Grundschulklasse, Rolf Herberg, eine Klasse über uns und der etwas jüngere, Hans-Jürgen Seifert, später Chemie-Lehrer. Für Rolf Herberg ist das Sammeln von Mineralen und Gesteinen lebenslang Freizeitbeschäftigung geblieben.
Der Längs- und Querabdruck eines Seelilienstängels im Feuerstein, eigentlich ein recht unbedeutendes paläontologisches Zeugnis, war für mich jedoch der Initialpunkt einer lebenslangen Beschäftigung mit der Mineralogie, die durch die Faszination wohlgeformter Kristalle der Sammlung von Christian Adler geweckt wurde. Nach dessen Tode während meiner Lehrzeit ist diese Sammlung in alle Winde verstreut worden. Ohne Besitzer war sie praktisch wertlos, da die Herkunft der meisten Stücke nur in seinem Kopf gespeichert war. Es gab fast keine Etiketten. Durch die vielen Besuche bei ihm kannte ich wahrscheinlich als einziger diese Geschichten und die Zuordnung der einzelnen Stücke. Durch die Lehrzeit in Zwickau hatte ich auf die Erhaltung dieser Sammlung keinen Einfluss. Viel später hat Michael Leh, ein engagierter Hobby-Mineraloge und an der Geschichte der Oberlausitz interessierter Laie aus Neschwitz versucht, die Spur wieder aufzunehmen – aber bisher ohne Erfolg.
Am Anfang, zum Leidwesen meiner Mutter, wurde alles gesammelt: Gesteine, Minerale und Versteinerungen, auch Briefmarken, Käfer, Schmetterlinge und Pflanzen. Der Umfang dieser Sammlungen überstieg bald die Toleranzgrenze meiner Eltern. In der kleinen Wohnung in der ehemaligen Siemens-Siedlung, auch SOS-Siedlung (Süd-Ost-Siedlung) genannt, war nicht genug Platz. Der größte Teil der ersten Steinsammlung landete hinterm Haus in einer Baugrube. Ich war einsichtig, beschränkte mich auf Minerale und einige wenige Petrefakten. Auch ein gewisses Interesse an Botanik blieb. Dieses Interesse wurde durch die schönen Blattabdrücke im tertiären Polierschiefer von Seifhennersdorf in Christian Adlers Sammlung genährt. Ein paar Jahre später, ich war wohl 15, besuchte ich das bereits stillgelegte Polierschieferwerk und fand dort sehr schöne Pflanzenreste, die nun leider verschollen sind. Unter dem Mikroskop konnte man zum Teil noch recht gut die Zellstrukturen erkennen.
Große Basaltsäulen fanden von nun an nicht mehr den Weg in die elterliche Wohnung. Mit dem drastischen Schritt der „Verjüngung“ folgte allmählich das mehr systematische Sammeln. Erste Bücher wurden gelesen. In den Erinnerungen haben die beiden Bücher von Fersmann „Verständliche Mineralogie“ und „Unterhaltsame Geochemie“ eine größere Rolle gespielt. Auch „Meine Reisen“ und „Erinnerungen an Steine“ vom gleichen Autor wurden mehrmals gelesen. Viel später kam noch dessen Buch „Reisen zu den Steinen“ hinzu.
Mit 12 Jahren hatte mich mein Vater einmal in die damalige Oberschule in Neusalza-Spremberg mitgenommen. Er war dort Chemielehrer und wollte eine Unterrichtsstunde vorbereiten. Nebenbei hatte er mir kleine, sehr einprägsame Experimente vorgeführt, z. B. die Entzündung eines mit Terpentin getränkten Wattebausches mit konzentrierter Salpetersäure. Ich war begeistert. Chemie wurde von nun an mein neues Steckenpferd – natürlich neben der Mineralogie. Nach einigen sehr improvisierten Experimenten bekam ich zu Weihnachten 1954 dann von meinen Eltern den Chemie-Baukasten „Kleiner Experimentator“ vom VEB Laborchemie Apolda, der mein Interesse an Chemie nachhaltig beeinflusste. Alle 135 im kleinen Handbuch aufgeführten Experimente wurden in kurzer Zeit ausgeführt. In dieser Phase war auch das Buch Nr. 41 aus der Volksbücherei Oppach ein wichtiger Wegweiser. Dieses Buch hatte ich praktisch in Dauerleihe. Fast jeden beschriebenen Versuch habe ich damals nachgemacht. Den Titel habe ich vergessen – es war eben das Buch Nr. 41. Erst 50 Jahre später ist es mir nach langem Suchen gelungen, dieses Buch über das Zentralantiquariat Leipzig wieder aufzutreiben. Es ist das „Chemische Experimentierbuch“ von O. Nothdurft aus dem Jahr 1913. Von dieser Zeit an wurde praktisch das wenige Taschengeld für den Kauf von Chemikalien und Gerätschaften gespart.
Das „Chemische Experimentierbuch“ von Dr. O. Nothdurft aus dem Jahr 1913 inspirierte mich nachhaltig. Es legte den Grundstein für eine lebenslange Freude an den unterschiedlichsten Labortätigkeiten. Das eigene chemische Labor in der elterlichen Wohnung (1954–1969), das Einschluss-Labor in der ehelichen Wohnung (1970–1992), der Aufbau und Betrieb eines Röntgenfeinstruktur-Labors im VEB Spurenmetalle Freiberg (1972–1988), der Aufbau eines Einschluss-Labors im Zentralinstitut für Physik der Erde (1988–1992), der Aufbau und Betrieb eines Raman-spektroskopischen Labors im GeoForschungsZentrum Potsdam (1993–2007) bis hin zum eigenen Raman-Labor (ab 2020) sind wichtige Etappen meiner Tätigkeit.
Ein „Kipp“ (Kipp’scher Gasentwickler zur Herstellung von Wasserstoff und anderen Gasen) von damals steht noch heute in meinem Arbeitszimmer.
Wenn ich auf diese Zeit zurückschaue, wurde mein Interesse an der Chemie hauptsächlich durch die große Bibliothek meines Vaters, die hauptsächlich pädagogische Arbeiten und Lehrbücher zur Chemie enthielt, gesteuert. Praktisch alle Chemiebücher fixierten den erreichten Stand, suggerierten praktisch, dass alles eigentlich bekannt ist und zeigten nur sehr eingeschränkt, wonach zu forschen ist. In dieser Zeit entwickelte ich einen gewissen Neid gegenüber erfolgreichen Chemikern (Hermann Römpp, 1901–1964, Ida Noddack, 1896–1978 und Walter Noddack, 1893–1960) und bedauerte manchmal, dass ich bei deren Entdeckungen, zum Beispiel des Rheniums, nicht dabei sein konnte. Die Zukunft konnte eigentlich nichts Interessantes mehr bringen. Alle Elemente waren entdeckt. So war damals der Grundtenor.
Ganz am Anfang gab es auch kurze Ausflüge auf ein sehr gefährliches Terrain – die Herstellung von Schwarzpulver. Das Verbrennen einer größeren Menge im elterlichen Küchenherd und deren Wirkung hat mich vor weiteren Experimenten dieser Art bewahrt. Nur noch einmal kam ich auf solche Experimente zurück, als ich eine größere Menge Pikrinsäure erhielt – ich war aber sehr vorsichtig und arbeitete nur mit kleinsten Mengen, z. B. mit dem hochempfindlichen Bleipikrat.
Über die Gefährlichkeit solcher Experimente wurde ich durch meinen Vater vorgewarnt. In seiner Jugend hatte er einmal Nitroglyzerin hergestellt, die Flasche an einen Apfelbaum im elterlichen Garten gehängt und mit dem Luftgewehr heruntergeschossen. Dabei barsten alle Scheiben an der Hinterfront des Hauses.
Höhepunkt im kindlichen Streben nach mineralogischen Entdeckungen war im September 1955 der Fund einer großen Pegmatitschliere mit viel schwarzem Turmalin in einem kleinen, aufgelassenen und verwachsenen Steinbruch auf Hebolds Kuppe zwischen Oppach und Neusalza-Spremberg zusammen mit den Klassenkameraden Hartmut Michold und Jochen Domschke. In diese Zeit fällt auch die einzige Begegnung mit Willi Hennig auf einer Waldlichtung in der Nähe des Turmalinschurfes. Er erzählte uns (wahrscheinlich zusammen mit Walter Fiebig) begeistert über seine biologische Arbeit. Seine Art war extrem freundlich, wohlwollend, einfühlsam und auch irgendwie ansteckend. Die kurze Begegnung ist in mir tief verankert als sonniges Plätzchen in der Erinnerung geblieben.
Ende Mai 1957 fand ich beim Baden in einem kleinen abgesoffenen Steinbruch unweit von unserem Turmalinschurf einen steil stehenden, ostwest-streichenden Aplit-Gang im Granodiorit. In drusenartigen Hohlräumen dieses Aplits befanden sich großblättrige Eisenglanzkristalle und einige nahezu farblose kleine Quarzkristall-Doppelender, sogenannte Schwimmer. In diese Zeit fallen auch die ersten zaghaften analytischen Untersuchungen: Bestimmung von Eisen mittels der Berliner Blau- und der Rhodanid-Reaktion, sowie der Nachweis von Nickel im Pentlandit von Sohland an der Spree als feuerrotes Nickeldimethylglyoxim. Dieses Wort hat sich bis heute fest eingeprägt. Lange Zeit konnte ich auch die Strukturformel dieser Komplexverbindung aus dem Schlaf aufzeichnen. Auch das schon länger praktizierte Mikroskopieren wurde vom botanischen auf das anorganische Reich ausgedehnt. Die ersten Präparate waren dünne Spaltstücke von Eisenglanz (Hämatit), die unter dem kleinen Kosmos-Mikroskop durch ihre blutrote Farbe und die orientiert angeordneten feinen nadelförmigen Ausscheidungen faszinierten.
Im Sommer 1956 lernte ich in einem Ferienlager in Stalinstadt, dem jetzigen Eisenhüttenstadt, Rolf Reinicke aus Lauba kennen. Er war auch ein begeisterter Sammler von Mineralen und Fossilien. Bis zum Ende der Grundschulzeit haben wir uns dann häufig getroffen. Sein Interesse galt hauptsächlich den Fossilien. Nicht weit von seinem Elternhaus gab es eine Sandgrube mit reichlich vorkommenden Silur-Geschieben aus dem Raum um Gotland mit einem beachtlichen Fossilinhalt. Er hatte aber auch ein paar schöne Beryll- und Topaskristalle unbekannter Herkunft und einige Rauchquarzstufen aus den Königshainer Bergen. In der Nähe des alten Sportplatzes hinter der ehemaligen Gaststätte „Hamburger Hof“ in Lauba verläuft ein Quarzgang mit zum Teil schönen großen Kristallen, die auch in viele Hausgärten des Ortes gelangten. Im Sommer 1957 oder 1958 haben wir am Rande des Sportplatzes eine große Platte mit vielen Quarzkristallen geborgen. Sie war sehr groß und nicht für die eigene Sammlung geeignet. Rolf Reinicke hat diese Platte dem Heimatmuseum in Löbau geschenkt. Sie liegt noch heute dort, etwas unglücklich, im Treppenbereich.
Unsere Wege trennten sich am Ende der Schulzeit. Nach dem Abitur studierte er Geologie in Greifswald und war später 28 Jahre als Wissenschaftler im Stralsunder Meeresmuseum tätig und beschäftigte sich über 40 Jahre mit Bernstein, organisierte viele Bernstein-Ausstellungen, ist Landschaftsfotograf und Autor zahlreicher Bild-Text-Bände über Bernstein und die Ostseeküste.
Einen nachhaltigen Eindruck für meine persönliche Entwicklung hinterließ Ende Juli 1957 ein Besuch der mineralogischen Sammlung in der Brennhausgasse in Freiberg mit Hans-Jürgen Seifert. Stunden verbrachten wir in der Sammlung – wir wurden sogar eingeschlossen. Erst am späten Nachmittag bemerkte man uns. Wir hatten das gar nicht realisiert. Die nächtliche Rückfahrt per Fahrrad mit schweren Rucksäcken, gefüllt mit Material von den Halden der Alten Elisabeth und vom David-Schacht, gestaltete sich mehr als abenteuerlich. Auch eine erste Pyknit-Probe habe ich von dieser Tour mitgebracht. Erst am frühen Morgen des nächsten Tages erreichten wir, völlig erschöpft, die elterlichen Wohnungen nach einer über 150 km langen Tour von der Jugendherberge in Geising über Altenberg, Rehefeld, entlang der Mulde mit einem Zwischenstopp in Freiberg, über Dresden und Bischofswerda. Fahrradfahren hatte ich gerade ein paar Monate vorher gelernt.
Mit dem Frühjahr 1957 begannen dann auch regelmäßige Radtouren in die Königshainer Berge zu den dortigen Pegmatiten. Der mineralogisch ergiebigste Steinbruch war damals der von Hilbersdorf. Schriftgranitische Verwachsungen und Stücke blaugrünen Amazonits mit kleinen, aufgesetzten, fast schwarzen Rauchquarzkristallen zogen mich in ihren Bann. Wie ist so etwas entstanden? Eine vorläufige Antwort gab uns Fersmann in seiner „Verständlichen Mineralogie“. Wir besuchten diesen Bruch und die Nachbarsteinbrüche bis 1958 mehrmals. Sogar am 31. Dezember 1957 waren wir, trotz schneeglatter Straße, mit dem Fahrrad dort. Von dieser Sammelfahrt habe ich eine große Pegmatitstufe mitgebracht. Diese steht nun, nach Umwegen über einen Sammler aus Karl-Marx-Stadt (jetzt wieder Chemnitz), in der Sammlung des geologischen Institutes in Freiberg im Humboldt-Bau, wo sie mindestens bis Ende des Studiums dort zu sehen war. Auf der Suche nach dem Namen des Sammlers aus Chemnitz im Jahre 2016 und 2017 musste ich feststellen, dass diese Stufe wahrscheinlich im Fundus untergetaucht ist.
Durch meine einseitige Fixierung auf die naturwissenschaftlichen Fächer war ich in Chemie meinen Mitschülern weit voraus. Im Abschlusszeugnis der Grundschule steht: Seine besondere Vorliebe galt dem Fach Chemie. Meine Leistungen in den humanistischen Fächern blieben dagegen etwas bescheidener. Nach der Grundschulzeit ging es erst einmal auf die Geschwister-Scholl-Oberschule Löbau, zusammen mit den Schulfreunden Christian Hermann und Dieter Michalk. Aber ich fühlte mich dort überhaupt nicht wohl. Nur mit Biologie und Chemie konnte ich mich etwas anfreunden. Beim Mikroskopieren haben wir auch meine mitgebrachten Blattreste aus Seifhennersdorf untersucht. Das Eingehen auf solche Belanglosigkeiten festigte die Beziehung zum Lehrer.
Im zeitigen Frühjahr 1958 sah ich eine Annonce in der Zeitung, nach der Berglehrlinge für den Steinkohlenbergbau in Zwickau gesucht wurden. Irgendwie der Geologie näher zu kommen war ein Strohhalm, der mich vor dem Ertrinken bewahrte. Als Konsequenz habe ich den Oberschulbesuch in Löbau bereits im ersten Jahr abgebrochen. Da mein Vater damals stellvertretender Kreisschulrat war, wurden die eigentlichen Umstände des Abganges durch eine zweimonatige Kur im Kindererholungslager Wieck auf Rügen bewusst oder unbewusst etwas verschleiert – so sehe ich es heute. Aber auch mein Gesundheitszustand war nicht zum Besten bestellt – Asthma und Ekzem hatten Spuren hinterlassen.
Meine damaligen Schulfreunde Christian Hermann und Dieter Michalk haben die Oberschulzeit mit Erfolg absolviert, haben studiert, promoviert und waren recht erfolgreich in ihren Berufen. Dr. Christian Hermann (geb. am 10.10.1942) hatte eine leitende Funktion im Armeemuseum der DDR in Dresden und Dr. med. Dieter Michalk (geb. 11.12.1942) wurde leitender Arzt für Allgemeinmedizin in der psychiatrischen Klinik in Großschweidnitz bei Löbau.
Ein anderer Mitschüler und Schulfreund war Hartmut Michold, mit dem ich den von mir gefundenen Turmalinschurf auf Hebolds Kuppe bei Oppach ausbeutete. Nach dem Mittelschulbesuch in Neusalza-Spremberg holte er das Abitur nach, studierte Medizin und arbeitet bis heute als Facharzt für Gastroenterologie, Facharzt für Innere Medizin in Rostock und Gelbensande.
Wenn man aus heutiger Sicht auf unsere Grundschulklasse schaut, war der Geburts-Jahrgang 1942/1943 recht erfolgreich. Das bezieht sich im Wesentlichen auf die achte Klasse. Anfänglich betrug die Schülerzahl 30. Durch Wegzug pegelte sich diese Zahl am Ende auf 22 ein – eine gute Klassenstärke! Es ist praktisch niemand gescheitert. Jeder hat als Erzieher, Lehrer oder auch Facharbeiter seinen Mann gestanden. Vier Promovierte von 22 Grundschülern (11 Mädchen, 11 Jungen) einer Klasse sind schon beachtlich. Unsere Lehrer konnten nicht die Schlechtesten gewesen sein. Es gab aber auch Ausnahmen: Die Musiklehrer hatten die Klasse kaum im Griff – außer Hartmut Michold sang kein Junge beim obligatorischen Singen mit.
Ich glaube, es war in der achten Klasse. Der Biologieunterricht wurde von einer jungen Absolventin übernommen – der Lehrerin Gisela Hornig. Irgendwie hatte sie keine gute Beobachtungsgabe und auch kein pädagogisches Gespür. Sie war extrem unsicher und dadurch kam es häufig zu Störungen des Unterrichtes. Dabei beging sie den Fehler, immer wieder die Falschen zu ermahnen und zu bestrafen. Als Ergebnis wurde der Unterricht bei ihr einfach boykottiert – während einer Unterrichtsstunde drehten ihr alle Schüler ohne Ausnahme und unabgesprochen den Rücken zu. Sie musste letztlich den Schuldienst quittieren. Diese Ereignisse spielten sich ebenfalls im Klassenzimmer 9 unter dem Dach ab.
Die Politik hatte das Schulsystem noch nicht komplett durchdrungen. Im Rahmen des Geografie-Lehrplans erfuhren wir noch vieles vom westlichen Teil unseres Heimatlandes. Manches Lehrmaterial – große Schautafeln und auch Filme – stammte noch aus der Vorkriegszeit. In den fünfziger Jahren wurden Schulfeste mit Ausstellungen von Lehrmaterial im Kretscham, einer Gaststätte im Zentrum des Ortes, durchgeführt. Die Geissler- und Crooks-Röhren in Verbindung mit einem großen Induktionsapparat sind in lebhafter Erinnerung geblieben.
Das uns vermittelte politische Ziel war die Wiedervereinigung ohne Bedingungen.
Zur Jugendweihe wurde noch der voluminöse, 520 Seiten fassende Band „Unser Deutschland“ mit einem Vorwort von Wilhelm Pieck ausgehändigt.
Der unaufhaltsame Niedergang des Schulsystems wurde ab 1963 durch Margot Honecker als Ministerin für Volksbildung eingeläutet. Unter ihr wurde unter anderem das „Lotto-System“, das Auswählen der richtigen Antwort auf eine Frage aus drei unterschiedlichen Möglichkeiten, im Schulunterricht eingeführt. Ein mehr als fragliches Verfahren, das in Klassenarbeiten später oft verwendet wurde. Mein Vater war strikt dagegen, musste es jedoch gegen seinen Willen auch verwenden.