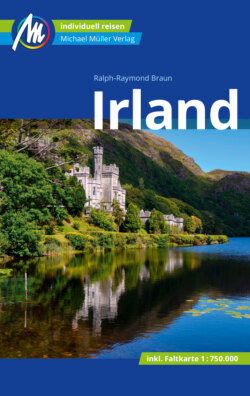Читать книгу Irland Reiseführer Michael Müller Verlag - Ralph Raymond Braun - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеStadtgeschichte
Eine Siedlung Eblana an Stelle der heutigen Stadt ist schon auf der um 140 n. Chr. entworfenen Weltkarte des alexandrinischen Geographen Ptolemäus verzeichnet. Später gab es eine keltische Siedlung namens Dubh Linn („dunkler Teich“), die Dublin seinen Namen gab. Der „dunkle Teich“ war die Mündung des Poddle. Heute völlig in unterirdische Rohre gezwängt, folgte er einst der St Patrick Street, schlug einen Bogen um Dublin Castle und ergoss sich an der Grattan Bridge in die Liffey. Eine ebenso große Berechtigung auf die Urheberschaft an der Stadt haben die Wikinger, die sich im 9. Jh. in diesem Flussknie niederließen, wo auch die alte Königsstraße zwischen Tara und Wicklow die Liffey überquerte. Die im 10. Jh. errichtete Stadtmauer schützte die Nordmänner nur wenige Jahre: 988 eroberten die Iren unter Mael Sechnaill die Wikingerstadt.
Die Ha’penny Bridge über den River Liffey
Ein neues Kapitel der Stadtgeschichte schlugen die Normannen auf. Heinrich II. machte Dublin zum Sitz des königlichen Gerichts und damit zum Hauptort der englischen Präsenz in Irland. Wer immer auf der Insel Rang und Namen hatte, fand sich zu den Seasons, den Gerichtstagen, in Dublin ein, um seine Interessen zu vertreten. Anfangs mit einer schlichten Palisade, bald mit einer Reihe von Burgen wurde das Pale, das Umland Dublins, vor den Einfällen der irischen Häuptlinge geschützt. Mehr über das mittelalterliche Dublin erfahren Sie in der Ausstellung Dublinia (→ Sehenswürdigkeiten).
Nach 1730 entwickelte sich Dublin zur größten Stadt des Königreiches nach London. Händels Messias beispielsweise wurde am 13. April 1742 nicht in London, sondern in Dublin uraufgeführt, wo der Meister den Winter zu verbringen pflegte. Die protestantische Gentry investierte ihr aus den Landgütern gewonnenes Vermögen in neue und prächtige Häuser in den georgianischen Vierteln außerhalb der zu eng gewordenen Stadtmauern. Die „Commission for Making Wide & Convenient Streets“, mit der 1757 die systematische Stadtplanung begann, zeigt schon mit ihrem Namen, worum es ging. Um die gleichzeitig sprießenden Slums kümmerte sich die Kommission allerdings nicht. Auch in Dublins goldenem Zeitalter zwischen 1782 und 1801, als die irischen Protestanten sogar ihr eigenes Parlament hatten (heute ist das Gebäude treffenderweise Sitz der „Bank of Ireland“), war das Los der katholischen Bevölkerung nicht rosig.
Der Act of Union beendete die Autonomieträume und ließ das überbordende Wachstum der Stadt abrupt abbrechen. Vom Boom des 19. Jh., als viele englische Industriestädte aufblühten, war hier wenig zu spüren. Bei der Niederschlagung des Osteraufstands von 1916, als die Aufständischen das Postamt in der O’Connell Street zu ihrem Hauptquartier erkoren, wurden weite Teile des Zentrums auf der North Side zerstört, der Bürgerkrieg und eine Feuersbrunst (1922) trugen ebenfalls ihren Teil bei.
Dublin heute
Der schlechte Zustand mancher Viertel, besonders der North Side, ist auch Ergebnis planerischer und politischer Fehler der 50er-, 60er- und 70er-Jahre des 20. Jh. Damals suchte man die Lösung der Wohnungsnot im Bau neuer Vorstädte und überließ die Innenstadt dem Zerfall. Erst in den 90ern kehrte das öffentliche und private Geld in die Stadt zurück. Temple Bar und die Gegend um St Stephen’s Green sind Beispiele für eine erfolgreiche Sanierung, die maroden Docklands an der Mündung der Liffey wurden mit Milliardenaufwand zu einem internationalen Banken- und Finanzzentrum aufgemöbelt. Von Hochhäusern blieb die Stadt, deren Verwaltung mit dem neuen Rathaus bei der Christ Church selbst ein schlechtes Beispiel gesetzt hat, bisher weitgehend verschont. An der Zentralbank in der Dame Street, von der die drei obersten, unter Missachtung der Bauauflagen errichteten Stockwerke wieder abgetragen werden mussten, statuierten die städtischen Planer in den 70er-Jahren ein Exempel. Und im Vorort Ballymun wurden einige Wohntürme wegen zu großer sozialer Probleme sogar wieder gesprengt. In Sachen Denkmalschutz liegt Dublin jedoch noch weit hinter den in anderen Hauptstädten der Europäischen Union geltenden Normen zurück.
Orientierung
Die Metropole dehnt sich von der Halbinsel Howth im Norden in einem Halbkreis um die Dublin Bay bis nach Dalkey im Süden aus. Das Zentrum ist für eine Millionenstadt jedoch relativ klein und überschaubar. Die meisten öffentlichen Einrichtungen und Sehenswürdigkeiten sind vom Castle zu Fuß in längstens einer halben Stunde zu erreichen. Der River Liffey schneidet die Kernstadt in zwei Hälften: Auf der North Side folgen nach der Prachtmeile O’Connell Street, der Hauptgeschäftsstraße Dublins, bald die Mietskasernen der Arbeiterviertel. Für den Besucher interessanter ist die South Side. Unmittelbar am Fluss liegt das Vergnügungsviertel Temple Bar, östlich schließen sich die georgianischen Ensembles mit der Einkaufszone um die Grafton Street, dem Bankenviertel um St Stephen’s Green und dem Campus des Trinity College an. Der mittelalterliche Stadtkern lag auf dem Hügel südwestlich von Temple Bar. Da die meisten Häuser aus Holz waren, sind mit Dublin Castle (1205, im 18. Jh. umgebaut), Christ Church (1172) und St Patrick’s Cathedral (1190) nur noch wenige Spuren dieser Zeit erhalten geblieben.
Das folgende Kapitel ist zunächst in der Reihenfolge zweier Rundgänge aufgebaut, die beide an der O’Connell Bridge beginnen. Hier werden die Sights auf dem Südufer vorgestellt, hier jene auf der Nordseite der Liffey. Dann folgen ab hier die Sehenswürdigkeiten außerhalb des Stadtzentrums.
4 Tage Dublin
Was tun? Die Antwort ist natürlich subjektiv und wird je nach Geschmack und Wetter anders ausfallen. Hier trotzdem ein Vorschlag, wie Sie vier Tage Dublin verbringen und dabei viel sehen und erleben können.
1. Tag: Trinity College mit Book of Kells; Bummel entlang der georgianischen Ensembles am St Stephen’s Green oder Merrion Square und auf der Shoppingmeile Grafton St. Schlechtwetteralternative: Kunst in der Nationalgalerie oder Chester Beatty Library und überdachte Shoppingmalls. Abends in einen Pub.
2. Tag: Bummel über die O’Connell St, Flussfahrt auf der Liffey, Ausflug mit der DART entlang der Küste zum Joyce-Tower nach Dun Laoghaire. Abends nach Harold’s Cross zum Greyhound-Rennen.
3. Tag: Gefängnis Kilmainham Gaol, Museum für moderne Kunst IMMA, dann ins Guinness Storehouse samt einem Bier in der Gravity Bar.
4. Tag: Führung Marino Casino und Ausflug auf die Halbinsel Howth mit Klippenwanderung. Schlechtwetteralternative: Malahide Castle. Abends je nach Geschmack Musical oder Literary Pub Crawl.
Trinity College / College Green
Das auf einer Fläche von 2 km2 angelegte College ist mit seinen düsteren Gebäuden aus dem 17. bis 19. Jh., den kopfsteingepflasterten Höfen und den Sportflächen ein Musterbeispiel für einen englischen Campus, wie man ihn auch in Oxford oder Cambridge findet.
Irlands angesehenste Hochschule wurde 1592 von Elisabeth I. auf dem Gelände eines enteigneten Klosters gegründet, das wiederum an der Stelle des städtischen Friedhofs der Wikingerzeit stand. Am Front Gate, dem 1752-59 errichteten Haupteingang, stehen die Statuen des Philosophen Edmund Burke (1729-97) und des Dichters Oliver Goldsmith (1730-74) stellvertretend für viele andere Geistesgrößen, die am Trinity College studierten oder lehrten, beispielsweise Jonathan Swift („Gullivers Reisen“), Bram Stoker (Erfinder des Grafen Dracula), Wolfe Tone (irischer Politiker und Freiheitsheld) und Samuel Beckett („Warten auf Godot“).
♦ Führungen über das Universitätsgelände mit der „Trinity College Walking Tour“, tägl. 9.45-16 Uhr ab dem Informationsschalter im Haupteingangsbereich. 15 €/Pers., mit Eintritt zum „Book of Kells“.
Mit Bildung gegen die „Papisten“
Erst seit 1793 nimmt die University of Dublin, wie das Trinity College heute offiziell heißt, auch Nichtprotestanten auf. Und noch bis 1966 bedurfte jeder Katholik, um am Trinity College studieren zu dürfen, einer Ausnahmegenehmigung seines Bischofs - ohne den Dispens hätte ihn der Bannstrahl der Exkommunikation getroffen. Die Hochschule war lange eine Bastion des anglo-irischen Protestantismus, die verhindern sollte, dass junge Iren zum Studieren auf den Kontinent gingen und dort vom „Papismus“ und dessen falschen Lehren infiziert würden. Der erste Rektor war Erzbischof James Ussher, dessen herausragende „wissenschaftliche“ Leistung die Datierung des Weltanfangs auf das Jahr 4004 v. Chr. war.
Parliament Square
Durch den von der Chapel und Exam Hall flankierten Front Square kommt man auf den Library Square, den Hauptplatz der Universität. Der Campanile (1853) auf der Mitte des Platzes markiert in etwa die Stelle, wo das alte Kloster stand. Nördlich davon, neben der Kapelle befindet sich die Dining Hall (1743), ursprünglich ein Werk des deutschstämmigen Richard Cassels, der uns noch als Architekt der prächtigen Landsitze im Umland Dublins begegnen wird. Hier am College müssen ihm allerdings grobe Schnitzer passiert sein, denn das Gebäude war unzureichend fundamentiert und musste schon 1758 abgetragen und neu aufgebaut werden.
Inwieweit es noch Cassels’ Entwurf entspricht, ist ungewiss. Im Uhrzeiger-sinn schließt sich das Graduates’ Me- morial Building an. Der Name des dahinter liegenden Tennisplatzes Botany Bay spielt darauf an, dass unbotmäßigen Studenten früher nicht nur der Verweis von der Hochschule, sondern sogar die Deportation in die gleichnamige australische Sträflingskolonie drohte. Weiter im Uhrzeigersinn gibt der rote Ziegelbau des Wohnheimes Rubrics (um 1690, umgebaut 1894 und 1978) dem sonst grauen Campus etwas Farbe. Die Old Library auf der Südseite des Platzes wurde 1712-32 in einer strengeren Formensprache gebaut, beide sind damit die ältesten noch erhaltenen Gebäude des Colleges.
New Square
Bevor Sie sich nun um Einlass zum Book of Kells bemühen, gehen Sie noch zum New Square mit dem viktorianischen Museum Building, welches das Department für Geologie mit seinem Museum beherbergt. Aufwendige Steinmetzarbeiten zieren die Fassade, die von den einen als „venezianisch“, von anderen als „neobyzantinisch“ klassifiziert wird und die mit ihren Rundbögen, Halbsäulen und Zierrosetten auf jeden Fall ein Blickfang ist. Die Skelette zweier Hirsche bewachen die mit Naturstein ausgekleidete Eingangs-halle. Auf der Südseite des Hauses glänzt Sphere within Sphere, eine aufgerissene, mit Zahnrädern gefüllte Riesenkugel. Ihr Schöpfer, der italienische Künstler Arnaldo Pomodoro, schenkte die 1982 geschaffene Skulptur dem College.
Dublin mit Kindern
Dublins Bevölkerung ist jung, doch ganz so willkommen wie in vielen südlichen Ländern sind die kleinen Urlauber nicht.
Spielplätze sind in der Innenstadt rar. Als Ersatz kommen die Parks in Frage, auch manches Einkaufszentrum hat eine Spielecke. Hier wird man auch am ehesten Wickeltische finden.
Kinderfreundlich geben sich die meisten Hotels. Sie bieten Kinderbetten und organisieren auf Wunsch Babysitter. Einige B&B-Besitzer möchten keine Kids im Haus. Hier fragt man besser vorher nach.
In vielen gehobenen Restaurants sind Kinder abends unerwünscht. Natürlich gibt es auch familienfreundliche Restaurants, die Kinderstühle, Kinderportionen oder sogar Kinderanimation haben, wie sonntagnachmittags das Milano in der Dawson Street.
Veranstaltungen für Kinder sind mittwochs in der Irish Times und im Web unter www.familyfun.ie gelistet.
Speziell an Kinder richten sich die Angebote des Kinderkulturzentrums Ark in Temple Bar. Auch Dublin hat einen Zoo. Kinderfreundlich ist die Mittelaltershow Dublinia, und die Mumien in St Michan’s hinterlassen sicher einen bleibenden Eindruck. In Malahide können Sie das Schloss mit dem historischen Spielzimmer der Talbot-Kinder und die Miniatureisenbahn Model Railway besichtigen.
Fellows Square
Auf der Südseite der Old Library stehen am Fellows Square Touristen und andere Neugierige, die das Book of Kells sehen wollen, in der Warteschlange - Zeit genug, um über die Berkeley Library auf der Ostseite des Platzes zu sinnieren. Paul Koraleks 1967 gebauter Betonklotz mit seinen gewölbten Fenstern und Pechnasen gilt nämlich als ein Meisterstück moderner Architektur. Für den neueren Stand der Baukunst steht die 2002 eröffnete Ussher Library. Trist und kalt wirkt die mit einer Glaspyramide und einem einsamen Baum akzentuierte Freifläche zur Berkeley Library hin. Zur Nassau Street hin begrenzt das von Koraleks Büro 1979 entworfene Arts Building den Fellows Square; in ihm ist u. a. die Douglas Hyde Gallery zu Hause. Sie zeigt wechselnde Ausstellungen moderner Kunst. Durch eine Passage im Arts Building kann man das College-Gelände zur Nassau Street hin verlassen.
♦ Douglas Hyde Gallery: Mo-Fr 11-18, Do bis 19, Sa 11-16.45 Uhr. Eintritt frei. www.douglashydegallery.com.
Old Library
Seit 1801, so will es ein auch nach der irischen Unabhängigkeit weiter gültiges Gesetz, hat die Bibliothek des Trinity Colleges Anspruch auf ein kostenloses Exemplar von jedem in Großbritannien oder Irland verlegten Buch. Der Bestand umfasst etwa 3 Millionen Bände, und jedes Jahr kommt ein weiterer Regalkilometer hinzu. Der 65 m lange Long Room, der Hauptlesesaal der Bibliothek, verwahrt die 200.000 wertvollsten Werke, also vor allem die handgeschriebenen Manuskripte und Frühdrucke. Er kann zusammen mit dem Book of Kells (siehe unten) besichtigt werden. Um mehr Platz zu schaffen, wurde 1853 ein weiteres Geschoss aufgesetzt und später auch die zuvor offenen Arkaden zugemauert und ins Gebäude einbezogen. Doch die Lagermöglichkeiten der Bibliothek sind längst erschöpft, der größte Teil des gesammelten Wissens ruht in überall in der Stadt verstreuten Depots.
Book of Kells
Highlight der Bibliothek ist das um 800 entstandene Book of Kells. Von fleißigen Mönchen auf der schottischen Insel Iona handgeschrieben und illustriert, kam es nach der Zerstörung des dortigen Klosters durch die Wikinger nach Irland und fand samt den Mönchen in Kells eine neue Heimat. Seit dem 17. Jh. befindet es sich im Besitz des Trinity College. Die 340 prächtig illuminierten Blätter mit dem Text der Evangelien wurden in den 1950er-Jahren restauriert und in vier Bänden neu gebunden, von denen zwei in Vitrinen zu bewundern sind. Jeden Monat werden eine neue Text- und eine neue Bildseite aufgeschlagen.
Da sich an diesen Vitrinen etwa eine halbe Million Neugierige pro Jahr die Nase platt drücken und einander kaum Zeit lassen, die Buchseiten en détail zu betrachten, werden zusätzlich wechselnde Seiten aus weiteren, weniger berühmten, aber kaum weniger prächtigen Handschriften ausgestellt, z. B. aus dem Book of Armagh (9. Jh.), dem Book of Dimma (8. Jh.) oder dem Book of Durrow (um 670), Irlands ältestem Manuskript mit schönen geometrischen Motiven.
Vor dem Besuch der Originale steht die Dauerausstellung Turning Darkness into Light auf dem Programm. Sie erklärt Technik und Tradition von Schriftkunst und Buchmalerei und erklärt das historische und religiöse Umfeld, in dem die Handschriften entstanden.
♦ Mo-Sa 8.30 (Okt.-April ab 9.30) bis 17 Uhr, So 9.30 (Okt.-April ab 12) bis 16.30 Uhr. Eintritt mit College-Führung 15 €, mit online vorgebuchtem Termin (ohne College-Führung) 11-14 €. www.bookofkells.ie.
Zoological Museum
In einem Gebäude auf der Ostseite des als Sportfeld genutzten College Parks ist das Zoologische Institut zu Hause. Nur in den Sommermonaten öffnet es sein kleines Museum für das Publikum. Zu den Highlights der Sammlung zählt ein präparierter Riesenalk; dieser wie die Pinguine flugunfähige und zu Lande ziemlich unbeholfene Seevogel lebte einst an den Gestaden des Nordatlantiks. Im 19. Jh. wurde er durch menschlichen Jagdeifer und Sammelwut ausgerottet. Als weitere Kuriosität sei das Skelett von „Prince Tommy“ erwähnt. Der König von Nepal hatte diesen Elefanten einst Prinz Alfred, dem zweitgeborenen Sohn von Königin Viktoria, geschenkt. Doch nachdem das Tier auf einer Zugfahrt in England seinen Wärter totgetrampelt hatte, wahrte Prinz Alfred Abstand und vermachte seinen Elefanten dem Dubliner Zoo. Liebhaber schöner Dinge werden Gefallen an den filigranen Modellen von Meerestieren und pflanzen finden, die von der Glasbläserfamilie Blaschka geschaffen wurden - ihr Geschick gilt bis heute als unerreicht. Zum Abschluss des Besuchs kann man sich im Schlund eines Weißen Hais fotografieren lassen.
♦ Juni-Aug. tägl. 10.30-16 Uhr. Eintritt 3 €. www.tcd.ie/Zoology/museum.
Science Gallery
Das zum Trinity College gehörende Wissenschaftszentrum schlägt in seinen regelmäßigen Sonderausstellungen die Brücke zwischen Kunst und Wissenschaft. Forscher, oft noch Studenten, stellen ihre Ergebnisse vor, gewähren Einblick in überraschende Naturphänomene, versetzen uns in die Rolle von Gehörlösen, lassen uns Experimente ausführen und führen uns, etwa mit Sinnestäuschungen, auch mal an der Nase herum. Vor allem naturwissenschaftlich interessierte Jugendliche und junge Erwachsene kommen hier auf ihre Kosten. Vor Ort gibt es auch ein Café und einen Laden mit Spielen, Werkzeugen und Büchern über Wissenschaft und Kunst.
♦ Di-So 12-20 Uhr. Eintritt frei. Naughton Institute, Trinity College, Pearse St, www.dublin.sciencegallery.com.
Bank of Ireland
Mehr noch als im College wurde auf der anderen Straßenseite in dem massiven Gebäude der Bank of Ireland Geschichte gemacht. Es entstand 1729-39 nach einem Entwurf von Edward Pearce als Parlament der irisch-anglikanischen Landlords, die sich als eine eigene „Nation“ unter Schirmherrschaft der britischen Krone verstanden, lange bevor es das Commonwealth gab. Der rebellische Geist war jedoch nicht von Dauer. Mit dem Act of Union löste sich das Parlament selbst auf, 1803 wurde das Gebäude mit der Maßgabe an die Bank of Ireland verkauft, es so umzubauen, dass es für große Versammlungen und Debatten nicht mehr zu gebrauchen wäre. Konsequenterweise machte das neue Parlament nach dem Ersten Weltkrieg der Bank ihren Besitz nicht mehr streitig, sondern zog in das Leinster House.
Nach Pearce modellierten noch drei andere Architekten den klassizistischen Tempel, seinen letzten Schliff erhielt er erst, als die Bank eingezogen war. In der Schalterhalle mit ihrem gedämpften Gemurmel erinnert nichts daran, dass hier einst die Redeschlachten tobten. Erhalten blieb jedoch der Saal des Oberhauses mit seiner Holztäfelung aus dunkler Eiche, einem kostbaren Kristallleuchter aus der Manufaktur von Waterford und zwei monumentalen, 1733 vollendeten Wandteppichen. Diese vermutlich von einem flämischen Weber gefertigten Tapisserien gelten als Meisterwerke und zeigen vor dem Hintergrund einer naturgetreuen Landschaft Szenen der Schlacht am Boyne und der Verteidigung Derrys.
♦ Diskret, wie Geldinstitute sind, macht auch die Bank of Ireland um das Juwel des House of Lords nicht viel Aufhebens. Doch während der üblichen Geschäftszeiten (Mo-Fr 10-16, Do 10-17 Uhr) kann man einen Blick ins House of Lords werfen - vom Hof aus gesehen rechter Eingang. Anmeldung beim Portier. Führungen Di 10.30 und 12.30 Uhr.
Heritage Centre
Die Ausstellung „Listen Now Again“, ein Partnerprojekt zwischen Nationalbibliothek, Kulturministerium und der Bank of Ireland, stellt uns Leben und Werk des Nobelpreisträgers Seamus Heaney vor. Am Eingang grüßt eine papierne Skulptur, die sich in fliegende Vögel verwandelt. Vielleicht eine Anspielung auf „Die Amsel von Glanmore“, eines von Heaneys bekanntesten Gedichten. Wir sehen Originalmanuskripte, Briefe, Tagebucheinträge und Fotografien; dazu persönliche Gegenstände, wie zum Beispiel den Schreibtisch, an dem Seamus Heaney im Dachgeschoss der Familie in Sandymount schrieb. Animationen und Touchscreens illustrieren den Schaffensprozess des Poeten, Klänge und taktile Erfahrungen lassen sich nachempfinden. Auf einer Wand können wir uns selbst als Dichter versuchen.
♦ Mo-Sa 10-16 Uhr, Einlass bis 15.30 Uhr. Eintritt frei. Westmoreland St, www.nli.ie → exhibitions.
National Wax Museum Plus
Hier treffen sich Politiker, Popstars und Päpste mit Monstern und Sagengestalten, hier mischt sich Kult mit Kitsch. Endlich hat Dublin wieder ein Wachsfigurenmuseum! Sein Vorgänger musste schließen, doch einige Figuren überlebten in einem Lagerhaus. Andere wie der fiese Gollum aus Herr der Ringe oder das mörderische Genie Hannibal Lecter verschwanden bei einem spektakulären Einbruch.
Hannibal wurde durch ein Double ersetzt und ist nun zusammen mit dem Monster Frankenstein, das sich, von Sensoren gesteuert, sogar bewegen kann, Star in der Chamber of Horrors (Kammer des Schreckens). An eher zart besaitete Gemüter und kleine Kinder richtet sich die World of Fairytales (Welt der Märchen), wo wir etwa Aladins Wunderlampe sehen. Im Raum der keltischen Mythen treffen wir den Krieger Cuchulain und den künftigen Helden Fionn mac Cumhaill, wie er gerade nach dem riesenhaften Lachs der Weisheit (salmon of wisdom) greift, der ihn zum Anführer der Heroen machen wird.
Doch zurück auf Los! Den Auftakt macht Albert Einstein als Lehrer vor dem Periodensystem, nun ja, für unsereinen sind Physik und Chemie gleichermaßen schwer zu verstehen. Dann ein bellender Dinosaurier, zum Glück ein Gummitier, wer’s zwickt, hat also nichts zu befürchten. In der Hall of Megastars treffen wir Donald Trump oder Phil Lynott, dann Irlands berühmte Dichter beim Bier.
Im katholischen Irland dürfen auch religiöse Themen nicht fehlen. Ein Papst winkt uns fröhlich zu. Keine Wachsreplik, sondern ein Original ist das Papamobil, mit dem Johannes Paul II. bei seinem Besuch 1979 durch Dublin fuhr. Künftig soll das päpstliche Fahrzeug auf Werbetour für das Museum gehen.
♦ Tägl. 10-19 Uhr, Einlass bis 18 Uhr. Eintritt 16,50 €. 22 Westmoreland St, www.waxmuseumplus.ie.
Molly Malone Statue
Vor der Kirche in der Suffolk Street gedenkt eine Skulptur der in einem Volkslied gefeierten Molly Malone, eine vermutlich 1734 verstorbene Fischverkäuferin. Ihre aus dem knappen Dekolleté quellenden Brüste und der Spitzname „tart with a cart“ spielen auf Mollys eigentlichen Broterwerb als Sexarbeiterin an.
Merrion Square / St Stephen’s Green
Zwischen dem College und Stephen’s Green sind außer den Einkaufsstraßen Grafton und Dawson Street vor allem die georgianischen Ensembles um den Merrion Square und in der Fitzwilliam Street sehenswert. Mansion House (1710) in der Dawson Street, in dem sich 1919 das irische Parlament zu seiner ersten Sitzung traf, war lange die Residenz des Dubliner Bürgermeisters. Die Ziegelfassade verbirgt sich hinter einer Putzschicht - man sieht dem Haus nicht an, dass es eines der ältesten im Quartier ist. In der Molesworth Street, die die Dawson mit der Kildare Street verbindet, residiert hinter grauen Sandsteinmauern die Großloge der irischen Freimaurer, eine überwiegend protestantische Einrichtung, die nicht ohne Einfluss auf die nordirische Politik ist.
Leinster House
In dem 1745 als Palais des Herzogs von Leinster errichteten Gebäude tagen seit 1925 die beiden Kammern des irischen Parlaments. Zur Kildare Street zeigt sich Leinster House als ein typisches Stadthaus, während es zum Merrion Square hin eher an ein Landschloss erinnert. Bald nach dem Leinster House hat Richard Cassels das Rotunda Hospital auf der North Side nach dem gleichen Konzept gebaut.
Seit 1890 wird das Schloss an der Kildare Street-Seite von den Rundbauten des Nationalmuseums und der Nationalbibliothek flankiert - ob das Ensemble harmonisch wirkt, sei dahingestellt. Die Bücherschätze der National Library können sich mit denen des Trinity College nicht messen. Joyce siedelte im Lesesaal (nur mit Leserausweis zugänglich), wo er oft arbeitete, die große literarische Debatte des „Ulysses“ an. Die Südwestecke des Blocks, begrenzt von Merrion Street und Merrion Row, nehmen die ausgedehnten Government Buildings ein. Noch für die britische Verwaltung gebaut, wurden sie 1921 gerade rechtzeitig zur Gründung des irischen Freistaats fertig. Auf geführten Rundgängen darf man sich als Staatsgast fühlen und das Büro des Premierministers und den Kabinettssaal besichtigen.
♦ Leinster House: Die Besuchergalerie des Unterhauses ist zu den Sitzungen zugänglich, d. h. gewöhnlich Nov.-Mai Di 14.30-22, Mi 10.30-20.30, Do 10.30-17.30 Uhr. Akt. Termine unter www.oireachtas.ie. Führungen durchs Haus Mo & Fr 10.30, 11.30, 14.30 und 15.30 Uhr.
Gouvernment Buildings: Führungen Sa 10.30, 11.30, 12.30, 13.30 Uhr, Eingang Upper Merrion St. Anmeldung am Tag der Führung ab 9.30 Uhr an der Kasse der National Gallery. www.taoiseach.gov.ie.
National Museum - Archaeology
Zum Ärger der Provinz versammelt das Nationalmuseum von der Steinzeit bis ins Mittelalter nahezu alle bedeutsamen archäologischen Funde der Insel. Ja noch mehr, denn es gibt auch eine altägyptische Sammlung und einen Saal mit zyprischer Keramik. Das Arrangement ist etwas verwirrend, umso schmerzlicher vermisst der Besucher einen Katalog. Höhepunkte des Museums sind die Sammlung alten Goldschmucks und die Moorleichen.
Jüngst eingerichtet und am besten präsentiert ist die Ausstellung Königtum und Opfer im linken Quersaal. Sie ist um mehrere keltische Moorleichen arrangiert. Ahnherr ist der bereits 1821 entdeckte „Gallagh Bogman“, ein 2500 Jahre alter und bemerkenswert intakter Kollege des „Ötzi“, der schon lange im Museum zu Hause ist. Zu ihm gesellte man nun den „Clonycavan Man“, einen Dandy mit schicker Zopffrisur. Außerdem den „Oldcrohan Man“, auch er einstmals ein feiner Herr mit manikürten Fingernägeln. 1,98 m groß soll er einmal gewesen sein, so sagen die Wissenschaftler, ein wahrer Riese also, doch geblieben ist nur sein Torso. Den Unterleib verlor er wohl durch einen Torfbagger, den Kopf durch Enthauptung. Wie andere europäische Moorleichen ihrer Epoche zeigen, wurden auch die Iren grausam gefoltert und mehrfach hingerichtet - es deutet alles darauf hin, dass die vorchristlichen Kelten Menschen opferten.
Die Vorgeschichte wird im Umgang der zentralen Halle präsentiert. Wir erfahren, dass vor etwa 5700 Jahren anonyme Abenteurer die neolithische Revolution in Form von Schafen und Ziegen auf die Insel brachten, außerdem kann man einen riesigen Einbaum und alte Musikinstrumente bewundern. Die Mitte der Halle gehört mit Irlands Gold den Geschmeiden der Bronzezeit: Meist Colliers, Arm- und Fußringe, manchmal mit feinen Gravuren, als Kuriosa auch goldene Ohrspulen, die der Laie so wohl eher bei afrikanischen Stämmen vermutet hätte.
Im rechten Querraum weitet die Schatzkammer das Thema aus: Kunst und Kunsthandwerk von den Kelten bis ins Mittelalter, darunter als Glanzstücke die Brosche von Tara und das Altarkreuz von Clonmacnoise. Nicht ganz hierher passen die Vitrinen mit mittelalterlicher Kleidung.
Die Ausstellung im Obergeschoss beginnt im rechten Quersaal mit den Wikingern: Es geht um Waffen, Ackerbau, Sklaverei und die Anfänge Dublins, dokumentiert durch zahlreiche Kleinfunde, zuletzt wird die Sakralkunst mit dem Kreuz von Cong geschickt in Szene gesetzt.
Chronologisch und im Uhrzeigersinn schließt sich das Mittelalterliche Irland an, aufgeteilt in die Bereiche „König und Adel“, „Kirche und Gläubige“, „Bauern-Händler-Handwerker“.
Haben Sie bis jetzt durchgehalten? Dann wartet im Ägyptenraum noch ein kleines Highlight auf Sie. Auf der Wandseite links zwei sogenannte Fajumporträts aus römischer Zeit, Abbilder Verstorbener auf ihren Totenmasken und vermutlich die ältesten individuellen Menschenbilder, die Sie je gesehen haben.
♦ National Museum: Di-Sa 10-17, So/Mo 13-17 Uhr. Eintritt frei. Preiswerter Lunch im Coffeeshop des Museums. Kildare St, www.museum.ie.
Natural History Museum
Das Museum für Naturgeschichte ist dem Leinster House auf der Merrion-Seite vorgelagert. Seit der Einweihung anno 1857 - der Missionar und Entdecker David Livingstone hielt die Eröffnungsrede - hat der „Zoo der toten Tiere“ seine Ausstellung kaum verändert, und das Sammelsurium ausgestopfter und konservierter Kadaver ist nicht jedermanns Sache. Zehntausend Exponate sollen es sein, die Hälfte davon Insekten. Weitere zwei Millionen (!) Objekte ruhen in den Magazinen und Kellergewölben des Hauses.
Der Eingang des Hauses war zunächst auf der Westseite und wurde erst 1909 auf die Ostseite verlegt. Damit änderte sich im Erdgeschoss, das die Tierwelt Irlands vorstellt, die Richtung des Rundgangs. Die Stars der Sammlung, nämlich aus dem Moor geborgenen Knochengerüste von Elchen, die vor 10.000 Jahren auf der Insel lebten, hat man gedreht. Weniger prominente Exponate drehen dem Besucher dagegen den Rücken zu. Der 1. Stock zeigt die Welt der Säugetiere und endet mit Menschenaffen und dem Homo sapiens. Dann ist Schluss. Die oberen Etagen mit den Austellungen zu den niederen Tierarten sind gesperrt, weil das Geld fehlt, um die nach heutigen Standards erforderlichen Fluchtwege zu bauen.
♦ Di-Sa 10-17, So/Mo 13-17 Uhr. Eintritt frei. Merion St, www.museum.ie.
National Gallery
Eine Statue ehrt vor dem Eingang der Nationalgalerie den Eisenbahnmagnaten William Dargan. Er organisierte 1853 die Industrial Exhibition, eine Messe, aus deren Erlösen damals der Grundstock der heute 2400 Gemälde erworben wurde. Ein anderer Wohltäter der Schönen Künste war George Bernard Shaw. Auch er grüßt als Standbild die Besucher des Kunstmuseums. Die Sammlung umfasst das für Nationalgalerien übliche Repertoire - ein Faltblatt mit Lageplan erleichtert die Orientierung.
Bei nur einem Besuch empfehle ich die Yeats Collection (Raum 14). Jack Butler Yeats (1871-1957), ein jüngerer Bruder des berühmten Dichters, bannte bevorzugt irische Menschen und Landschaften sowie Themen aus der keltischen Mythologie auf die Leinwand. Er gilt als Irlands Nationalmaler. Gleichfalls ein Muss sind die Porträtgalerie (Raum 23) sowie die gelungene Auswahl von Werken irischer Maler im Dargan-Flügel (Räume 15-21). Ein speziell von den anglo-irischen Grundherren begehrtes Sujet waren Landschaftsbilder. Sie zeigen den Idealzustand einer den Vorstellungen des Landadels entsprechend gebändigten und geformten Natur.
Das Obergeschoss gehört der europäischen Malerei vom Spätmittelalter bis ins 19. Jh. In Raum 27 begegnen wir mit Lavinia Fontana der ersten Frau, die von ihrer Malerei leben und ihre Familie ernähren konnte. Star der Sammlung ist Caravaggios Gefangennahme Christi (engl. The Taking of Christ) von 1602 (Raum 25). Lange verschollen und dann für eine Kopie des Originals gehalten, kam es über Umwege zum Dubliner Jesuitenorden, wo es ab 1930 den Speisesaal der Kongregation zierte. Erst die Fleißarbeit zweier Kunststudenten brachte die wahre Identität des Bildes ans Licht.
♦ So/Mo 11-17.30, Di/Mi, Fr/Sa 9.15-17.30, Do 9.15-20.30 Uhr. Eintritt frei. Am Wochenende nachmittags Führungen. Eingang von der Clare St (hier Café und Shop) und vom Merrion Square West, www.nationalgallery.ie.
Merrion Square
Viele der farbenprächtigen Türen, die eines der erfolgreichsten Poster der Irlandwerbung zieren, findet man im Original um den Merrion Square. Die strengen Bauvorschriften des 18. Jh. ließen den Hausbesitzern wenig Freiraum für individuelle Gestaltung, und so versuchte man sich in Details wie eben Türen, Oberlichtern und kunstvoll geschmiedeten Fußabstreifern vom Nachbarn zu unterscheiden. Merrion Square war lange die erste Adresse der Stadt. In Nr. 1, dem ältesten Haus am Platz, residierte von 1855-76 Oscar Wilde. Gegenüber, an der Nordwestecke des Parks, stiftete ihm die Guinness-Brauerei ein Denkmal. An weiteren Berühmtheiten wohnten hier Daniel O’Connell (Haus Nr. 58), W. B. Yeats (Haus Nr. 52 und 82), und in Haus Nr. 65 lebte einige Jahre der Physiker Erwin Schrödinger, dessen geniale Wellengleichung dem diesbezüglich minder genialen Autor aus Schulzeiten noch in unliebsamer Erinnerung ist. Nr. 8 ist die standesgemäße Adresse des Royal Institute of the Architects of Ireland. Rund um den Platz stellen immer sonntags Künstler ihre Arbeiten aus.
Number Twenty Nine (Georgian Home): Von der Ostseite des Platzes zog sich, bevor 1965 die Elektrizitätsgesellschaft gleich 26 Häuser einem Büroklotz opferte, in der Fitzwilliam Street die längste geschlossene georgianische Häuserzeile der britischen Inseln entlang. Wohl als einen Akt bescheidener Wiedergutmachung hat die ESB ein Haus Ziegel für Ziegel wieder aufgebaut und im Stil von 1800 eingerichtet. Die Führung durch dieses Museum und der dazugehörige Informationsfilm pflegen allerdings die gängigen Klischees (z. B. das von den Ladies, die nichts anderes zu tun wissen als sich gegenseitig Briefe zu schreiben) und geben ein etwas verzerrtes Bild der Zeit.
♦ Das Haus wird derzeit renoviert, die Ausstellung ist bis 2021/22 nur virtuell unter www.numbertwentynine.ie zu sehen. 29 Fitzwilliam St, d. h. Südostecke des Merrion Square.
Oscar Wilde lümmelt sich im Park des Merrion Square
Saint Stephen’s Green
„Wholie kept for the use of the citizens and others to walk and take the open air“, beschlossen die Stadtväter schon 1635 über den neun Hektar großen Stadtpark und schützten die Grüne Insel vor der Bauspekulation.
Nach einem Zwischenspiel als Arbeitsplatz des Henkers und als ein von einer hohen Mauer geschützter Privatgarten der reichen Anlieger wurde das alte Vermächtnis um 1880 von Arthur Guinness neu belebt, der Stephen’s Green frisch bepflanzte und wieder dem Volk öffnete. Mit einem Teich, schwungvollen Brückchen, Aussichtsterrassen, Blumenrabatten, Springbrunnen, Schwänen und großzügigen Rasenflächen ist der Park an sonnigen Tagen ein beliebter Treffpunkt. Gärtnerisch und bezüglich seiner Architektur mag Stephen’s Green wenig aufregend sein, seinen Reiz verleihen dem Park die Menschen: Rentner auf den sprichwörtlichen Bänken, mal mehr, mal weniger entblößte Jugendliche auf dem Rasen; die mittlere Generation, männlich, vormittags im Geschäftsschritt mit gebundener Krawatte, Jackett und Aktenkoffer, mittags mit gelockertem Schlips und ohne Jackett, in Dokumente oder die Zeitung vertieft; die gleiche Altersgruppe, weiblich, morgens im Kostüm gekonnt auf hohen Absätzen über den Kies stöckelnd, mittags weniger sichtbar - die gleichberechtigte Nutzung des öffentlichen Geländes wird erst von den Ladies im reiferen Alter erreicht, die ihre Hunde ausführen oder ersatzweise Schwäne füttern.
Den Haupteingang an der Ecke zur Grafton Street überspannt der Fusiliers Arch, ein dem römischen Titusbogen nachempfundener Triumphbogen, der an die irischen Gefallenen des Burenkriegs erinnert. Am anderen Ende, dem Eingang von der Leeson Street, plätschert ein kleiner Brunnen „in Dankbarkeit für die Hilfe, die das irische Volk deutschen Kindern nach dem Zweiten Weltkrieg gewährte“, wie der seinerzeitige Bundespräsident Roman Herzog 1997 auf die Gedenkplakette schreiben ließ. Während der deutschen Hungerjahre 1945-48 schickten die Iren Care-Pakete und holten mit der Operation Shamrock sogar einige tausend Kinder für Wochen und Monate auf die Grüne Insel.
Die Nordostfront des Parks, wo früher, bevor der unablässige Autostrom dieses Vergnügen zerstörte, die Dandies und Beaus zu promenieren pflegten, nimmt das Shelbourne Hotel (1857) ein. Hier wurde die irische Verfassung entworfen, gingen Schriftsteller aus und ein wie William Thackeray, Oscar Wilde oder George Moore, der das Hotel gleich zum Schauplatz seines Romans „Ein Drama in Musselin“ machte. Das Geländer von Dublins bester Hoteladresse schmücken Statuen nubischer Prinzessinnen. Das Iveagh House, Nr. 80/81 auf der Südseite, ein weiteres Werk von Richard Cassels, war das Stadtpalais der Guinness-Familie. Heute wird es vom irischen Außenministerium genutzt.
♦ Führungen durch den Park bietet Sa/So 11 Uhr das Little Museum of Dublin an. 15 St Stephen’s Green North, www.littlemuseum.ie.
Newman House /Museum of Literature Ireland
Das Doppelhaus war ab 1853 Sitz der Catholic University of Ireland, also der katholischen Konkurrenz des Trinity College. Benannt ist es nach dem von Rom selig gesprochenen Theologen und Gründungsrektor John Henry Kardinal Newman. Im Newman House studierten unter anderem James Joyce und der spätere Präsident Eamon de Valera. Inzwischen hat die in University College Dublin (UCD) umbenannte Hochschule ihren Campus an den Stadtrand nach Belfield verlegt und richtete stattdessen im Newman House ein Museum für irische Literatur ein. Die in Zusammenarbeit mit der Nationalbibliothek konzipierte Ausstellung führt interaktiv von mittelalterlichen Handschriften bis zur Gegenwartsliteratur. Ausgestellt sind etwa die Notizbücher, in denen James Joyce Ideen für seinen Ulysses sammelte.
♦ Di-So 10.30-18, Do bis 19.30 Uhr, Einlass bis 1 Std. vor Schließung. Eintritt 10 €. St Stephen’s Green South. www.moli.ie.
Little Museum of Dublin
Das kleine, doch feine Museum residiert in einem georgianischen Stadthaus auf der Nordseite von St Stephen’s Green. Auf zwei Etagen dokumentiert es mit Alltagsgegenständen, Dokumenten und Fotos die Stadtgeschichte des letzten Jahrhunderts. Auf einem Sofa darf man es sich bequem machen und im ausgelegten Lesestoff blättern. Für Kinder gibt es altes Spielzeug - nicht nur zum Anschauen, sondern zum Anfassen und Spielen. Highlight sind die unterhaltsamen Führungen, die mit Witz und Charme die Ausstellung lebendig werden lassen.
♦ Tägl. 11-17 Uhr. Eintritt mit Führung 10 €. 15 St Stephen’s Green North, www.littlemuseum.ie.
Tara’s Palace / Museum of Childhood
Ein gewisser Sir Neville Wilkinson, Schwiegersohn des 14. Earls of Pembroke, baute im Jahre 1907 für seine Tochter Gwendolen ein fabelhaftes Puppenhaus. Im Wilkinson’schen Garten bot es Elfen und Feen ein standesgemäßes Zuhause, heute ist Titania’s Palace in einem Schloss auf der dänischen Insel Fünen ausgestellt. Ein irischer Antiquitätenhändler, der den Puppenpalast vergeblich zu ersteigern suchte, nahm ihn zum Vorbild und ließ von den besten irischen Modellbauern das Double Tara’s Palace errichten. Im Maßstab 1:12 kopiert das auch nach zwei Jahrzehnten Bauzeit noch unvollendete Modell voll eingerichtete Räume aus den großen georgianischen Schlössern der Insel wie etwa Castletown House. Andere Puppenhäuser und natürlich auch Puppen runden die Ausstellung ab.
♦ Wiedereröffnung für 2021 geplant. 14 St Stephen’s Green North, taraspalace.ie.
Dublin Castle und Liberties
Die Dame Street leitet vom georgianischen Viertel in das Zentrum des alten Stadtkerns um die Burg und die zwei Kathedralen über, in dem die mittelalterlichen Holz- und Lehmhäuser längst neueren Bauten gewichen sind.
Mit „Liberties“ wurde ursprünglich der Besitz der Kirchen und Klöster bezeichnet, der nicht der städtischen Gerichtsbarkeit unterstand. Heute steht dieser Begriff für das Gebiet zwischen den beiden Kathedralen und der Guinness-Brauerei.
Temple Bar
Der Ostteil von Temple Bar lag im Mittelalter außerhalb der Stadtmauer und gehörte zu einem Augustinerkloster. Seit dem frühen 18. Jh. allmählich bebaut, war es lange Zeit ein anrüchiges Viertel der Pubs und Bordelle. In den 1960er-Jahren sollte der heruntergekommene Stadtteil abgerissen und durch einen Busbahnhof ersetzt werden. Doch die Planung verzögerte sich, und Temple Bar überstand so die Zeit der Kahlschlagsanierungen, bis es in den Achtzigern „entdeckt“ und seine nicht immer behutsame Modernisierung eingeleitet wurde. Von einem Viertel der Randgruppen und Subkultur mauserte es sich zu einem modischen Yuppie-Quartier mit allerlei Galerien und Kunstzentren, zu einem Schaufenster moderner, oft preisgekrönter Architektur sowie mit seinen Restaurants, Pubs, Kinos und Bühnen zum Mittelpunkt des Dubliner Nachtlebens, wo weitgehende Videoüberwachung eine niedrige Kriminalitätsrate garantiert. Allerdings scheint Temple Bar an die Grenzen seiner Entwicklung gestoßen zu sein: Die etwa tausend ständigen Bewohner wehren sich gegen weitere Lärmquellen, klagen über den Lieferverkehr und mangelnde Straßenreinigung. Ganz im Westen des Viertels, jenseits der Parliament Street, entdeckt man gar leer stehende Ladenlokale.
City Hall
Das von einer Kuppel gekrönte klassizistische Rathaus wurde 1769-79 als Börse erbaut. Auch nachdem die Stadtverwaltung 1995 an den Wood Quay umzog, tagt in der City Hall weiterhin an jedem ersten Montag im Monat die Versammlung der Stadtverordneten. Im Kellergewölbe erzählt eine multimediale Ausstellung The Story of the Capital, also die Stadtgeschichte, mit Hilfe von Computeranimationen, Filmen, nachgestellten Szenen und anhand von Exponaten wie etwa dem ersten Stadtsiegel oder der Amtskette des Bürgermeisters. Den Aufbau der Ausstellung fanden wir etwas verwirrend. Abschließend geht es hoch in die Eingangshalle mit ihrer prächtigen Kuppel und einem Bodenmosaik, das das Stadtwappen zeigt.
♦ Mo-Sa 10-17.15 Uhr; Einlass bis 15.45 Uhr. Eintritt frei. www.dublincity.ie/dublincityhall.
Dublin Castle
Das Castle, mehr Schloss als Burg, thront auf dem Cork Hill gerade 200 m südlich der Liffey. In den drei Innenhöfen sieht sich der Besucher einem bunten Stilpotpourri gegenüber: Von der alten Normannenburg (1202-1258) ist noch der Record Tower erhalten. Bermingham Tower (1411), lange das Verlies der Burg, bekam im 18. Jh. ein neues Gesicht. Die Moderne ist mit dem unansehnlichen Bau des Finanzamtes vertreten, und die neogotische Royal Chapel scheint der Fantasie eines Zuckerbäckers entsprungen. In der Kolonialzeit war das Schloss Amtssitz der britischen Gouverneure und Vizekönige, heute beherbergt es alle möglichen Ämter und Behörden. Die repräsentativen State Apartments (auf der Südseite des mittleren Hofes) kommen weiterhin bei Staatsempfängen zu Ehren, sind im Rahmen von Führungen aber auch gewöhnlichen Menschen zugänglich. In der Eingangshalle rekonstruieren Schautafeln die Entwicklung der Burg, die Führungen bringen den Besucher auch in ein Kellergewölbe mit Resten von Befestigungsanlagen aus der Wikingerzeit. Unter der Royal Chapel ehrt das etwas skurrile Revenue Museum die Arbeit der Finanz- und Zollverwaltung. Am Tor der Dame Street gibt es noch ein „Visitor Centre“, das aus Cafeteria, einem Souvenirshop und großzügig dimensionierten Toiletten besteht - die der Mensch manchmal dringender benötigt als die Kultur.
♦ State Apartments: Tägl. 10-17.45 Uhr, Einlass bis 17.15 Uhr. Eintritt 8 €, mit Führung 12 €. www.dublincastle.ie.
Dublin Castle mit Bermingham Tower und Royal Chapel
Chester Beatty Library and Gallery of Oriental Art
Durch den Garten des Dublin Castle kommt man in die renommierte orientalische Kunstsammlung des 1968 verstorbenen Bergbaumagnaten Alfred Chester Beatty. Nur ein Bruchteil der persischen und türkischen Miniaturen, Papyri, japanischen Holzdrucke und chinesischen Vasen wird ausgestellt. Die Bibliothek genießt unter Fachleuten Weltruf, die Ausstellung gewann 2002 den Europäischen Museumspreis. Der erste Stock zeigt unter dem Motto „künstlerische Traditionen“ christliche und islamische Buchkunst. In der fernöstlichen Abteilung ist das Thema weiter gefasst, hier sehen wir auch chinesische Schnupftabakdosen und japanische Samuraischwerter. Im zweiten Stock geht es um die Religionen und ihre heiligen Bücher.
♦ Mo-Fr 10-17 Uhr (Nov.-Febr. Mo geschl.), Sa 11-17, So 13-17 Uhr. Eintritt frei. Führungen Mi 13, So 15 und 16 Uhr. Eingang Dame St oder Ship St, www.cbl.ie.
Buchkunst in der Chester Beatty Library
Saint Patrick’s Cathedral
Warum hat der Normannenbischof Comyn, als er 1191 den Grundstein für eine neue, von der altirischen Christ Church unabhängige Kathedrale legte, dafür einen so ungünstigen Bauplatz wie das Sumpfland am heute kanalisierten Poddle ausgewählt? Das Grundwasser stand hier so hoch, dass für Irlands größte Kirche besonders schwere Fundamente notwendig waren. Der Ort muss dem Bischof so wichtig gewesen sein, dass er die Bedenken seiner Baumeister in den Wind schlug und auch auf eine Krypta verzichtete.
Der Legende nach hatte hier bereits St Patrick eine Kapelle und taufte die Menschen mit dem Wasser einer heiligen Quelle. Der 1254 völlig umgestaltete und 1864 nochmals umgekrempelte Bau stand zunächst unter einem unglücklichen Stern: Ein Turm stürzte ein, aufgebrachte Bürger zündeten die Kirche an, Cromwell benutzte das Gotteshaus als Pferdestall, Jakob II. als Kaserne.
Innen ist die Kirche mit den klaren Proportionen eines lateinischen Kreuzes sehr viel eleganter, als sie äußerlich verspricht. Der Stein von Patricks Quelle liegt in der Nordwestecke neben dem Aufgang zum Turm. Die Dauerausstellung „Living Stones“ rekapituliert die Geschichte des Gotteshauses und widmet sich auch ausführlich dem berühmtesten Domherren, Jonathan Swift. Mit seiner wohl stets nur platonischen Geliebten Esther („Stella“) Johnson fand er gleich neben dem Haupteingang seine letzte Ruhestätte. Das zweite, auffälligere Grabmal (1632) am Eingang zeigt Richard Boyle, den Earl of Cork, nebst Frau und elf seiner Kinder. Der kleine Dicke in der Mitte der unteren Reihe ist Robert Boyle (1627-91), Physiker und Entdecker des Boyle-Mariotteschen Gesetzes vom Zusammenhang zwischen Druck und Ausdehnung von Gasen. Das Monument stand zunächst neben dem Hauptaltar, doch der Vizekönig Thomas Wentworth fand es schon 1633 unzumutbar, sich vor dem Earl, seiner Frau und besonders „den Nymphen von Töchtern, mit schulterlangem, offenem Haar“ niederzuknien, die ihn offenbar vom Gebet ablenkten. Der gekränkte Earl of Cork arbeitete daraufhin am Sturz des Vizekönigs und brachte ihn schließlich aufs Schafott.
♦ März-Okt. Mo-Fr 9-17, Sa 9-18, So 9-10.30, 12.30-14.30 und 16.30-18 Uhr. Nov.-Febr. Mo-Sa 9-17, So 9-10.30 und 12.30-14.30 Uhr. Eintritt 8 €. Buslinien 27, 54 A, 77 A, 150, 151 via Hawkins St. www.stpatrickscathedral.ie.
Marsh Library
Die von Erzbischof Narcissus Marsh 1707 eröffnete Bibliothek ist die älteste öffentliche Bücherei Irlands und seit den Gründerjahren kaum verändert. Swift arbeitete hier oft, einige Bücher tragen noch seine Randbemerkungen, auch Joyce las in den alten Schätzen. In den dunklen Eichenholzregalen ruhen zwar nur 25.000 Bände, diese wurden jedoch fast alle im 17. Jh. oder noch früher gedruckt. Wertvollster Schatz ist eine Cicero-Ausgabe von 1472. Bücherklau gab es wohl schon damals. Wie sonst ist zu erklären, dass die Benutzer von besonders seltenen und wertvollen Manuskripten während der Arbeit in drei Nischen eingeschlossen wurden?
♦ Di-Sa 10.30-16.30 Uhr. Eintritt 5 €. Buslinien wie St Patrick’s Cathedral. St Patrick’s Close. www.marshlibrary.ie.
Teeling Whiskey Distillery
Kein Museum, sondern eine hochmoderne Whiskey-Brennerei, in der nach langer Pause im Dubliner Stadtgebiet wieder Whiskey gebrannt wird. Den Standort am Newmarket haben die Teeling-Brüder bewusst gewählt, arbeiteten dereinst im „Golden Triangle“ der Liberties doch zwei Dutzend Brennereien. Auf der Führung werden die Besucher in die Geheimnisse der Whiskey-Herstellung eingeweiht, sehen in den Gärbottichen die Hefebakterien bei der Arbeit und wie das Lebenswasser durch die imposanten Kupferbirnen „Alison“, „Natalie“ und „Rebecca“ sprudelt. Wer auf den Geschmack gekommen ist, kann sich anschließend in der Bar und im Shop mit Premium-Whiskey eindecken.
♦ Tägl. 10-17.30 Uhr (Beginn letzte Führung). Führung mit Verkostung 15-30 €. Bus 27, 77A, 150, 151 via College Green. Newmarket, www.teelingdistillery.com.
Christ Church Cathedral
Wie Saint Patrick’s hat auch die ältere der beiden mittelalterlichen Kathedralen in der viktorianischen Ära eine freizügige Restaurierung über sich ergehen lassen müssen. Auf der Verkehrsinsel, um die heute unzählige Straßen herumführen, stand seit 1038 die erste, aus Holz gebaute Bischofskirche. Zwischen ihr und der Liffey befand sich die Handelsniederlassung der Wikinger und damit die Keimzelle der mittelalterlichen Stadt. Ihre Reste wurden in den 70er-Jahren bei Sanierungsarbeiten freigelegt - und mit der Fundamentierung der neuen Bürogebäude weitgehend zerstört.
Richard Strongbow, der Führer der normannischen Invasoren, ließ die hölzerne Wikingerkirche nach 1172 durch einen Steinbau im romanisch-gotischen Übergangsstil ersetzen, der auch eine Art Denkmal für den britischen Griff nach Irland ist. Heinrich VII. eröffnete hier die irische Reformation, indem er St Patrick’s Bischofsstab, die kostbarste Reliquie der Kirche, öffentlich verbrennen ließ. Irland rächte sich auf seine Art. 1562 brach die schlecht gegründete Südwand zusammen und zerschlug dabei auch das Grabmal mit der Statue des Strongbow, die als ein amputierter Torso neben dem Grab lag. Das heutige Monument ist eine Nachbildung aus der Zeit nach dem Unglück. Mit dem steinernen Strongbow als Zeugen schlossen seit alters her die Dubliner Kaufleute wichtige Verträge ab.
Der am besten erhaltene Teil der Kirche ist die Krypta. Zu Cromwells Zeiten ging es hier hoch her: Damals war sie ein überdachter Markt mit Läden und Tavernen. Später diente der Keller als Abstellplatz für allerlei Dinge, die oben im Wege waren, aber doch irgendwie zu wertvoll oder zu sperrig, um sie einfach wegzuwerfen. Jüngst wurde das Gewölbe mit viel Aufwand zu einem Ausstellungsraum umgebaut, in dem neben alten Grabplatten, Architekturfragmenten und dem Kirchenschatz auch ein Videofilm gezeigt wird. Berühmteste Kuriosität des Kellers ist jedoch jene mumifizierte Katze auf der Jagd nach einer genauso eingetrockneten Ratte, die sich in eine Orgelpfeife geflüchtet hatte - der Jäger blieb stecken und versperrte damit auch dem Opfer den Fluchtweg, ohne dieses erreichen zu können.
♦ Juni-Aug. Mo-Sa 10-19, So 12.30-14.30 und 16.30-18 Uhr. Nov.-März Mo-Sa 10-17, So 12.30-14.30 Uhr. April/Mai und Sept./Okt. Mo-Sa 10-18, So 12.30-14.30 Uhr. Einlass bis 45 Min. vor Schließung. Eintritt 7,50 €. www.christchurchcathedral.ie.
Christ Church: Dublins älteste Kathedrale
Dublinia
Die Mittelaltershow im früheren Bischofspalast, in dem zuletzt eine Disco eingerichtet war, ist eine kleine Entschädigung für die am Wood Quay vergebene Chance, wenigstens einen Teil der beim Bau des neuen Rathauses freigelegten Reste der Wikingerstadt für die Nachwelt zu erhalten. Die Zeitreise beginnt nach einer Orientierung zu den Anfängen mit dem Gang über den mittelalterlichen Markt der Stadt, mit Ständen und Buden lebensgroß und lebensecht nachgestellt bis hin zu einem knurrenden Hund. Alles darf, sehr zur Freude der Kinder (und auch der Erwachsenen), angefasst werden - immerhin stehen für den Wurf auf den im Pranger zu Schau gestellten Missetäter nicht mehr wie anno dazumal Kot und Steine, sondern Softbälle zur Verfügung.
Ein maßstabgerechtes Modell zeigt das alte Stadtbild, das man mit dem (realen) Panorama vom Turm des Hauses vergleichen kann. Anschließend wird man mit der Rekonstruktion eines Kais und eines Kaufmannshauses konfrontiert, auf dessen Küchentisch die Speisen angerichtet sind, als begäben sich die Puppen im nächsten Moment zum Dinner. Gelungen ist die Einbeziehung der Toiletten - wer auf das Örtchen muss, wird nebenbei über mittel-alterliche Latrinen und Sanitäranlagen aufgeklärt. Im Museumsraum sind ein paar Kleinfunde vom Wood Quay präsentiert, nebenan erfährt man einiges über die Arbeitsweise der Stadtarchäologen. Der oberste Stock ist den Wikingern gewidmet. Hier kann man seinen Namen in Runen schreiben. Auch die Vereinnahmung der Nordleute durch die faschistische Bewegung wird nicht ausgespart.
♦ Tägl. 10-18.30 Uhr (Okt.-Febr. bis 17.30 Uhr), Einlass bis 1 Std. vor Schließung. Eintritt 12 €, mit Christ Church 18 €. St Michel’s Hill, High St, www.dublinia.ie.
Ein geknechteter Kuttenträger in der Dublinia
Saint Audoen’s Churches
Dank der Kirchenspaltung hat der Heilige gleich zwei Kirchen. Die ältere (12./14. Jh.) und zugleich kleinere gehört der Church of Ireland und ist die einzige erhaltene mittelalterliche Pfarrkirche Dublins. An der Stelle des Nebenschiffs stand einst eine keltische Kapelle. St Audoen’s Arch, in einer schmalen Passage neben der Kirche, ist das letzte Tor der alten Stadtbefestigung. Der jüngere Bau, ein katholisches Gotteshaus, wurde 1847 fertig gestellt.
♦ Mai-Okt. tägl. 9.30-17.30 Uhr, Einlass bis 16.45 Uhr. Eintritt frei. Cook St.
Guinness-Brauerei / Kilmainham
Guinness-Brauerei
Schon an der St Audoen’s Church wird die empfindliche Nase bei Westwind mit dem Malzgeruch aus Irlands größter Brauerei konfrontiert. Seit dem 12. Jh. brauten Mönche (wer sonst?) vor dem James Gate. 1759 erwarb Arthur Guinness das Gelände der Rainsford Brauerei, und seine Nachfolger erweiterten die Produktionsstätten Zug um Zug auf heute 26 ha, eine surreale Metropolis mit qualmenden Schloten, ameisengleich geschäftigen Arbeitern und besagten Gerüchen. Bis 1965 dampfte eine Werksbahn durch das Gelände - eine der ungewöhnlichen Lokomotiven mit oben liegenden Ventilen ist im Werksmuseum ausgestellt. Früher brachten Schiffe die Gerste über die Liffey und einen Nebenarm vom Grand Canal und luden für den Rückweg die Fässer mit Stout ein, die an die Pubs überall im Land geliefert wurden. Zur Versorgung des britischen Marktes verfügt Guinness bis heute über eine eigene Hochseeflotte.
Die inzwischen dem Spirituosen-Weltkonzern Diageo gehörende Brauerei selbst kann nicht besichtigt werden. Das Storehouse Visitor Centre in einem umgebauten Gärhaus der Jahrhundertwende erzählt jedoch die Firmengeschichte und erläutert die Produktion der täglich 2,5 Millionen Pints. Branchenfremden dürfte es allerdings schwer fallen, die Besonderheiten bei der Herstellung des dunklen Stout nachzuvollziehen. Abschluss und Höhepunkt der Tour ist ein Bier in der Gravity Bar, im Turm mit Rundum-Panoramablick über Dublin. Hier in luftiger Höhe wird, so jedenfalls die Einschätzung der Brauerei, das beste Bier der Welt am besten gezapft. „Good for you?“
♦ So-Do 11.30-19 Uhr (Einlass bis 17 Uhr), Fr/Sa bis 21.30 Uhr (Einlass bis 20 Uhr). Eintritt mit Drink 15-25 €. www.guinness-storehouse.com. Crane Lane off James St. Zu erreichen mit Bus Nr. 13, 40, 123 ab O’Connell St, Luas Red Line Station James’s.
Pearse Lyons Distillery
Nur einen Steinwurf vom Guinness Storehouse entfernt kann man die neue Whiskeybrennerei von Pearse Lyons besichtigen. Der in Irland aufgewachsene Chef des Tierfutterherstellers Alltech besitzt neben Bierbrauereien auch eine Brennerei in Kentucky. Seine Dubliner Destillerie ist in der lange ungenutzten und verfallenen St James’s Church eingerichtet. Besonders stolz ist man auf die restaurierten Glasfenster und die gläserne Spitze des Kirchturms. Abends beleuchtet, ist diese „Liberties Lantern“ ein von weit her sichtbares Wahrzeichen des Viertels.
♦ Mo-Sa 9.30-17 (Beginn letzte Führung), So ab 11.30 Uhr; Führung mit Verkostung ab 20 €. www.pearselyonsdistillery.com. 121 James’s St, zu erreichen wie Guinness Storehouse.
Museum of Modern Art (IMMA)
Das Royal Hospital Kilmainham wurde 1680-87 nach dem Vorbild des Londoner Chelsea Hospital oder der Pariser Les Invalides als Alten- und Invalidenheim für Soldaten gebaut. Der Grundriss von Dublins erstem klassizistischen Gebäude ist so einfach wie genial: ein Rechteck mit zum Innenhof offenen Kolonnaden. Seinerzeit gab es einen Sturm der Entrüstung, dass ein so prächtiges Gebäude ausgemusterten Kriegern zur Verfügung stünde. 300 Jahre später war die Umwidmung zu einem Kunstmuseum nicht weniger umstritten. Doch längst ist das IMMA zu einem Schaufenster irischer Gegenwartskunst für die Welt und zugleich internationaler Kunst für die Iren geworden. Außer einer kleinen Dauerausstellung zeigt das Museum in der Hauptsache mehrere Monate dauernde Wechselausstellungen, auch Konzerte und Diskussionen gehören zum Programm.
♦ Di-Fr 11.30-17.30, Sa 10-17.30, So 12-17.30 Uhr. Einlass bis 15 Min. vor Schließung; Eintritt frei. Mit Kunstbuchhandlung und Cafeteria. Bus Nr. 79 A ab Aston Quay, 123 via O’Connell St, Luas Red Line Station James’s. Military Rd, Nähe Heuston Station. www.imma.ie.
Kilmainham Gaol
Ein Schlangenrelief über dem alten Eingang lässt uns an die Höllenbrut denken. Das frühere Staatsgefängnis wurde 1795 gerade rechtzeitig fertig, um die von den Briten gefangenen United Irishmen aufzunehmen. Andere „Aufrührer“ wie die Fenians, die Agitatoren der Land League, zuletzt die Aufständischen von 1916 folgten; es gibt kaum einen irischen Nationalhelden, der nicht für einige Zeit in Kilmainham gesessen hätte. Letzter Häftling war der spätere Präsident Eamon de Valera, und schon daraus erklärt sich, dass das Gefängnis heute eine nationale Gedenkstätte ist. Weniger bekannt ist, dass zuletzt nicht mehr die Briten, sondern die irischen Bürgerkriegsparteien hier ihre Gefangenen einkerkerten und erschossen. Doch nicht nur „Politische“, auch gewöhnliche Kriminelle waren hier eingesperrt und warteten in winzigen Zellen auf ihre Deportation oder gar Hinrichtung.
Die Tour beginnt im Courthouse. Bis 2008 wurde hier Recht gesprochen, und wer einmal in einem deutschen Gerichtssaal war, dem wird als Unterschied auffallen, dass der Richter in Kilmainham quasi gottgleich über dem Bösewicht thronte. Vom Gericht geht es gleich weiter ins Gefängnis. Höhepunkte der Führung sind hier die Kapelle, in der Joseph Plunkett, einer der Anführer des Osteraufstands, am 4. Mai 1916 morgens um 1.30 Uhr mit Grace Gifford getraut wurde -, und der Exekutionshof, wo man ihn zwei Stunden später erschoss. Ein angeschlossenes Museum erklärt die Geschichte des Knasts und des viktorianischen Strafvollzugs.
♦ Sept.-Mai tägl. 9.30-17.30 Uhr, Juni-Aug. bis 19 Uhr; Einlass bis 75 Min. vor Schließung. Online-Reservierung erforderlich. Eintritt mit Führung 8 €. Bus Nr. 79 ab Aston Quay; Nr. 69 ab Hawkins St. Inchicore Rd, www.kilmainhamgaolmuseum.ie.
Kilmainham Gaol: eine Kathedrale des Strafvollzugs
North Side
Seit bald 750 Jahren überspannen Brücken die Liffey, die die Dubliner naserümpfend „Sniffey“ nennen, doch der Fluss trennt heute mehr denn je. Er ist die Barriere zwischen Arm und Reich, elegant und vulgär, zwischen Hochkultur und billigem Videoentertainment, Sanierung und Verfall.
Vor allem in den Köpfen der Menschen von der South und der North Side existiert diese Barriere, die sie den jeweils anderen Stadtteil ignorieren lässt. Für die kleinen Leute ist, auch wenn sie in den Vorstädten wohnen, die nördliche Innenstadt das bevorzugte Ziel für größere Einkäufe und die Abendunterhaltung. Die aufstrebende Mittelklasse aus den südlichen Vororten jedoch fürchtet die heruntergekommene North Side, in der zwei Drittel aller Verbrechen der Stadt begangen werden, wie der Teufel das Weihwasser und weiß damit nicht anders umzugehen, als sie zur schier unerschöpflichen Quelle von Witzen zu machen.
Ihre beste Zeit hatte die North Side im 18. Jh. Die ersten georgianischen Prachtbauten entstanden am Parnell und Mountjoy Square, in der Gardiner und O’Connell (damals: Drogheda) Street. Doch bald eroberte sich das Volk die Viertel, und der Herzog von Leinster setzte 1745 ein für die Stadtentwicklung schicksalhaftes Signal, indem er seinen neuen Palast auf dem Südufer baute. „Es war ungefähr so wie bei einer Fuchsjagd, wo aber zur Abwechslung mal der Adel der Gejagte war und ständig versuchte, sicheren Abstand zwischen sich und der benachteiligten Mehrheit zu halten“, charakterisierte der Dubliner Schriftsteller Brendan Behan einmal die Stadtentwicklung der letzten drei Jahrhunderte. Lange blieb die North Side weitgehend sich selbst überlassen, erst in jüngster Zeit hat sie mit einer Fußgängerzone um die O’Connell Street wieder etwas Attraktivität gewonnen. Auch das neue Konferenzzentrum soll in diesem Teil der Stadt entstehen.
Custom House
James Gandon war nach Richard Cassels der zweite Stararchitekt Dublins und prägte mit seinen klassizistischen Monumentalbauten maßgeblich das Gesicht der Stadt am Ufer der Liffey. Custom House (1781-91) war sozusagen sein Gesellenstück, dem später noch die Four Courts und die King’s Inns folgten. Im Schatten der Eisenbahnbrücke und des Internationalen Finanzzentrums kommt das Zollhaus, ungeachtet seiner stolzen Länge von 114 m und der mächtigen Kuppel, heute nicht mehr recht zur Geltung. Der beste Blick bietet sich von der anderen Flussseite aus.
O’Connell Street
Die nach dem Freiheitshelden Daniel O’Connell benannte Straße als breitesten Boulevard Europas zu bezeichnen, wie es manche Dubliner und besonders die Fremdenführer tun, ist eine kühne Übertreibung und der Versuch, einmal auch die North Side mit einem Superlativ zu schmücken - belassen wir es bei der mit 45 m breitesten Straße Irlands.
Von der Flussseite her blickt der „Liberator“ als Bronzestatue über seine Straße, am oberen Ende grüßt Charles Stewart Parnell - mehr zu seiner Person im Geschichtskapitel. In der Mitte, etwa auf Höhe der Post, stand der britische Seeheld Lord Nelson, bis ihn die IRA 1966 sprengte. Seinen Platz nimmt nun die Millenium Spire ein, ein 120 Meter hoher und 4 Millionen Euro teurer Leuchtturm aus Edelstahl - als wäre Dublin nicht hell genug oder gar zu übersehen, oder als bedürften die zahlreichen Heroinsüchtigen eines Denkmals in Form einer Nadel. An der Ecke zur Earl Street stehen James Joyce und vor dem Gresham-Hotel Theobald Matthew (1846-91), der Begründer der irischen Abstinenzlerbewegung und angesichts der irischen Neigung zu Bier und Whiskey ein Don Quichotte der Grünen Insel.
Daniel O’Connell hoch über den Passanten
General Post Office
Das General Post Office war Schauplatz des Osterputsches von 1916. Von der Eingangstreppe verlas Patrick Pearse am Ostermontag die Unabhängigkeitserklärung. Im Fenster der Schalterhalle ehrt eine Bronzestatue des mythischen Helden Cuchulainn die Aufständischen. So schön kann das Sterben sein! (Wenigstens in der Kunst). An den Säulen der Hauptfassade konnte man bis zur jüngsten Instandsetzung noch die Einschlagsmarken der Geschosse ausmachen, und was die britische Armee 1916 nicht schaffte, erledigten sechs Jahre später die Bürgerkriegsparteien. Erst 1929 wurde die Post wieder eröffnet und bildet seitdem die bevorzugte Kulisse für nationale Paraden und Demonstrationen. Zum hundertjährigen Jubiläum des für die irische Nation identitätsstiftenden Putsches wurde auf der Nordseite der Schalterhalle die multimediale Ausstellung GPO Witness History eingerichtet. Umgeben von Touchscreens, Schautafeln und mit dem Aufstand verbundenen Artefakten lässt eine filmisch-theatralische Inszenierung das Geschehen lebendig werden. Eine Schauwand im Cafébereich versucht dann den Bogen bis in die Gegenwart zu spannen.
♦ Tägl. 10-17.30 Uhr, Juli/Aug. Mi-Fr bis 18.30 Uhr; Einlass bis 1 Std. vor Schließung. Eintritt 15 €. www.gpowitnesshistory.ie.
Moore Street und Chinatown
Die Moore Street, ein Block westlich der O’Connell St, ist Standort des beliebtesten Marktes der Stadt. Die alte Markthalle wurde allerdings durch ein modernes Shopping Centre ersetzt und die andere Straßenseite ist eine einzige Baustelle, sodass der Ort, ungeachtet des nach wie vor pittoresken Straßenmarktes vor dem Einkaufszentrum, etwas an Charme verloren hat. Zwei Blocks weiter hat sich im Ostteil der Parnell Street Dublins Chinatown entwickelt. Ursprünglich war die O’Connell Street nach Henry Moore, Earl of Drogheda, benannt; nach der Umbenennung zugunsten des Freiheitshelden sind dem Earl immerhin noch Henry Street, Moore Street, Earl Street, und, kein Scherz, sogar eine Off Lane verblieben.
St Mary’s Pro-Cathedral
Die katholische Kathedrale (1816-25) an der Ecke Cathedral und Marlborough St firmiert noch immer als provisional, „vorübergehende“ Bischofskirche. Dublins Katholiken fordern die Rückgabe der protestantischen Christ Church. Sie haben nie vergessen, dass ihr eigenes Gotteshaus damals auf englischen Druck eine Zeile hinter der prominenten O’Connells Street in einer so schmalen Straße errichtet werden musste, die die Fassade mit ihren dorischen Säulen überhaupt nicht zur Geltung kommen lässt. Die Pläne stammten von einem französischen Architekten, der auch die Pariser Kirche St Philippe du Roule erschuf. Zu allem Überfluss war die Gegend um die Marlborough Street, bei Joyce heißt sie „Nighttown“, um 1900 das Rotlichtviertel Dublins. Gegenüber der Kathedrale steht mit dem Tyrone House ein schönes Stadthaus von Richard Cassels.
James Joyce Centre
Das Haus war einst die Tanzschule des Denis Maginni, der uns im Ulysses als „professor of dancing“ begegnet. Als neuer Tempel der Joycianer zeigt es unter prächtigen Stuckdecken Dokumente und Fotos aus dem Leben des Meisters, dazu gibt’s Lesungen oder Rundgänge auf den Spuren Leopold Blooms. Bei flackerndem Kaminfeuer sieht man ein Video zum Leben des Meisters, der seiner Heimat früh den Rücken kehrte und vorwiegend in der Emigration über Dublin schrieb. Dem Centre angeschlossen sind eine einschlägige Bibliothek und Buchhandlung.
♦ Mo-Sa 10-17, So 12-17 Uhr (Okt.-März Mo geschl.). Einlass bis 30 Min. vor Schließung. Eintritt 5 €. 35 North Great George St, www.jamesjoyce.ie.
Parnell Square
„Niemand hat das Recht, den Weg einer Nation aufzuhalten“, wird Parnell in der Sockelinschrift seines Denkmals am oberen Ende der O’Connell Street zitiert. Ein Zusammenhang mit der Frauenklinik Rotunda (1757), auf die das Standbild weist, war sicher nicht beabsichtigt, doch lässt sich der sinnige Spruch auch als päpstliche Mahnung an Mütter und Ärzte interpretieren. Die Rotunda war die erste Geburtsklinik der Britischen Inseln. Der Ersparnis halber verwendete Richard Cassels teilweise erneut die Pläne des Leinster House, die Ähnlichkeit ist also kein Zufall. Mit Lotterien, Bällen und Konzerten in den Assembly Rooms hinter dem Spital, wo heute das Gate Theatre spielt, sammelte Dr. Bartholomew Mosse seinerzeit das Geld für die Klinik. Der Garden of Remembrance, in dem heute des Osteraufstands gedacht wird, ist alles, was von Mosses üppigen Grünanlagen übrig blieb. Die Rotunda im engeren Sinn, die runde Haupthalle, ist heute das Ambassador-Theater, doch die anderen Gebäude sind noch immer ein Krankenhaus.
City Gallery The Hugh Lane
Zusammen mit den Nachbarhäusern zeigt die Fassade der städtische Kunstgalerie schön den bruchlosen Übergang von der klassizistischen Landhaus- zur vierstöckigen Backsteinarchitektur des georgianischen Dublin. Die mit sehenswerten Werken französischer Impressionisten und irischer Malerei bestückte Ausstellung geht auf eine Stiftung des Kunstsammlers Hugh Lane zurück, der 1915 beim Untergang der Lusitania starb. Lane vermachte seine Schätze „der Nation“, was nach der irischen Unabhängigkeit eine zweideutige Festlegung war. Welcher Nation? Der britischen oder der irischen? 1959 wurde die Sammlung geteilt, eine Hälfte ist in der Londoner Tate-Galerie ausgestellt. Eine besondere Attraktion der Galerie ist das nachgebaute Atelier (oder soll man besser sagen: das rekonstruierte Chaos) des in Dublin geborenen Malers Francis Bacon (1909-1992). In einem einleitenden Interview beschreibt der Künstler seine Arbeitstechnik, per Bildschirm kann man in einer Datenbank mit den vielen tausend im Atelier gefundenen Objekten wühlen.
♦ Di-Do 10-18, Fr/Sa 10-17, So 11-17 Uhr; Eintritt frei. 22 North Parnell Sq, www.hughlane.ie.
Dublin Writers Museum
Mit gleich vier Nobelpreisträgern - George Bernard Shaw, William Butler Yeats, Samuel Beckett, Seamus Heaney - und weiteren literarischen Größen wie Jonathan Swift, Oscar Wilde, Sean O’Casey, Brendan Behan und last not least James Joyce ist Dublin Europas heimliche Literaturhauptstadt. Das 1991 eröffnete Museum unterstreicht diesen Anspruch mit Memorabilia wie beispielsweise Behans Schreibmaschine, Manuskripten und Erstausgaben. Die Einrichtung des Obergeschosses gibt zugleich einen guten Eindruck von dem an der Antike orientierten Zeitgeschmack der irischen Aristokratie des 18. Jh. Etwas kurz kommen allerdings die modernen Autoren - das Museum vermittelt den falschen Eindruck, als sei das literarische Schaffen mit dem Zweiten Weltkrieg abrupt abgebrochen. Dass dem nicht so ist, würde man nebenan in dem der Öffentlichkeit nicht zugänglichen Irish Writers’ Centre erfahren, das mit Arbeitsräumen, Seminaren und Lesungen ein Treffpunkt der noch lebenden Schriftsteller ist.
♦ Mo-Sa 10-17, So 11-17 Uhr. Einlass bis 16.15 Uhr. Eintritt 7,50 €. 18 North Parnell Sq. www.writersmuseum.com.
14 Henrietta Street
Die lange vernachlässigte Henrietta Street gilt als eines der schönsten georgianischen Ensembles der Stadt. Nr. 9 und 10 wurden von Edward Pearce gebaut. Als die nach Gardiners Tochter Henrietta benannte Straße in die Jahre kam, wurden die Bewohner zahlreicher und weniger vornehm. Miethaie übernahmen die Häuser, teilten die großen Räume mit Zwischenwänden weiter auf und vermieteten die entstandenen Verschläge an arme Familien. So pferchte der Bauunternehmer und Stadtrat Joseph Meade allein in das Haus Nr. 7 etwa 70 Menschen.
Haus Nr. 14 wurde zu einem Museum renoviert, das die Geschichte der Straße und das Schicksal der meisten georgianischen Häuserzeilen in Dublin nacherleben lässt: Errichtet als repräsentative Stadtwohnungen für die politische und wirtschaftliche Elite, verkamen sie später zu Mietskasernen für arme Leute. So beginnt die Führung durch das 1749 erbaute Haus in der Belle Etage mit dem Salon von Lord Viscount Molesworth und seiner Familie. Er ist unmöbliert, nur ein maßstabgetreues Modell des Hauses und die in den Putz eingebetteten Musikinstrumente deuten auf die frühere Pracht des Hauses hin. Und sie endet im letzten Raum mit der kleinbürgerlichen Idylle einer Wohnung der 1950er-Jahre, symbolhaft das Nebeneinander von Porzellanfiguren der Gottesmutter und von chinesischen Hunden. Der Ausstellung fehlen die interaktiven Animationen, wie man sie vom Emigration Museum oder von Titanic Belfast kennt, viele Räume sind noch leere Hüllen, die nur notdürftig mit kurzen Filmen gefüllt werden. Umso mehr hängt am Geschick der Führer(innen), das Haus mit Leben zu füllen.
♦ Führungen Mi-So 10-16 Uhr jeweils zur vollen Stunde, Online-Buchung angeraten. Eintritt 9 €. 14 Henrietta St, www.14henriettastreet.ie. Luas-Station Dominick St.
Four Courts
Das Meisterwerk unter den georgianischen Repräsentativbauten entstand 1786-1802. An einem Werktag fühlt man sich in der Halle zwischen den auf ihre Verhandlung wartenden Juristen mit schwarzen Kutten und Löckchenperücken in eine vergangene, unheimliche Welt versetzt. Wie das Custom House trägt der Sitz von Irlands höchstem Gericht klassizistische Züge, strebt aber mehr in die Höhe. Über einem Zentralbau mit korinthischen Säulen thront eine Dachtrommel mit flacher Kuppel. Von ihm gehen Seitenflügel aus, die vier Höfe einfassen - daher der Name des Gebäudes. Auch die Four Courts wurden im Bürgerkrieg in Schutt und Asche gelegt, in den 1930er-Jahren aber wieder aufgebaut. Die vielen Statuen haben unter Abgasen und saurem Regen sichtbar gelitten.
♦ Die Gerichtsverhandlungen sind in der Regel öffentlich. Prozessiert wird Mo-Fr 11-13 und 14-16 Uhr.
Saint Michan’s Church
Attraktion der 1095 gegründeten, seither vielfach umgebauten Kirche ist ihre düstere Gruft, deren trockene, methanhaltige Luft die ungewöhnliche Eigenschaft hat, Leichname zu konservieren. Ein fußloser „Kreuzritter“, der allerdings „nur“ 300 Jahre alt ist, und drei weitere Leichname liegen offen. In einem anderen Raum stapeln sich die Särge der Grafen von Leitrim, und in einer dritten Gruft liegt hinter hingerichteten Rebellen die Totenmaske des Freiheitskämpfers Theobald Wolfe Tone. Die Gewölbe sind seit dem 19. Jh. eine Publikumsattraktion und haben Bram Stoker zu seinem Dracula-Roman inspiriert. Weniger beachtet wird die schöne Orgel oben in der Kirche - angeblich hat schon Händel hier gespielt, wofür es aber keine Belege gibt. Das aus einem Stück geschnitzte Paneel der Orgelbalustrade zeigt Musikinstrumente der Barockzeit.
♦ März-Okt. Mo-Fr 10-12.30 und 14-16.30, Sa 10-12.30 Uhr. Nov.-Febr. Mo-Fr 12.30-15.30, Sa 10-12.30 Uhr; Eintritt 7 €. Church St.
Smithfield Village
Westlich der Four Courts erblühte die Industriebrache der früheren Jameson-Destillerie zu neuem Leben. Ein Investor überbaute den Block mit einem futuristischen Ensemble schicker Apartmenthäuser und rüstete den alten Schornstein The Chimney zum Aussichtsturm um - da der Fahrstuhl seit geraumer Zeit stillgelegt ist, sind 244 Stufen zu erklimmen (Tickets im Generator Hostel, 5 €). Freitagabends erstrahlt der Platz in besonderem Glanz, dann flammen die Fackeln hoch oben auf den gigantischen Lichtmasten. Reflektierende Segel werfen das Licht von Strahlern an die angrenzenden Hausfassaden.
Die von portugiesischen Arbeitern mit 300.000 Kopfsteinen gepflasterte Freifläche ist am ersten Sonntag im Mai und September Schauplatz des Dubliner Pferdemarktes, des proletarischen Gegenstücks zur Dublin Horse Show. Händler und Käufer sind Bauern aus der Umgebung, Traveller und einfache Leute, oft Jugendliche aus der Nordstadt, die dort mit ihren Tieren inoffizielle Rennen veranstalten.
Old Jameson Distillery
Auf dem Gelände der 1971 geschlossenen und abgerissenen Schnapsfabrik wurde ein Brennerei-Museum installiert. Nach einem einführenden Propagandafilm über den glorreichen Firmengründer John Jameson erfährt man auf einer unterhaltsamen Führung anhand von Repliken mehr über die Stationen der Whiskey-Herstellung, auch eine Probe in der Whiskeybar und ein Souvenirshop gehören selbstverständlich dazu. Und man wird das Gefühl nicht los, gerade auf einer Werbeveranstaltung für Spirituosen zu sein und dafür auch noch bezahlt zu haben.
♦ Führungen: Tägl. 10-17.30 Uhr (Beginn letzte Führung), Fr/Sa bis 19 Uhr. Eintritt mit Degustation ab 20 €. Bow St, Bus Nr. 83 via Westmoreland St; Luas-Station Smithfield. www.tours.jamesonwhiskey.com.
Die Whiskeybar der Old Jameson Distillery
Collins Baracks
Mit 226 Jahren (1701-1997) ununterbrochener militärischer Nutzung beansprucht die Kaserne einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde. Auch der für sechs Regimenter geeignete Exerzierplatz ist wegen seiner Größe rekordverdächtig. Einen Teil des weitläufigen Gebäudes hat das National Museum of Decorative Arts & History bezogen. Diese Außenstelle des Nationalmuseums zeigt allerlei Artefakte wie Glaswaren, chinesische Porzellane, Textilien, Musikinstrumente und Möbel. Besonders sehenswert sind die 25 Exponate im Raum Curator’s Choice - die Direktoren der führenden Museen Irlands stellen hier ihre Lieblingsobjekte aus, etwa das Hochzeitsgeschenk Oliver Cromwells an seine Tochter. Out of Storage zeigt eine eklektizistische Sammlung von japanischen Rüstungen bis hin zu Edinson’schen Phonographen, allesamt mithilfe von Touchscreen-Computern erläutert.
♦ Di-Sa 10-17, So/Mo 13-17 Uhr. Eintritt frei. Luas Station Museum. www.museum.ie.
Tierschutz oder Schikane?
„Acht Smithfield-Pferde im Hinterhof gehalten!“ „Smithfield-Pferde für die Schlachter in Frankreich!“ Solche und ähnliche Schlagzeilen der Boulevardpresse haben den Pferdemarkt in Verruf gebracht. Ein neues Gesetz reglementiert die nicht unbedingt artgerechte Pferdehaltung der städtischen Unterschichten und gibt den Behörden die Handhabe, den pittoresken, doch mit dem Image des modernen Dublin kaum zu vereinbarenden Pferdehandel von Smithfield zu unterbinden. Besonders für die Kids aus Finglas wäre dies ein harter Schlag. Dort sind die Ponys mindestens so beliebt wie im vornehmen Foxrock - und werden vielleicht sogar noch mehr umsorgt. Denn die Jugendlichen der Nordstadt bekommen ihre etwa 2500 € teuren Pferde nicht von Papi geschenkt, sondern sparen sich das Geld vom Mund ab oder züchten die Tiere. Nur an genügend Platz zum Ausreiten fehlt es dem örtlichen Ponyclub. Doch die pferdevernarrten Underdogs haben, anders als die Tierschützer, keine Lobby. So darf der früher allsonntägliche Pferdemarkt jetzt nur noch zweimal im Jahr stattfinden. Unterbinden kann man den Pferdehandel kaum - die Deals laufen dann halt anderswo.
Phoenix Park
Der rund 7 km2 große Park im Westen ist die grüne Lunge Dublins. Ursprünglich zu einem Kloster gehörend, wurde er im 17. Jh. als Jagdrevier des englischen Gouverneurs eingezäunt. Bis heute bewohnt eine Herde Hirsche den Park, in dem auch die Häuser des amerikanischen Botschafters und des irischen Präsidenten stehen, beides Bauten aus dem 18. Jh. Obwohl der Phoenixpark auch einen metallenen Phoenix besitzt, der sich auf einer Säule aus den Flammen erhebt, entstand der Name als Verballhornung des gälischen Fionn Uisce, „klares Wasser“. Zum Parkgelände gehören auch die Fifteen Acres, wo sich die Herrschaften früher zu duellieren pflegten und heute harmlosere Spiele wie Kricket, Polo und Fußball zu sehen sind.
1882 erregten die Phoenixpark-Morde die Gemüter der Zeitgenossen, als eine radikale nationalistische Splittergruppe den britischen Irlandminister Lord Cavendish samt seinem Stellvertreter ermordete. Mit gefälschten Briefen versuchte die unionistische Presse, eine Verbindung zwischen den Mördern und der für die Rechte der irischen Bauern kämpfenden Land League zu konstruieren. Doch der Schwindel flog auf und beeinflusste die englische Öffentlichkeit eher im Sinne der irischen Sache.
Nahe dem Park-Street-Eingang ragt der Obelisk zu Ehren des Herzogs von Wellington knapp 63 m in den Himmel. Chronischer Geldmangel verzögerte die Vollendung des 1817 begonnenen Bauwerks bis 1861. Von der auf der Spitze geplanten Reiterstatue blieb die Nachwelt verschont. Dem Herzog war es übrigens zeitlebens eher peinlich, in Dublin geboren und damit irischer - nicht englischer - Abstammung zu sein. Nahe der Phoenix-Säule erinnert ein gewaltiges Kreuz an den Besuch Johannes Pauls II., der hier 1979 vor mehr als einer Million Menschen die Messe zelebrierte.
Wellingtons Obelisk im Phoenixpark
Das Visitor Centre neben dem restaurierten Ashtown Castle (17. Jh.) erzählt mit Ausstellung und Film die Geschichte des Parks. Hier werden auch die Tickets für den Besuch des Präsidentenpalasts Aras an Uachtarain ausgegeben.
Dublins 1830 gegründeter Zoo , einer der ältesten Europas, nimmt die Südostecke des Parks ein. Erweiterungen bescherten den einst arg eingepferchten Steppentieren eine Savannenlandschaft samt künstlichem See. Ein Löwe aus Dublin brachte es zu besonderem Ruhm: Täglich brüllt er rund um den Globus am Beginn der Metro-Goldwyn-Mayer-Filme.
♦ Visitor Centre: Nov.-April Mi-So 9.30-17.30 Uhr, Mai-Okt. tägl. 10-17.45 Uhr; Einlass bis 1 Std. vor Schließung; Eintritt frei. www.heritageireland.ie.
Führungen durch Aras an Uachtarain Sa 10-15 Uhr (Beginn letzte Führung). Nächster Busstop ist am Ashtown Roundabout der Navan Rd. Dorthin fahren die Buslinien Nr. 37, 39/A, 70 via Aston Quay, 38/A/B via O’Connell St, www.president.ie.
Zoo: März-Sept. tägl. 9.30-18, Okt. bis 17.30 Uhr, Nov./Dez. bis 16 Uhr, Jan. bis 16.30 Uhr, Febr. bis 17 Uhr. Einlass bis 1 Std. vor Schließung. Eintritt 20 €. Bus Nr. 46 A via O’Connell St, Bus Nr. 25, 26, 66 A/B ab Pearse St. www.dublinzoo.ie.
Farmleigh
Am Westende des Phoenix Park und schon außerhalb der Parkmauer steht mit dem Schlösschen Farmleigh das Gästehaus der irischen Regierung. Edward Cecil Guinness, Brauereibesitzer und Urenkel des Firmengründers Arthur, kaufte sich das Schlösschen anlässlich seiner Hochzeit 1873 und baute es so aus und um, wie man es vom reichsten Mann seiner Zeit erwarten konnte. 1999 erwarb die Regierung das marode gewordene Palais samt dem 30 ha großen Anwesen, renovierte alles mit viel Aufwand und Handarbeit. Viele der Kunstwerke und Möbelstücke, mit denen Edward Cecil Farmleigh ausstattete, befinden sich heute noch als Leihgaben im Haus.
Die weitläufigen Parkanlagen bieten ummauerte und versenkte Gärten, ein wohl temperiertes Gewächshaus, malerische Spazierwege am See und eine Vielzahl botanischer Schönheiten und Raritäten. Zu Farmleigh gehört sogar noch eine echte Farm mit einer Herde schwarzer Kerry-Kühe. Ein Uhrturm, in dem sich auch das Wasserreservoir des Landguts befindet, kündet die Zeit mit Glockenschlägen im Westminsterklang. Das alte Bootshaus wurde zum Restaurant, und in den früheren Stallungen gibt es Kunstausstellungen und im Sommer ab und an einen lebhaften Bauernmarkt.
♦ Park tägl. 10-18 Uhr, Einlass bis 17 Uhr. Führungen durchs Haus tägl. 10.15-16.15 Uhr (Beginn letzte Führung) im Stundenrhythmus. Eintritt 8 €. Bus 37 via Aston Quay bis Haltestelle Castlenock Gate, dann noch 20 Min. Fußweg. www.farmleigh.ie.