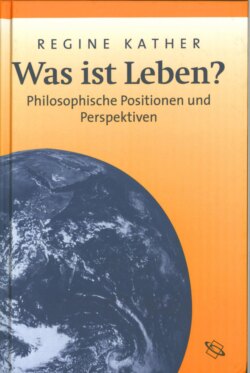Читать книгу Was ist Leben? - Regine Kather - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.1.2 Die Kette der Lebewesen
ОглавлениеDie Erkenntnis der Seele ist für Aristoteles entscheidend für die Erkenntnis von Lebewesen. Da es jedoch eine Vielfalt von Gattungen und Arten gibt, muss der Begriff der Seele differenziert werden. Die verschiedenen Formen der Beseeltheit ergeben sich aus den unterschiedlichen Funktionen, die eine Seele ausüben kann. Dann kann allerdings auch die Rede von ‘Lebendigkeit’ nicht bei allen Arten dasselbe bedeuten. Damit etwas als lebendig gilt, genügt es, wenn etwas unter der Vielfalt von Merkmalen, die man bei unterschiedlichen Lebensformen beobachten kann, mindestens ein Merkmal besitzt, so dass bereits Aristoteles eine Minimalbestimmung von Leben entwickelt. „Wenn Leben in vielfachem Sinne gebraucht wird, so sprechen wir einem Wesen Leben zu, wenn ihm auch nur eines der folgenden Dinge zukommt: Vernunft, Wahrnehmung, Bewegung und Stillstand am Ort, ferner Bewegung in der Ernährung, weiter Hinschwinden und Wachstum.“18 Dabei stellt sich allerdings die Frage, ob die Auswahl unter den Merkmalen von Lebendigkeit beliebig ist oder ob nicht verschiedene Lebensfunktionen aufeinander angewiesen sind und nur miteinander auftreten. Dieser Gedanke führt Aristoteles zu einer hierarchischen Gliederung der Lebensformen.
Unabdingbar für die physische Erhaltung des Lebens ist die Ernährung.19 Nach dieser Definition sind Pflanzen belebt; sie haben eine Grundkraft, durch die sie „Wachstum und Schwinden nach verschiedener Richtung besitzen“20. Beim Wachsen vollzieht sich keine rein quantitative Vermehrung von Materie, sondern die Herausbildung einer bestimmten Form. Wachstum ist allerdings nur durch Ernährung möglich. Eine zweite Eigentümlichkeit der vegetativen Seele ist ihre Fähigkeit zur Erzeugung gleichartiger Lebewesen, zur Fortpflanzung also. „Zeugung und Verdauung der Nahrung“21, mithin das Streben nach Selbst- und Arterhaltung, sind die einzigen seelischen Funktionen, die Pflanzen zukommen. Sie nehmen die Nahrung unmittelbar aus der Umgebung auf und haben noch keine Sinneswahrnehmungen, Triebe oder Begierden, die sie zu bestimmten Objekten hinziehen würden, und sie sind noch nicht zur Ortsbewegung fähig. Ohne dass Aristoteles selbst das Wort verwendet, darf man im Stoffwechsel und in der Selbstreproduktion die entscheidende Grundfunktion der vegetativen Seele sehen. Die Veränderung der Form, Mutagenität als die dritte moderne biologische Bestimmung von Leben, kannte Aristoteles noch nicht. Er ging von der Unveränderlichkeit der Arten aus; sie waren immer schon vorhanden und würden auch noch in einer unabsehbar fernen Zukunft da sein. Nicht als Individuen, sondern nur durch die Vermehrung, die den Fortbestand der Art sichert, können Pflanzen Anteil am zeitlos-unvergänglichen Sein gewinnen. Doch in dem Streben nach Selbst- und Arterhaltung drückt sich bereits eine Bewertung des Lebens aus: Zu sein ist besser als nicht zu sein und lebendig zu sein ist besser als unbelebt zu sein. Die vegetative Seelenfunktion ist die einfachste Form von Lebendigkeit; doch indem sie das Überleben ermöglicht, ist sie die Grundlage von Leben überhaupt und kommt notwendigerweise allen Lebewesen zu. Die Pflanzen können ohne Sinneswahrnehmung und Denken existieren; doch Menschen und Tiere können nicht ohne das vegetative Vermögen leben.22
Bei den Tieren kommt zu der anima vegetativa die anima sensitiva hinzu, die zu Sinneswahrnehmung, Ortsbewegung und Streben befähigt.23 Das wahrnehmbare Objekt affiziert das Wahrnehmungsvermögen eines Lebewesens, von ihm geht eine Wirkung aus. Das Wahrnehmungsvermögen wird erst durch Sinnesreize aktiviert. Wahrnehmungen liegen deshalb nicht im Bereich des Wollens, sondern werden – im Unterschied zum reinen Denken – erlitten. Sinneswahrnehmungen beruhen auf der Möglichkeit, von etwas anderem affiziert zu werden und diese Affektion zu empfinden. Erst durch Sinneswahrnehmungen kann ein Lebewesen etwas als von ihm Unterschiedenes empfinden; indem es anderes empfindet, empfindet es gleichzeitig sich selbst. Sinneswahrnehmungen sind wesentlich qualitativ bestimmt, es handelt sich um Farben, Töne, Gerüche oder die Härte eines Gegenstandes. Die Sinneswahrnehmungen werden noch nicht – wie später bei Descartes – in primäre und sekundäre Qualitäten unterschieden, sondern gelten als etwas, was an den Dingen selbst ist; die Frage, ob zumindest einige von ihnen erst durch das Wahrnehmungsvermögen in dieser Form konstituiert werden, stellt Aristoteles noch nicht. Für jede Art der Sinneswahrnehmung gibt es spezifische Objekte. Ein Gegenstand kann freilich auch verschiedene sinnliche Qualitäten besitzen, die von mehreren Sinnesorganen zugleich wahrgenommen werden. Dennoch erscheinen die verschiedenen Qualitäten als Bestimmungen vom selben Objekt, weil der wahrnehmende Teil der Seele nicht in eine Vielzahl disparater Seelenkräfte zerfällt; die Fähigkeit zur Unterscheidung und Verbindung der einzelnen Wahrnehmungen beruht auf einer ungeteilten Kraft. Die Wahrnehmung bezieht sich auf Unterscheidbares, das durch den Gemeinsinn zu einer einheitlichen Wahrnehmung zusammengefasst wird. Im Wahrnehmen wird jedoch nicht nur das Objekt gerochen, ertastet oder gesehen, sondern auch die Wirkung der Wahrnehmung als Schmerz oder Lust empfunden. Mit dem Wahrnehmungsvermögen ist bei Aristoteles bereits eine erste Form von Selbstempfindung verbunden. Gleichzeitig mit der Unterscheidung von Schmerz und Lust treten auch Begierde und Streben auf. Tiere versuchen schmerzhafte Situationen zu vermeiden und suchen angenehme. Damit sie dazu in der Lage sind, müssen sie freilich auch die Fähigkeit zur Ortsbewegung besitzen. Die Fähigkeit, sich zielgeleitet im Raum zu bewegen, setzt wiederum Sinneswahrnehmungen voraus; diese sind ihrerseits nur sinnvoll, wenn ein Lebewesen sich bewegen kann. Die Bewegung im Raum wird durch das Empfinden von Lust und Schmerz gelenkt, die mit den Sinneswahrnehmungen verbunden sind. Das Begehren sagt nicht, was die Dinge sind, sondern nur, ob sie zu suchen oder zu meiden sind. Doch gerade darin manifestiert sich bereits eine rudimentäre Form des Urteilsvermögens, eine Art sinnlicher Vorstellung von den Objekten. Die Wahrnehmung steht bei einfachen Lebewesen freilich immer im Dienste ihrer vitalen Lebensbedürfnisse. Die Fähigkeit, sich selbst zu bewegen, erklärt Aristoteles daher nicht als Reaktion auf äußere Reize; sie entsteht aus Bedürfnissen, Empfindungen und rudimentären Vorstellungen. Das Verhalten von Tieren kann deshalb nicht mechanisch, ohne den Rückgriff auf Ziele und Zwecke erklärt werden. Ihre Verhaltensweisen verraten dem aufmerksamen Beobachter ihre Bedürfnisse, die sie zielstrebig verfolgen. Für die Beschreibung seelischer Funktionen ist die Perspektive des erlebenden Lebewesens unverzichtbar; um ihr Verhalten zu verstehen, muss man sie, im weiten Sinne verstanden, als ‘Subjekte’ der Wahrnehmung und Empfindung betrachten, ihnen, wie Scheler sagt, ein ‘Für-Sich-und-Inne-Sein’ zugestehen.24
Der Mensch schließlich, der alle Fähigkeiten, die sich bei Pflanzen und Tieren finden, auch hat, besitzt überdies einen vernünftigen Seelenteil. Dadurch erfasst die menschliche Intelligenz Dimensionen der Wirklichkeit, die dem überwiegend instinkt-, trieb- und gefühlsgeleiteten Wahrnehmen der Tiere verschlossen sind. Die Vernunft, so zeigt Aristoteles im sechsten Buch der ‘Nikomachischen Ethik’, ist äußerst facettenreich und dient keineswegs nur dem Lösen von Problemen im Dienste des Überlebens und des Eigennutzes. Für zahlreiche Handgriffe des alltäglichen Lebens genügt die technische oder, modern gesprochen, instrumentelle Intelligenz, die Aristoteles ausdrücklich vom Handeln, von der sozialen Intelligenz oder Klugheit unterscheidet. „Hervorbringen und Handeln sind voneinander verschieden. … Gegenstand jeder Kunst ist das Entstehen, das regelrechte Herstellen und die Überlegung, wie etwas, was sowohl sein als nicht sein kann, und dessen Prinzip im Hervorbringenden, nicht im Hervorgebrachten liegt, zustande kommen mag.“25 Um etwas herzustellen, braucht man keine Werte zu berücksichtigen; es genügt zu wissen, wie man etwas machen muss, um ein Ziel zu erreichen. Wie, nach welchen Regeln etwa muss man Steine aufeinander fügen, damit ein Haus entsteht? Für Aristoteles beruht die fundamentale Differenz zwischen technischen und natürlichen Prozessen darauf, dass erstere die Idee, der sie ihre Konstitution verdanken, nicht in sich selbst haben. Der Konstruktionsplan wird von außen an ein bestimmtes Material herangetragen. Künstliche Dinge haben deshalb keine Eigendynamik, um sich zu entwickeln. Sie existieren nicht aufgrund einer inneren Notwendigkeit, sondern aufgrund eines Zieles, das von außen an ein bestimmtes Material herangetragen wird. Sie könnten sein oder auch nicht sein. Anders als organische Wesen hat das technische Erzeugnis deshalb keinen Zweck in sich; es dient als Mittel, um einen anderen Zweck zu erreichen, und ist funktional bestimmt. Ohne Zweifel muss auch in diesem Fall das Material für einen bestimmten Plan geeignet sein, aber es muss nicht der Möglichkeit nach lebendig sein.
Doch technisches Handeln genügt nicht für das Zusammenleben mit anderen Menschen. Das Ziel des Lebens liegt, so sagt Aristoteles, im Vollzug der wesenseigenen Tätigkeit. Das allen Menschen ungeachtet ihrer besonderen Neigungen und Begabungen eigentümliche Tätigsein, wodurch sie sich von anderen Lebewesen unterscheiden, liegt in der Betätigung der Vernunft. Nicht die wissenschaftliche Erkenntnis, sondern die wertorientierte Einsicht sind für das soziale Leben entscheidend. Wird auf die bestmögliche Weise und in Übereinstimmung mit der Vernunft gehandelt, dann gewinnt das Glück, das durch ein dem Menschen gemäßes Leben, durch Selbstübereinstimmung also, entsteht, seine höchste Intensität. Soziale Verhaltensweisen haben nicht nur die Funktion, das Überleben zu sichern. Für den freien Bürger, den Aristoteles im Blick hatte, war die materielle Lebenssicherung eine notwendige Bedingung des sozialen Lebens. Als Ausdruck des dem Menschen eigentümlichen Tätigseins waren das soziale Leben und die mit ihm verbundenen Tugenden ein Wert in sich. Im Handeln, der vita activa, wie Hannah Arendt sagen wird, zeigt sich gerade die Freiheit gegenüber dem zwingenden Druck der Lebensumstände. Es ist an ethische Werte wie Freigebigkeit, Mut, Gerechtigkeitssinn und Freundschaft gebunden. Doch Aristoteles entwirft kein starres Normensystem, denn jede Situation hat ihr eigenes Maß. Dieses wird nicht nur durch die streng genommen einmaligen Umstände, sondern auch durch die besonderen Fähigkeiten jedes Menschen bestimmt. Erst eine Fülle von mit Vernunft durchdrungenen Erfahrungen führt zu der Sicherheit, in den unvorhersehbaren und sich immer wieder verändernden Situationen des täglichen Lebens angemessen zu handeln. Aus dem Einklang von menschlicher Natur, Gewohnheit oder Habitus und Vernunft bildet sich die soziale Intelligenz, die Klugheit. Klugheit ist „ein untrüglicher Habitus vernünftigen Handelns … in Dingen, die für den Menschen Güter und Übel sind“26. Das – im ethischen Sinne – gute Leben wird nicht quantitativ bestimmt durch die zeitliche Dauer an Glück oder die Menge an Geld, sondern durch ein qualitatives Maß. Die Mitte zwischen den Extremen gilt als Maß für die Tugend. Die Lebensqualität lässt sich nur erhöhen, wenn die ethische Orientierung im täglichen Handeln immer besser konkretisiert wird. Anders als alle quantitativen Güter lässt sie sich unbegrenzt steigern und ist deshalb nicht mit dem bloßen Mittelmaß zu verwechseln.
Zu einem guten Leben gehört freilich auch die theoretische Lebensform, die vita contemplativa. Während die technische Intelligenz und die Klugheit auf die sinnliche Wahrnehmung und die konkreten, sich verändernden Lebensumstände zielen, richtet sich die theoretische Vernunft auf das zeitlose und unveränderliche Wesen der Dinge. Kein vitales Bedürfnis und nicht der Wunsch, ein bestimmtes soziales Ziel zu erreichen, sondern lediglich das Begehren, die Wahrheit selbst zu erkennen, sind das Movens. Der aktive Intellekt muss daher nicht mehr durch sinnliche Wahrnehmungen und Erfahrungen angeregt werden, sondern ist aus sich heraus tätig. Während die Sinnesorgane durch zu starke Eindrücke in ihrer Funktion gestört werden, kann der Geist auch übermächtige Gegenstände, die Gottheit selbst, denken. Für Aristoteles ist dies ein Beweis für seine These, dass der aktive Intellekt vom Körper abtrennbar ist.27 Soweit der rationale Seelenteil göttlich ist, ist er unsterblich und ewig und wird gleichsam von außen eingepflanzt. Dieses ‘übernatürliche’ Vermögen unterscheidet sich von der ‘Natur’, zu der noch die gewöhnliche Vernunft, der passive Intellekt, zu rechnen ist. Da der Geist in seiner Funktion nicht mehr auf die äußeren Objekte angewiesen ist, kann er auch sich selbst denken; er hat die Struktur der Selbstreflexivität.28 Das Bewusstsein von sich ist von den Dingen der Außenwelt unableitbar. In ihm weiß sich der Geist mit sich selbst identisch.
Der Mensch ist durch die Vernunft, sowohl in ihrer praktischen wie in ihrer theoretischen Funktion, nicht auf Selbsterhaltung, sondern auf Selbstüberschreitung angelegt. Höchstes Ziel ist die Teilhabe am zeitlosen Sein. Schon Pflanzen und Tiere streben, soweit es ihnen möglich ist, nach der Teilhabe am Göttlichen.29 Während jedoch Pflanzen und Tiere nur als Gattungswesen Anteil am ewigen Sein erlangen können, kann sich der Mensch in seiner physischen und sozialen Bedingtheit so weit übersteigen, dass er das Göttliche in sich selbst erkennen kann. Obwohl sich vita activa und vita contemplativa ergänzen, gilt die theoretische Lebensweise letztlich als vollkommener, denn in ihr betrachtet der Mensch, von äußeren Umständen völlig losgelöst, die zeitlosen Seinsprinzipien der Welt. Er nähert sich dem glückseligen und mühelosen Leben der Götter, überschreitet, soweit es ihm möglich ist, die durch seine Sterblichkeit gesetzten Grenzen und erlangt momenthaft Einsicht in das, was die Dinge sind und warum sie so sind.30 Würde man das Leben auf die Sicherung des physischen Überlebens und das gesellschaftliche Wohlergehen beschränken, blieben die höchsten Möglichkeiten des Menschen verborgen. Vollkommenes Glück können die Menschen nur erlangen, wenn sie alle Formen sozialer Abhängigkeit überschreiten.
Die Erfahrungen, die auf den Sinnen, den Gefühlen und der Klugheit beruhen, erschließen nur einen begrenzten Ausschnitt der Wirklichkeit. Die Erfahrung des Göttlichen fordert daher eine eigene Form der Erkenntnis; sie verändert das, was dem Menschen gewöhnlich als ‘wirklich’ erscheint. Dabei handelt es sich keineswegs um die distanzierte These, dass nur ein absolutes Sein die Letztbegründung von Erkenntnis leisten könne. Das göttliche Sein erscheint als höchster Wert und absolutes Ziel, das dem menschlichen Leben eine Orientierung verleiht. Erstrebt wird keine wissenschaftliche Wahrheit, die sich rein begrifflich und unabhängig von der eigenen Erfahrung formulieren lässt, sondern die Wahrheit des Seins. Seinswahrheit und wissenschaftliche Wahrheit haben, so werden wir noch sehen, eine je andere Form und Funktion.
Wenn man von ‘Leben’ nicht bei allen Lebewesen im selben Sinne sprechen kann, dann stellt sich die Frage, nach welchen Kriterien sich eine Ordnung entwickeln lässt. Obwohl es, wie Aristoteles erkannte, mehrere Möglichkeiten der Einteilung gibt, ordnete er die Lebewesen gemäß ihrer seelischen Komplexität in einer aufsteigenden Stufenleiter des Seins. Die einzelnen Arten von Lebewesen unterscheiden sich durch die jeweiligen Seelenvermögen, zu denen „das Ernährungs-, Wahrnehmungs-, Strebungs-, Ortsbewegungs- und Überlegungsvermögen“31 gehören. Welche Seelenvermögen ein Lebewesen hat, bestimmt, wie es sich und die Umwelt wahrnimmt und welchen Verhaltensspielraum es hat. Die ‘Kette der Lebewesen’ führt von den Organismen, die, wie die Pflanzen, auf die vegetative Seele beschränkt sind, bis zur vernünftigen Seele des Menschen. Obwohl die begriffliche Einteilung den Eindruck erweckt, dass zwischen den Lebensformen eine klare Abgrenzung besteht, sind in der Natur selbst die Übergänge fließend. Sogar zwischen Unbelebtem und Belebtem gibt es nur einen allmählichen Übergang. Es gibt Zwischenglieder, die in sich die Merkmale von beiden Klassen vereinen.32 Die ‘Kette der Wesen’ ist so aufgebaut, dass die ranghöheren Lebewesen die seelischen Vermögen der einfacheren umschließen. „Immer ist im Nachfolgenden der Möglichkeit nach das Frühere enthalten.“33
Jedes Lebewesen hat eine vegetative Seele, nicht aber notwendig Wahrnehmungsvermögen; doch die Lebewesen, die, wie die Tiere, Sinneswahrnehmungen haben, haben auch vegetative Funktionen. Das menschliche Leben wiederum, das sich durch die Vernunft von Pflanzen und Tieren unterscheidet, ist weiterhin an physiologische Prozesse, an den Stoffwechsel und die biologische Fortpflanzung, an Wahrnehmungsvermögen und Begierden gebunden.34 Die seelischen Grundfunktionen und die mit ihnen verbundenen Verhaltensmöglichkeiten, die für einfache Lebewesen typisch sind, finden sich daher noch beim Menschen. Dadurch gelingt es Aristoteles, die besonderen Fähigkeiten des Menschen zu erarbeiten, ohne ihn aus dem Tier- und Pflanzenreich auszuschließen. Der Mensch ist ein vernunftbegabtes Lebewesen, ein ‘animal rationale’ im wörtlichen Sinne, das mit allen anderen Lebewesen die Grundfunktionen des Lebendigen teilt. Im Unterschied zu Descartes und vielen anderen Denkern der Neuzeit und der Gegenwart erfolgte die Bestimmung der menschlichen Identität nicht nur durch den Geist, sondern auch durch die vitale Sphäre. Die Lehre vom Menschen gehört deshalb auch noch zur Naturphilosophie, ohne jedoch eine naturalistische Anthropologie im modernen Sinne zu sein. Doch trotz der unübersehbaren Gemeinsamkeit des Menschen mit Tieren und Pflanzen ergibt sich für Aristoteles das eigentümlich menschliche Lebensziel erst aus der Differenz zu anderen Lebewesen. Nur der Mensch ist ein mit ‘Sprache und Vernunft begabtes Gemeinschaftswesen’. Da alle Dinge entweder sinnlich wahrnehmbar oder denkbar sind, erfasst nur die menschliche Seele alle Seinsbereiche vom Materiellen bis zum reinen Geist.
Die Stufenleiter der Natur ist keine wertneutrale Deskription der Vielfalt von Lebewesen; in der Hierarchie drückt sich eine Rangordnung aus, eine Gewichtung nach höherem und niedrigerem Leben. Die wachsende seelische Komplexität, die sich in der zunehmenden Erkenntnisfähigkeit im Hinblick auf die Welt und sich selbst ausdrückt, ist ein Gut und deshalb auch ein Ziel. Wer die Ordnung der Natur erkennen will, muss daher auch ihre letzte Ursache erkennen. Doch wie kommt Aristoteles zu dem Schluss, dass es nicht nur eine unüberschaubare Vielfalt von Lebewesen, sondern auch ein höchstes Sein gibt? Und wie ist es beschaffen? Auf allen Seinsstufen sind Wirklichkeit und Möglichkeit ineinander verschränkt. Da nicht aus dem reinen Nichts das Sein, aus völliger Unbestimmtheit und Leere bestimmtes Seiendes entstehen kann, muss das Wirkliche dem Möglichen ontologisch vorangehen. Eine unendlich sich fortsetzende Folge, ein regressus ad infinitum, in dem ein Seiendes das andere aktualisiert, ist für Aristoteles keine adäquate Lösung des Problems. Es muss ein letztes Sein geben, das immer schon reine Wirklichkeit ist und nicht erst durch irgendein anderes Sein aktualisiert werden muss; es muss etwas geben, das keine Potentialität mehr in sich hat, das also nicht ebenso gut sein wie nicht sein könnte. Etwas, das sich selbst bewegt, enthält immer schon zwei Momente, Bewegtes und Bewegendes, in sich, so dass das letzte Sein ein unbewegt Bewegendes sein muss. In ihm vollzieht sich kein Übergang mehr von der Möglichkeit zur Wirklichkeit. Da die Materie als reine Möglichkeit bestimmt wurde, ist das höchste Sein immateriell und, da ohne äußere Ursache seiend, auch unvergänglich. Ein vollendeter Akt muss allem vorangehen, was der Möglichkeit nach Leben hat.
Die Wirksamkeit der höchsten Ursache lässt sich freilich nicht physikalisch aufgrund äußerer Krafteinwirkungen beschreiben. Sie bewegt die Welt durch ihr Sein und ohne von der Welt rückwirkend bewegt zu werden. Bewegt werden die endlichen Seienden nur durch ihr eigenes Streben, am ewigen Sein teilzuhaben. Das Sein wirkt nur dadurch, dass es ist und so eine Art Sehnsucht erweckt, an ihm teilzuhaben und ihm so weit wie möglich zu gleichen. Gerade indem der Gott nicht mehr durch anderes bewegt wird, wird er zur Quelle aller Bewegung, zum ‘unbewegten Beweger’ und zum Ziel aller endlichen Seienden. Anders als bei vielen Denkern der Neuzeit und der Gegenwart sind bei Aristoteles Geist und Leben auf keiner Seinsstufe getrennt; das Leben ist nicht auf die Vitalsphäre und der Geist nicht auf die Erkenntnisfunktion beschränkt. Im Buch XII der ‘Metaphysik’ spricht er dem höchsten Sein nicht nur Vernunft, sondern auch Leben zu. Der Gott selbst ist reines Denken. Da er nur das höchste Gut denkt, denkt er sich selbst. Doch gerade diese Betätigung des göttlichen Geistes, der Akt des Sich-Selbst-Denkens, ist Leben.35 Da Leben von umso höherer Intensität ist, je mehr es aus eigener Spontaneität erfolgt, ist der göttliche Geist lebendig im höchsten Sinne. Er allein ist nicht mehr von äußeren Ursachen abhängig, sondern selbsttätig, ‘actus purus’.