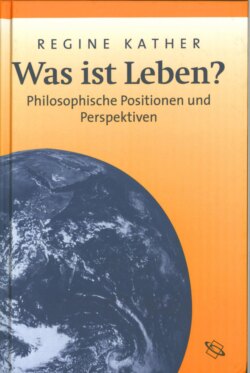Читать книгу Was ist Leben? - Regine Kather - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.2 Descartes: Die Begründung der Identität im denkenden Ich
ОглавлениеDescartes’ Philosophie markiert den Einschnitt, der die antike und mittelalterlichen Bestimmungen von Leben von den neuzeitlichen trennt. Der Versuch, materielle Prozesse vollständig naturwissenschaftlich-mathematisch zu erklären, führt dazu, dass entweder materielle und geistige Prozesse völlig voneinander getrennt oder aufeinander reduziert werden müssen.
In den ‘Meditationen’ schildert Descartes seine Suche nach einem letzten und unerschütterlichen Ausgangspunkt allen Wissens. Er spitzt die alltägliche Erfahrung, dass die Sinne trügen können, bis ins Extrem zu: Er bezweifelt nicht nur, ob das, was die Sinne vermitteln, zutrifft, sondern auch, ob es das, was sie zeigen, überhaupt gibt. Wenn eine solche Unsicherheit über die Außenwelt möglich ist, von der die Sinne berichten, welche Funktion hat dann der eigene Leib für die Suche nach einem sicheren Ausgangspunkt allen Wissens? Es ist nur folgerichtig, dass Descartes, der alle durch die Sinne vermittelten Wahrnehmungen in Zweifel zieht, zumindest hypothetisch auch die Existenz des eigenen Leibes bezweifelt.90 Insofern dieser sinnlich wahrgenommen wird, gehört er für ihn ebenso zur Außenwelt wie alle anderen Körper, von denen die Sinne berichten. Alles, was in irgendeiner Form an leibliche Funktionen gebunden ist, kann daher kein Ausgangspunkt sicheren Wissens sein. Sogar seelische Empfindungen und die einzelnen Gedankeninhalte könnten falsch sein, eine pure Täuschung, ein bloßer Traum oder der listige Trug eines bösen Geistes. Unbezweifelbar ist nur, dass ein Ich diese wahren oder falschen Gedanken, diese wirklichen oder trügerischen Empfindungen und Sinneseindrücke denkt. Dass das denkende Ich existiert, ist das Einzige, was unbezweifelbar gewiss ist. Die Erkenntnis des Geistes ist also ursprünglicher, gewisser und klarer als die des Körpers. „Der Sinn war demnach, daß ich durchaus nichts erkannte, von dem ich wüßte, daß es zu meinem Wesen gehört, als daß ich ein denkendes Wesen sei, d. h. ein Wesen, das die Fähigkeit zu denken besitzt.“91
Das Ich denkt nicht nur bestimmte Inhalte, sondern es weiß sich selbst als denkend. Diese Selbstvergewisserung beinhaltet im strengen Sinne des Wortes Selbst-Bewusstsein, Bewusstsein von sich als Denkendem. Für das Ich verwendet Descartes synonym die Begriffe unsterbliche Seele, Geist, Verstand oder Vernunft. „Unter Denken verstehe ich alles, was derart in uns geschieht, daß wir uns seiner unmittelbar aus uns selbst bewußt sind.“92 Körperliche Abläufe und Bewegungen wie Sehen oder Gehen gehören nicht zur inneren Selbstgewissheit; gewiss ist jedoch, dass der Geist denkt, er würde sehen oder gehen. Sinneswahrnehmungen, Empfindungen, Gefühle und Leidenschaften der Seele kommen dieser allerdings nicht als denkendem Wesen zu, sondern nur aufgrund ihrer engen Verbindung mit einem „ausgedehnten und beweglichen Gegenstande …, welcher der menschliche Körper genannt wird“93. So kann man zwar die denkende Substanz ohne die Vermögen der Einbildung und Empfindung denken; diese jedoch kann man nicht ohne die denkende Substanz verstehen. Modern gesprochen beruht die menschliche Identität auf mentalen Akten. Diese entstehen freilich für Descartes nicht aus der Verbindung von Sinnesreizen und deren Verarbeitung durch neurophysiologische Mechanismen des Gehirns. Denken ist ein unableitbarer, spontaner Akt des Geistes und nicht auf kausal wirkende Faktoren zurückzuführen.
Worauf beruht die Differenz zwischen dem denkenden Ich und dem Körper, so dass beide überhaupt in dieser Form getrennt werden können? Der Geist ist nicht nur unteilbar, sondern auch unwandelbar. Er ist trotz unterschiedlicher Denkinhalte immer mit sich selbst identisch; diese verändern nicht sein Wesen, denkende Substanz zu sein. Die Unteilbarkeit des individuellen Geistes ist für Descartes daher zugleich der Beweis seiner Unvergänglichkeit. Dagegen ist jeder Körper, auch der menschliche, durch Teilbarkeit und damit durch Wandelbarkeit bestimmt.94 Da er aus einzelnen Teilen zusammengesetzt ist, kann er sich auch in seine Bestandteile auflösen und vergehen. Seine Dauer ist zeitlich begrenzt. Da nur der menschliche Geist durch eine innere Einheit charakterisiert ist, unterscheidet er sich grundsätzlich von jenem „Gefüge von Gliedern, das man den menschlichen Körper nennt“95. Geist und Körper unterscheiden sich „substantiell“96. Substanz definiert Descartes als „ein Ding verstehen, das so existiert, daß es zu seiner Existenz keines anderen Dinges bedarf“97. Streng genommen gilt diese Definition nur für Gott; für die Materie, aus der die vielen einzelnen Körper bestehen, und den Geist gilt sie jedoch insofern, als sie lediglich Gottes Beistand zu ihrem Dasein bedürfen. Abgesehen davon bestehen sie aus sich heraus.
Aber wie kommt Descartes überhaupt zu der Aussage, die Körper seien nur durch Ausgedehntheit und Teilbarkeit zu bestimmen? Bei einem Stück Wachs etwa, so das Argument, sind die sinnlichen Eigenschaften wie Geruch, Geschmack, Temperatur und Form nur vorübergehende Erscheinungen, die sich beim Erhitzen oder Abkühlen verändern. Was bei allen Formveränderungen, die man vollziehen und sich darüber hinaus vorstellen kann, übrig bleibt, ist lediglich etwas Ausgedehntes und damit Teilbares. Die Sinnesqualitäten wie heiß oder kalt, flüssig oder fest tragen daher zur Erkenntnis der Substanz des Wachses nichts bei. Will man eine objektive Erkenntnis gewinnen, dann muss man, so schließt Descartes, von qualifizierten Sinneswahrnehmungen und damit auch von den sinnlichen Qualitäten der Körper absehen.98 Die Sinnesqualitäten sagen nichts über die Natur der Dinge aus, sondern spiegeln nur bestimmte Zustände des eigenen Leibes. Dass die sog. sekundären Qualitäten für objektiv gehalten werden, ist nur eine Folge der naiven, unwissenschaftlichen Alltagserfahrung, für die sie allerdings unverzichtbar sind. Aber sogar wenn man von Geruch, Farbe und Geschmack absieht, bleiben bestimmte Qualitäten, durch die ein Körper überhaupt als solcher erkennbar ist und sich von anderen Körpern unterscheiden lässt. Doch auch die im Tastvorgang sinnlich erfahrbare Undurchdringlichkeit und Widerständigkeit, die sog. primären Qualitäten, sind nicht für die körperliche Substanz konstitutiv, sondern lassen sich auf die Teilung und Bewegung von etwas Ausgedehntem zurückführen. Auch die mit dem Tastsinn verbundenen sinnlichen Qualitäten von Körpern lassen sich, ebenso wie die mit der Lage verbundenen optischen und kinematischen, aus geometrischen und damit aus mathematischen Eigenschaften der Materie ableiten. ‘Natürliche Körper’ bestehen zwar in materialer Undurchdringlichkeit und Resistenz, aber ‘mathematische Körper’ sind reine Ausgedehntheit. Nur das ist an den Körpern „wirklich vorhanden, was ich klar und deutlich denke, d. h. alles das, … was zum Inbegriff eines Gegenstandes der reinen Mathematik gehört“99. Die Abstraktion von allen sinnlichen Qualitäten ist eine Voraussetzung für die vollständige Mathematisierbarkeit der Natur und die Überprüfbarkeit der Theorie im Experiment. Die Gesetze der Mechanik sind für Descartes daher identisch mit denen der Natur.
Ist Materie bloße Ausgedehntheit, dann wird Bewegung auf die kausalmechanisch zu erklärende Ortsbewegung einzelner Teile reduziert. Die verschiedenen Formen des Übergangs von etwas in etwas sind lediglich Weisen, in denen sich die Ortsbewegung materieller Teilchen in der Natur vollzieht. Die einzelnen Materiepartikel unterscheiden sich nicht durch ein Gestaltprinzip, sondern nur durch ihre Masse und die Quantität der Bewegung, durch Größen also, die sich mathematisch darstellen lassen. Die Form ist nun kein Korrelat des Stoffes mehr.100
Der unendlichen Teilbarkeit der Körperwelt, in der es keine einheitsbildenden Prinzipien gibt, steht die Unteilbarkeit des denkenden Ich vermittlungslos gegenüber. Dieser Schnitt trennt das denkende Ich nicht nur von der Natur, sondern auch vom eigenen Leib, der für die Begründung der Identität letztlich unwichtig ist. „Und wenngleich ich … einen Körper habe, der mit mir sehr eng verbunden ist, so ist doch, – da ich ja einerseits eine klare und deutliche Vorstellung meiner selbst habe, sofern ich nur ein denkendes, nicht ausgedehntes Wesen bin, und andererseits eine deutliche Vorstellung vom Körper, sofern er nur ein ausgedehntes, nicht denkendes Wesen ist – so ist, sage ich, soviel gewiß, daß ich von meinem Körper wahrhaft verschieden bin und ohne ihn existieren kann.“101 Der unteilbare und unsterbliche Geist gehört zu einer anderen Ordnung der Dinge als der Leib, der zu den ausgedehnten und teilbaren Körpern gehört. Denn, so argumentiert Descartes, obwohl „der ganze Geist mit dem ganzen Körper verbunden zu sein scheint, so erkenne ich doch, daß, wenn man den Fuß oder den Arm oder irgendeinen anderen Körperteil abschneidet, darum nichts vom Geiste weggenommen ist“102. Schmerz- und Lustgefühle, die man am eigenen Leib empfindet, dienen nur dazu, dem Geist anzuzeigen, was für das Wohlbefinden „zuträglich oder unzuträglich ist“103, was der Erhaltung des Leibes nutzt oder schadet. Die Qualität des Empfindens hat keine Bedeutung für das Gefühl von Erfülltheit oder Unerfülltheit des eigenen Seins, sondern einen rein funktionalen Wert. Der Mensch ist nun kein ‘animal rationale’ mehr, sondern eine ‘res cogitans’.
Die These, dass der Körper für die Begründung der persönlichen Identität letztlich ohne Bedeutung sei, gewinnt an Prägnanz, wenn man sie mit extremen Erfahrungen konfrontiert: Bei Menschen, die vom Hals ab querschnittsgelähmt sind, die durch Amputationen Teile ihres Körpers verloren oder durch eine Muskelerkrankung sogar die Beherrschung von Atmung und Sprachvermögen eingebüßt haben, hat sich die persönliche Identität in keiner Weise verringert. Ohne Zweifel hat sich das Lebensgefühl tiefgreifend verändert, auch die Erfahrungen, die diese Menschen machen, und die Bedeutung, die sie haben. Die Inhalte des Bewusstseins haben sich verändert, doch das Bewusstsein der eigenen, unverwechselbaren Identität ist geblieben.104 Sie ist unteilbar und beruht nicht auf dem Leib in seiner Zerbrechlichkeit, sondern auf der Fähigkeit des individuellen Geistes, alle Erfahrungen aufeinander zu beziehen und sie als die eigenen zu wissen.
Die Transformation, die sich mit der Genese der modernen Wissenschaften vollzogen hat, wird am Beispiel des menschlichen Leibes besonders deutlich105: Seit der Renaissance wurde die Anatomie des menschlichen Körpers systematisch durch die Sezierung von Leichen erschlossen. Die Studien an toten Objekten legten den Schluss nahe, dass für alle materiellen Körper, belebte wie unbelebte, dieselben Gesetze gelten. Man müsste, so vermutete schon der spanische Arzt Gómez Pareira im 16. Jh., alle körperlichen Funktionen mechanisch erkären. Descartes vollzieht diesen Schritt explizit. Das Auge wird zur ‘camera obscura’, zu einer dunklen Kammer: Zunächst, so erläutert Descartes, bündelt der ‘Sehapparat’ die einfallenden Lichtstrahlen wie eine Linse; erst dann werden die so entstandenen Abbildungen der Außenwelt von einem geistigen Prinzip ‘wahrgenommen’. Wie ein Experimentator die Daten seiner Versuchsanordnung auswertet, so liest das denkende Ich die Sinnesreize ab, die auf das Auge treffen. Der Akt des Sehens erscheint nicht mehr, wie bei Platon und Cusanus, als Ausdruck einer welterschließenden Aktivität, sondern als mechanische Reaktion auf Reize.106 Auch der Leib erscheint nicht mehr als beseelter Organismus, sondern als ‘Körper-’107 und ‘Gliedermaschine’108.
Wie alle Körper ist er ein Gegenstand im Raum, der lokalisierbar ist und von außen betrachtet wird. Das erkennende Subjekt macht seinen eigenen Leib zum Objekt der Erkenntnis. Die einzelnen Organe werden zu Konstruktionselementen, und die zielgerichteten Leistungen erklären sich aus mechanischen Gesetzen. Die Funktion des menschlichen Körpers folgt „mit der gleichen Notwendigkeit, wie der Mechanismus einer Uhr aus der Kraft, Lage und Gestalt ihrer Gewichte und Räder“109. Die Uhr hat freilich trotz ihrer mechanischen Konstruktion einen Zweck, nämlich den, Menschen die Zeit anzuzeigen; wie Aristoteles sagte, liegt der Zweck der Technik allerdings im Konstrukteur. Ebenso hat der menschliche Körper seinen Zweck in einem Prinzip, das ihm aufgrund der Zwei-Substanzen-Lehre völlig äußerlich ist: Der Zweck liegt im menschlichen Geist, dessen Instrument der Körper ist. Um die Funktionsweise einer Maschine zu verstehen, muss man nur wissen, wie Ursachen und Wirkungen sich bedingen. Man kann sie in einzelne Teile zerlegen und einige von ihnen ersetzen, ohne die Funktionsganzheit zu zerstören. Eine Maschine ist gleichgültig gegen Glück und Schmerz, Ziele und Werte. Gütekriterien sind Effizienz und Funktionalität.
Interpretiert man den menschlichen Körper im Bild der Maschine, dann genügt es für die ärztliche Diagnostik, jeweils einzelne Organe, die Leber, die Nieren oder das Herz genau zu untersuchen. Durch Transplantationen können kranke Organe gegen gesunde ausgetauscht werden, die einem anderen Körper entnommen wurden. Wie sich die seelische Befindlichkeit auf die leiblichen Funktionen auswirkt, ist für diese Perspektive irrelevant. Die wissenschaftliche Analyse untersucht lediglich, welche Gesetze den Stoffwechsel steuern und wie die einzelnen Organe arbeiten. Die ‘Normalwerte’, die durch Messungen an einer großen Zahl von Individuen gewonnen wurden, geben einen statistisch relevanten Mittelwert an; ob sie für ein bestimmtes Individuum tatsächlich aussagekräftig sind, muss man gesondert beurteilen.
Descartes hat mit der Anwendung der physikalischen Methode auf alle Körper, unbelebte wie belebte, einen folgenreichen Schritt vollzogen: Das menschliche Leben beruht nicht mehr auf dem hierarchischen Ineinandergreifen verschiedener seelischer Funktionen. Dabei änderte sich zunächst weniger die Bestimmung des Geistes, der auch für Aristoteles und Plotin abtrennbar war; doch durch die mechanische Erklärung leiblich-vitaler Prozesse vollzog sich eine tiefgreifende Transformation des Verhältnisses von Körper und Geist, Ich und Welt. Nur der menschliche Geist wird unter der Perspektive der ersten Person bestimmt; der eigene Leib dagegen erscheint wie ein Objekt der Außenwelt, das den Gesetzen der Physik untersteht. Unberücksichtigt für die Erklärung seiner Funktion bleibt, dass er auch von innen erlebt wird, dass sich durch ihn die Welt in ihrer Qualifiziertheit erschließt und sich in ihm die seelische Befindlichkeit ausdrückt. Die Physik, die Wissenschaft von der Bewegung unbelebter Objekte, wurde zum Paradigma für die Interpretation lebendiger Prozesse. Der cartesische Dualismus lässt freilich ein entscheidendes Problem ungelöst: Wie kann der immaterielle Geist den Körper steuern und ihn zum Instrument seiner Entscheidungen machen? Descartes selbst glaubte, dass die Seele über die Zirbeldrüse die willkürlichen Handlungen des Körpers steuert. Damit geriet seine Theorie in einen unlösbaren Widerspruch zur klassischen Mechanik, für die jede körperliche Wirkung eine körperliche Ursache haben muss.
Durch die Bestimmung der Materie ändert sich auch das Verhältnis zu anderen Lebwesen tiefgreifend. Da Tiere kein Selbstbewusstsein haben, fehlt ihnen, so schloss Descartes, auch der unteilbare und unsterbliche Geist. Damit gehören sie, wie der eigene Leib, zur physikalisch zu erklärenden Welt. Aufgrund seiner Lehre von zwei verschiedenen Substanzen verwirft Descartes die Vorstellung, dass es verschiedene Arten der Beseeltheit gibt; das vegetative und das sensitive Vermögen, die die Menschen mit den Tieren teilen, sind für ihn völlig vom Geist verschieden. Nicht-menschliche Lebewesen sind nur ein Gefüge von kunstvoll, aber rein mechanisch organisierter Materie.110 Die Seele, bei Aristoteles Prinzip des Lebens und der Selbsttätigkeit, wurde bei Descartes zum Prinzip der menschlichen Subjektivität; das ‘Leben’ in seinen biologisch-vitalen Funktionen dagegen wurde zum Gegenstand der Physik. Dadurch gibt es bei Descartes keine durch eine gradweise Steigerung des Lebendigen vollzogene Vermittlung mehr zwischen res extensa und res cogitans. Die ‘Kette der Wesen’ wurde in zwei Arten des Seienden zerschnitten, die nichts mehr miteinander gemein haben. Während die Tiere zu empfindungslosen Gliedermaschinen herabsinken, gewinnt der Mensch eine alles überragende Sonderstellung. Erst indem anderen Lebewesen eigene Bedürfnisse und Interessen abgesprochen werden, können sie ausschließlich zum Mittel für menschliche Ziele werden. Mitgefühl und Sympathie mit ihnen erscheinen als deplatziert. Bis weit ins 20. Jh. wurden Tiere in ethischer und juristischer Hinsicht wie tote Körper als ‘Sachen’ eingestuft.
Bei Descartes zeichnet sich bereits eine Entwicklung der Deutung des Lebendigen ab, die bis ins 20. Jh. in immer subtileren Formen weitergedacht wurde: Im Unterschied zur Antike, für die die Technik eine Nachahmung der Natur war, wurden nun natürliche Prozesse in technologischen Modellen interpretiert.111 Die Natur hat als göttliche Schöpfung zwar noch die Kraft, im Sinne der natura naturans Lebewesen zu erzeugen; doch diese funktionieren aufgrund mechanischer Gesetze, die Gott der Materie auferlegt hat.112 Der Mensch ist in einer Natur, die durch Ausdehnung und Teilbarkeit bestimmt ist und den Gesetzen der klassischen Mechanik gehorcht, nicht mehr beheimatet. In einer mechanisch konzipierten Natur kann er sich nicht mehr gleichzeitig als natürliches Wesen und als unverwechselbare Person mit der Fähigkeit, Zielen zu folgen und nach ethischen Werten zu urteilen, verstehen. Als Subjekt des Denkens und Handelns steht er einer kausalmechanisch erklärten Natur, zu der auch sein eigener Leib gehört, gegenüber. Das menschliche Ich ist weltlos geworden – obwohl, wie Descartes am Ende der ‘Meditationen’ nachdrücklich versichert, niemand ernsthaft zweifeln könne, dass es eine Welt gibt und der Mensch einen Körper hat. Die eigene Identität beruht auf der Vergewisserung in sich selbst, in einer Innerlichkeit, die letztlich weder den anderen Menschen noch den eigenen Leib noch die Natur benötigt.
Der Versuch einer Grenzziehung zwischen Belebtem und Unbelebtem teilt die abendländische Geistesgeschichte demnach in zwei Phasen: In Antike und Mittelalter sah man im Unbelebten einen Grenzfall des Lebendigen; seit Descartes versucht man umgekehrt Lebensprozesse vom Unbelebten her zu verstehen. Der aristotelisch-platonische Begriff der Natur gilt nun als anthropomorph. Grundprinzip für die Erklärung natürlicher Prozesse sind nicht mehr substantielle Formen, sondern die Gesetze der Bewegung und der Erhaltung der Bewegungsgröße. In der Neuzeit wird daher „nicht nur Geist, sondern auch Seele und daher Leben für die Erkenntnis der Natur überflüssig. Bewegung ohne Seele involviert Kraft ohne Streben, aus welcher Formen resultieren, die nicht Zwecke waren. Die ‘Kraft’ ist in allen Fällen beharrungsmäßig, d. h. eine quantitative Konstante, die sich von Augenblick zu Augenblick überträgt in endloser Folge. Da nun aber Leben spontane und zielstrebige Bewegung bedeutet, während das neue wissenschaftliche Verstehen nur beharrungsmäßige Bewegung anerkennt, so folgt das weitere Paradox, daß nicht nur das Geist-lose, sondern auch das Leb-lose das Verständliche an sich wird und die ‘tote Materie’ zum Maßstab aller Verstehbarkeit. Insofern aber ‘Leben’ doch als Tatsache innerhalb der Totalität physischer Tatsachen angetroffen wird, muß sein Verständnis eben seine Anmessung an diesen Maßstab bedeuten, d. h. seine Erklärung in den Begriffen des Leblosen.“113