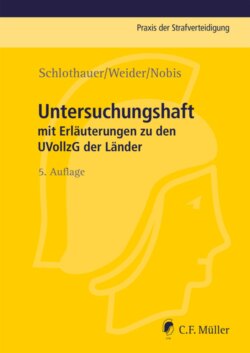Читать книгу Untersuchungshaft - Reinhold Schlothauer - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеTeil 1 Einleitung › II. Rechtswirklichkeit und kriminalpolitische Instrumentalisierung der Untersuchungshaft
II. Rechtswirklichkeit und kriminalpolitische Instrumentalisierung der Untersuchungshaft
6
Untersuchungshaft ist Freiheitsberaubung an einem Unschuldigen.[1] Diese pointierte Feststellung Hassemers unterstreicht die Bedeutung der Unschuldsvermutung auch bei der Anordnung und dem Vollzug der Untersuchungshaft. Die Entwicklung der Zahl der Untersuchungsgefangenen in den letzten Jahrzehnten zeigt, dass der Unschuldsvermutung und dem ultima ratio Charakter der Haft[2] zur Verfahrenssicherung in sehr unterschiedlichem Maße Rechnung getragen wurde und von einem steten Auf und Ab der Untersuchungshaftzahlen gekennzeichnet ist. Während sich vor mehr als 20 Jahren am 1.1.1987 in den alten Bundesländern noch 11.373 Menschen in Untersuchungshaft befanden, war nach einem bis dato steten Anstieg zum 30.11. des Jahres 1993 der bisherige Rekordstand von 20.440 Untersuchungshäftlingen zu verzeichnen. Seit dem Jahr 1998 bis zur Talsohle im Jahr 2010 war die Zahl der Häftlinge dann längere Zeit kontinuierlich und deutlich auf 10.781 Personen zum Stichtag 30.11.2010 zurückgegangen.[3] Seither ist allerdings wieder eine Trendwende mit einem Anstieg um ca. 7 % zu beobachten auf zuletzt 11.528 U-Häftlinge am 30.11.2014.[4] Aussagekräftige Untersuchungen über die Gründe des erheblichen Rückgangs von 1992 bis 2010 gibt es – soweit ersichtlich – ebenso wenig, wie für den jetzt abermals zu verzeichnenden Anstieg[5]. Von daher verbieten sich Spekulationen über mögliche Ursachen. Festhalten lässt sich indes zumindest, dass das geschriebene Gesetz eine einigermaßen homogene Auslegung und Anwendung der Vorschriften über die Anordnung und den Vollzug der Untersuchungshaft nicht gewährleistet, sondern trotz gleichbleibender Gesetzeslage signifikante Änderungen der Haftzahlen mal in die eine, mal in die andere Richtung zulässt. Die weiten Interpretationsspielräume bei der Auslegung z.B. der Tatbestandsmerkmale des „dringenden Tatverdachts“ oder der „Fluchtgefahr“ eröffnenden kriminalpolitischen Bedürfnissen angepasste Entscheidungen.[6] Dabei besagt die Statistik zunächst einmal nur etwas über die Zahl der tatsächlich Inhaftierten, bei denen also die Untersuchungshaft tatsächlich vollzogen wurde. Die Zahl der Außervollzugsetzungen, die ebenfalls im Hinblick auf die Auflagen erhebliche Belastungen (Kaution, Meldepflichten etc.) mit sich bringen können, sind insoweit noch nicht einmal erfasst.
7
Im Übrigen zeigen die Statistiken über die Anordnung der Untersuchungshaft nach wie vor erschreckende Befunde. Der Haftgrund der Fluchtgefahr wurde in 92, 7 % der Fälle angenommen (2013).[7] Dies erscheint vor dem Hintergrund, dass nur in ca. 51 % der Fälle, in denen Untersuchungshaft angeordnet war, eine Freiheitsstrafe ohne Bewährung verhängt wurde, bedenklich hoch. Wenn in 35, 5 % der Fälle nur eine Bewährungsstrafe und in ca. 8 % gar nur eine Geldstrafe oder Zuchtmittel nach Jugendrecht ausgesprochen wurde und in knapp 3 % ein Freispruch erfolgte, von Strafe abgesehen oder das Verfahren eingestellt wurde[8], so sind Zweifel angebracht, ob die Anordnung der Untersuchungshaft in diesen Fällen tatsächlich gerechtfertigt war.
8
Besorgniserregend sind auch die Zahlen über die Dauer der Untersuchungshaft. Im Jahre 2013 dauerte die Haft in25 % der Fälle „nur“ bis zu einem Monat, in 28,7 % nur bis zu 3 Monaten.[9] Zwar besagt die Statistik nichts über die Gründe der nur kurzzeitigen Inhaftierung, sie scheinen jedoch auf der Hand zu liegen. Denn entweder war die Sache einfach gelagert und von geringem Gewicht, so dass eine Aburteilung schnell (etwa im beschleunigten Verfahren) erfolgen konnte, oder der Haftbefehl wurde nach kurzer Zeit aufgehoben oder außer Vollzug gesetzt. In ersterem Fall fragt sich, warum nicht vermehrt von alternativen Erledigungsformen gerade für den Bereich kleinerer Kriminalität, z.B. dem Strafbefehlsverfahren (vgl. dazu Rn. 576 ff.) Gebrauch gemacht wurde. In Fällen der Aufhebung des Haftbefehls kurze Zeit nach der Inhaftierung ist zu fragen, warum dieser dann überhaupt erlassen wurde und ob eine sorgfältigere Prüfung der Haftbefehlsvoraussetzungen nicht zu einer Ablehnung des Erlasses des Haftbefehls bereits in der Vorführungsverhandlung hätte führen müssen. Entsprechendes gilt für eine Außervollzugsetzung. Im Übrigen widerspricht die kurzfristige Inhaftierung auch der in § 47 StGB zum Ausdruck gekommenen Intention des Gesetzgebers. Kurzfristige Freiheitsstrafen sollen u.a. deswegen weitgehend zurückgedrängt werden, da die Vollstreckung den Betroffenen aus seiner sozialen Verflechtung reißt und damit gravierende schädliche Folgen haben kann.[10] Nichts anderes gilt aber für die Verbüßung kurzzeitiger Untersuchungshaft.
9
Dies verdeutlicht noch einmal, dass im Bereich der Anordnung der Untersuchungshaft noch einiges im Argen liegt und es nach wie vor vermehrter Anstrengungen zur Vermeidung der Inhaftierung bedarf. Dabei geht es um den Kampf gegen die Anordnung und den Vollzug der Untersuchungshaft als schärfste strafprozessuale Zwangsmittel in jedem Einzelfall. Durch die ständige Konfrontation mit Recht und Wirklichkeit der Untersuchungshaft bei der Wahrnehmung von Untersuchungshaftmandaten sind gerade die Verteidiger in der Lage, die Bewegungen auf diesem „Seismographen für das rechtspolitische Klima eines Landes“[11] zu registrieren. Die engagierte und effektive Vertretung der Interessen inhaftierter oder von Untersuchungshaft bedrohter Mandanten leistet einen Beitrag dazu, generell der Untersuchungshaft, diesem „verführerischen Instrument staatlicher Macht“[12], rechts- und sozialstaatliche Grenzen zu setzen.