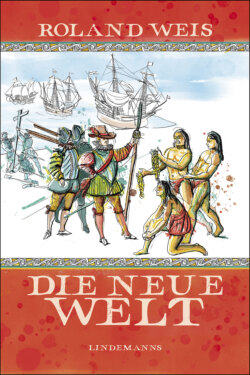Читать книгу Die neue Welt - Roland Weis - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеIV. Das Kloster La Rabida
Die Morgensonne brannte bereits drückend vom andalusischen Hochland herunter in die Ebene von Palos und Huelva. Ihre Strahlen ließen den trägen Rio Tinto anmutig glitzern. Der kleine Miguel Sanchez, der Bruder Rodrigos, saß noch immer in der Nähe des Hafens hinter einem Bretterschuppen und wagte sich nicht aus seinemVersteck hervor. Besser, den ganzen Tag hier in diesem Verschlag auszuharren, als sich durch die Gassen von Palos zur Hütte der Mutter zurückzuschleichen. Nein, überhaupt nie mehr wollte er dorthin zurück. Er wollte frei sein, keine Angst mehr haben müssen, er wollte die Schreie, den ständigen Krach nicht mehr hören, die täglichen Prügel nicht mehr erdulden.
Er war zehn Jahre alt. Ein eingeschüchtertes, ahnungsloses Kind. Doch er war im Begriff, die Flucht vor der eigenen Mutter und ihrem dauerbesoffenen Peiniger zu ergreifen. Miguel beobachtete, wie der Schatten der Hauswand im Laufe des Vormittags immer kürzer wurde, hielt seinen Kupferreal, den ihm die mildtätigen Damen im Hafen zugeworfen hatten, zwischen den Fingern, bestaunte ihn immer wieder aufs Neue und von allen Seiten und vertrieb sich ansonsten die Zeit damit, zwei in seiner Nähe streunenden Katzen bei ihren spielerischen Ringkämpfen zuzuschauen. Sie wälzten sich im Staub und im dürren Unkraut, sprangen übereinander, fauchten, verbissen sich ineinander, machten Buckel, auf denen die Haare abstanden wie Kaktusdornen, und bauschten ihre Schwänze zu Palmwedelgröße auf. Wenn eine die Oberhand gewann, nahm Miguel ein Steinchen und warf es zwischen die Kämpfenden. So hielt er den Zweikampf ausgeglichen.
Hunger und Durst trieben ihn schließlich aus seinem nunmehr schattenfreien Versteck. Weiter oben im Dorf gab es einen Brunnen. Jeder konnte sich daraus bedienen: Die Frauen zogen ihre täglichen Rationen, die Fuhrleute tränkten dort Ochsen oder Esel. Aber die unbestimmte Furcht vor dem, was ihm möglicherweise blühte, wenn die Mutter ihn dort erwischte, oder gar der alte Säufer, falls er nicht nach Rodrigos Messerstich abgekratzt war, hielt ihn davon ab, am Brunnen seinen Durst zu löschen.
Er schlich sich die schmale Gasse hinauf zur Georgskirche und nahm von dort den Weg hinaus aus dem Ort. Richtung La Rabida führte ein staubiger Karrenweg am Rio Tinto entlang; er wurde an zwei Stellen von kleinen Bächen gekreuzt. Es handelte sich um den Fuhrweg zum Kloster La Rabida hinaus, das etwa eine Legua von Palos entfernt lag. Entlang des Weges erstreckte sich ödes Marschland, sumpfige, von Stechmücken bevölkerte Wiesen. Sie reichten bis hinunter zum Rio Tinto. Auf der anderen Seite des Flusses leuchteten die Lehmziegel der Dächer von Huelva, der wichtigsten Stadt der Grafschaft Niebla. Miguel befand sich in vertrautem Gelände, er kannte sich aus.
Die Landschaft lag nach dem langen Sommer ausgedörrt und trostlos vor ihm. In der Ferne flimmerten die weißen Mauern von La Rabida. In einer etwas entfernten, von groben Trockenmauern eingefassten Mulde grasten ein paar junge, schwarze Stiere unter ramponierten Krüppeleichen. Es roch nach verdorrtem Gras und Straßenstaub.
Hinter Miguel näherte sich ein Eselskarren. Er kam schnell näher, denn Miguel trödelte und zauderte, blieb häufig stehen, stolperte dann wieder ein paar Schritte, blieb wieder stehen. Ein struppiges, kräftiges Maultier zog den niedrigen, einachsigen Lastkarren, die Pritsche voll gestopft mit von Tüchern abgedeckten Körben, mit großen Töpfen, groben Säcken, Kürbiskalebassen und ledernen Beuteln. Hinter dem Karren schlurfte ein alter Mann, barfuß und leicht gebückt. Es sah aus, als schlafe er im Gehen. Den zerschlissenen Strohhut hatte er tief in die Stirn gezogen, in seiner rechten Armbeuge klemmte eine mit Schnur verlängerte Rute. Das Ende der Schnur hing bis in den Straßenstaub herab und schleifte zwei Mannslängen hinter dem Alten her. Miguel erschrak, als der schwer schnaubende Maulesel plötzlich an ihm vorbeitrabte. Erst jetzt nahm er das Geräusch der im Sand knirschenden großen Holzräder, das Quietschen der Deichsel und das Rumpeln der Ladung auf der hölzernen Wagenpritsche wahr. Hatte er geträumt? Wie hatte ihm das Näherkommen des Karrens entgehen können? Ängstlich duckte er sich am Wegesrand und ging in die Hocke, in der Hoffnung, vielleicht nicht wahrgenommen zu werden. Den alten Mann, der scheinbar schlafend hinter der Karre herzottelte, hatte er bereits erspäht. Er kannte ihn: Don Burro, Herr Esel! So riefen ihn alle, wegen seiner Esel, die er auf einer kleinen Landwirtschaft außerhalb Palos züchtete. Er verlieh die Tiere, verkaufte sie, schlachtete sie oder richtete sie als Zug- und Lasttiere ab. Zwar sah Don Burro aus wie ein heruntergekommener Landstreicher und Bettler, aber jeder in Palos wusste, dass der Alte wohlhabend war, dazu geizig und misstrauisch. Er besaß keine Familie, keine Frau, keine Kinder. Manchmal kam er in die Stadt, betrank sich mit Augenmaß in der Spelunke „Zur Schildkröte“ drunten im Hafen und beschimpfte die Hidalgos und die Mesta, die Zunft der Schafzüchter, mit denen er in Dauerfehde lag. Dann suchte er sich eine der Dorfnutten. Früher, als sie noch ansehnlich und rank war, war das oft auch Miguels Mutter gewesen. Dann tauschte der alte Eselzüchter ein Huhn, einen Sack voller Gemüse, ein kleines Fässchen Wein oder andere Naturalien gegen das zweifelhafte Vergnügen, unter einen Rock zu gelangen, der vor ihm schon zahlreiche andere Besucher hat kommen und gehen sehen. Jedenfalls kannte Miguel den alten Don Burro, nicht zuletzt durch die Anekdoten, die über den Alten im Ort die Runde machten.
Als der Eselskarren den Jungen bereits überholt hatte, drückte Miguel sich noch dichter ins Gras. Don Burro döste immer noch. Sein Maulesel verdrehte ohne Unterlass die Ohren, ohne jedoch die lästigen Fliegen, die ihn verfolgten, loszuwerden. Vielleicht zog das Gespann vorüber, ohne ihn zu entdecken?
Schon schlurfte der Alte, den Hut in der Stirn, vorbei, entfernte sich von Miguel. Da blieb er plötzlich stehen.
„Hooo!“, rief er mit einer Stimme, die knarrte wie ein altes Scheunentor. Sofort stoppte der Esel.
Don Burro hatte sich nicht umgedreht. Er hatte nicht zu Miguel herübergeschaut. Was mochte ihn zum Anhalten veranlasst haben? Der alte Eseltreiber blieb an Ort und Stelle stehen. Nur das klappernde Geräusch des ledernen Geschirrs war zu vernehmen, wenn der Esel sich unwillig schüttelte, um die Mücken loszuwerden, die ihn blut- und schweißgierig umkreisten.
„Hast du Durst?“, fragte die knurrige Stimme.
Miguel war viel zu erschrocken um zu antworten. Meinte er ihn? Oder sprach er mit seinem Esel?
„Kannst du nicht reden?“, lautete die nächste Frage. Jetzt endlich drehte Don Burro den Kopf etwas nach hinten, versteckte aber weiter die Augen unter der Krempe des Strohhutes. In dieser Pose, den Kopf und eine Schulter leicht nach rückwärts geneigt, verharrte er. Eile kannte er keine. Endlich fragte er noch einmal: „Hast du Durst, Junge!“
Miguel, inzwischen aus seiner Angststarre gelöst, nickte und stammelte: „Jjj... jaa!“
„Na also!“, brummte der Eseltreiber und griff nach einem halbvollen ledernen Wasserbeutel, der hinten am Eselkarren aufgehängt war. „Taubstumm bist du also nicht.“
Er öffnete den Verschluss seines Wasserbeutels und reichte ihn Richtung Miguel. Der Junge stand aber zu weit weg, um ihn erreichen zu können. Miguel stand auf und näherte sich vorsichtig. Da zog Don Burro die Flasche in letzter Sekunde weg.
„Sag mir erst, wie du heißt!“
„Mmmi... Mi... Miguel!“
“Miguel!“, wiederholte der Alte und fügte dann hinzu: „Du stotterst ja. Wegen mir?“
„Nnn... nein!“
Er reichte dem Jungen den Wasserbeutel und beobachtete mit listigen Augen aufmerksam unter der Hutkrempe hervor, wie das Kind in gierigen Zügen seinen Durst stillte.
Während er trank, schielte Miguel heimlich hinter der Wasserflasche hervor zu dem alten Mann. Unter dem Strohhut verschwanden die Augen Don Burros fast, Miguel nahm nur zwei schmale Schlitze wahr. Sein Gesicht glich einer ausgetrockneten Feige: Falten, Schrunden und Runzeln zogen sich über Wangen, Kinn und Mundwinkel wie Furchen in einem ausgedörrten Bachbett. Der knotige Mund mit den aufgesprungenen Lippen begann rechts oben fast neben der Nase und hing dann schräg im Gesicht. Er sah aus wie eine nach innen gestülpte Socke, und als Don Burro jetzt über den Durst des Jungen grinste, offenbarte sich ein einziger gelber Schneidezahn. Das war kein Gesicht, vor dem man Angst haben musste. Miguel sowieso nicht. Er hatte schon ganz andere Antlitze gesehen: zerfurchte und missgestaltete Seemannsgesichter, aussätzige, leichenbleiche, schorfige, skrofulöse, von monströsen Geschwüren, Narben und Verwüstungen gezeichnete Fratzen. Nein, das hier war ein Gesicht zum Bestaunen. Voller Lebensspuren. Voller Geschichten. Don Burro schob seinen Strohhut etwas weiter in den Nacken, um einen Schluck aus der Wasserflasche zu nehmen.
„Du kommst aus Palos.“ Es war eine Feststellung, keine Frage.
Miguel nickte.
„Und du willst nicht wieder zurück!“ Don Burro sah dem Jungen ziemlich genau an, was ihn bewegte.
Miguel nickte nach kurzem Zögern erneut.
„Verstehe!“, sagte Don Burro und ließ einen Furz fahren, der seinem Esel zur Ehre gereicht hätte. Er machte keine Anstalten, seinen Weg fortzusetzen. Stattdessen musterte er Miguel ausführlich von oben bis unten. Der Junge sagte nichts, stand nur da und schlug die Augen nieder.
Nachdem der Eseltreiber sich endlich ein Urteil gebildet hatte, erklärte er: „Klein bist du, dünn und schmal. Halb verhungert. Kannst du irgendetwas?“
Miguel blieb stumm.
„Kannst du eine Karre führen?“
„Nn ...nein!“
„Kannst du lesen oder schreiben?“
„Nn ... nein!“
„Dacht ich’s mir. Wär’ ja auch zu schön gewesen!“ Don Burro erläuterte nicht, was sich hinter dieser Bemerkung verbarg. Stattdessen nörgelte er, mehr zu sich selbst als zu Miguel: „Du kannst ja nicht mal sprechen.“
„Nn ... nein, nnn ... ja!“ Miguel traten Tränen ins Gesicht. Ja, es stimmte, er stotterte bei fast allen Gelegenheiten: wenn er aufgeregt war, wenn Fremde ihn ansprachen, wenn er etwas erklären wollte. Nur wenn sein großer Bruder Rodrigo dabei war stotterte er nie.
Don Burro kicherte, Miguels Tränen übersah er. Er sprach zu sich selbst: „Kann nicht lesen, kann nicht schreiben, kann nicht sprechen, hi, hi, hi. Schönen Fund hast du da gemacht, Don Burro! Ganz famos, ganz famos!“
Der Eseltreiber drehte sich ohne weiteren Kommentar zu seinem Karren um, schnorrte ein „Hooo!“ Richtung Esel, und dieser setzte sich wieder in Bewegung. Miguel würdigte er keines Blickes mehr, als hätte es die Begegnung nie gegeben.
Aus tränenfeuchten Augen blickte Miguel dem sich langsam entfernenden Eselkarren nach. Don Burro war wieder unter seinem Hut versunken und trottete in Trance dem Karren hinterher.
Auch Miguel setzte sich in Bewegung. Etwa 30 Schritt hinter dem Eselkarren folgte er Don Burro. Was ihn dazu bewog, hätte er in diesem Moment nicht erklären können. Eine andere Richtung kam jedenfalls nicht in Frage.
Und so näherte sich das ungleiche Paar dem Franziskanerkloster La Rabida. Die große Pforte stand offen. Man betrat das Kloster durch ein großes spitzbogiges Tor, das in einen schmucklosen Gang führte, aus dem links und rechts mehrere Pforten abgingen und der in einen lichten Innenhof führte. Don Burro und sein Esel kannten sich wohl aus, denn weder zögerte der Esel vor dem offenen Tor noch klopfte sein Herr an, ehe er den Klosterinnenraum betrat.
Miguel blieb unschlüssig vor dem geöffneten doppelflügeligen Holztor stehen und sah skeptisch an der steinernen Mauer empor, die vier Mannshöhen vor ihm aufragte und oben von einem überkragenden Ziegeldach begrenzt war. Er setzte sich vorsichtig neben dem Tor ins dürre Gras, den mageren Rücken an die Klostermauer gelehnt. Er beschloss, hier zu warten, denn er empfand es als ungehörig, das Kloster ungefragt zu betreten.
Don Burro war in der Tat ein häufiger Besucher hier. Das Monasterio de la Rabida war kein besonders großes Kloster der Franziskaner. Es lebten dort nur etwa ein Dutzend Brüder, im Wesentlichen von dem, was sie durch kluges Betteln den großherzigen Gönnern in Huelva, Palos und Moguer an Naturalien, Wertsachen und Gerätschaften abschwatzen konnten. Eifrige Laienbrüder bewirtschafteten die paar Ländereien, die zum Kloster gehörten. Es reichte um zu überleben. Die Mönche zogen übers Land, predigten ohne Rücksicht auf die Ortsgeistlichen, boten Seelsorge aller Art und jedwede Form von Dienstleistungen, von der Abschrift alter Bücher, über das Anfertigen von Urkunden, bis zu Himmelsbeobachtungen, Sterndeutungen, medizinischem Beistand, Unterricht im Lesen, Schreiben, in der Mathematik, der Philosophie und der Theologie. Dienst am Menschen durch Arbeit und Gebet.
Auch Don Burro hatte derartige Dienstleistungen gelegentlich nötig. Er pflegte Kontakte zu La Rabida vor allem, um mit dem Kloster zu handeln: Waren gegen Hilfen geistiger Art.
Schon erschien die rundliche Gestalt von Prior Fray Juan Perez. Mit einem strahlenden Lächeln und weit ausgebreiteten Armen kam er auf Don Burro zugeeilt. Die braune Kutte des Mönchs wirbelte den Staub auf den maurischen Pflasterornamenten auf, mit denen der Innenhof ausgelegt war. Dem Gesicht des Vorstehers sah man an, dass er darauf eingestellt war, Don Burro zu hofieren. Was auch immer man sonst von Don Burro hielt, an Geschäften mit ihm war man im Kloster stets interessiert.
„Mein Lieber Bruder Esquivel“, sprach er Don Burro mit dessen eigentlichem Namen an, „das ist schön, dass wir Euch wiedersehen. So früh hatten wir gar nicht mit dem Besuch gerechnet. Tretet näher, tretet ein, seid willkommen.“
„Ja, ja, ja“, knurrte Don Burro Francisco Esquivel und spannte mit geübten Griffen den Esel aus. „Spart Euch Eure Litanei. Bin zu müde dafür.“ Er führte den Esel zu einem kleinen Brunnen an einer Seite des Innenhofes und zog dort prüfend an der Eimerkette.
„Es wäre bald mal wieder Regen fällig“, kommentierte er, während der Prior hinter ihm herwackelte und immer noch die Arme ausgebreitet hielt.
Francisco kurbelte einen hölzernen Eimer mit abgestandenem Wasser hoch, das er seinem Esel in eine steinerne Tränke neben dem Brunnen eingoss. Fray Juan Perez streifte die Kapuze seiner Kutte ab, als wollte er die Ohren frei bekommen, um Don Burros Genuschel besser verstehen zu können.
„Ich bin dieses Jahr früher dran, weil ich noch eine weite Reise vor mir habe. Ich ziehe gleich morgen weiter nach Sevilla.“ Er deutete auf die Ladung auf seinem Eselskarren und ergänzte: „Hab dort was abzuliefern. Großer Auftrag.“
„Mein Glückwunsch, bester Herr! Mögen die Geschäfte weiterhin so blühen. Der Herr sei mit Euch!“
„Pah! Glück?“ Don Burro spuckte die Worte fast aus. „Glück ist was für Memmen und Pfaffen. Unsereiner beackert ein dürres Stück Land und schwitzt sich jeden Silberling aus den Rippen. Ich bin der letzte freie Bauer auf dieser Seite des Rio Tinto. Alles Land gehört entweder der Krone und dem Adel oder der Kirche. Ich pfeife auf mein Glück.“ Er richtete sich auf und ließ den Wassereimer wieder in den Brunnen fallen, wo er sich geräuschvoll auf den Weg in die Tiefe machte, bis er mit einem deutlich vernehmbaren Prasseln aufs Neue im Wasser landete.
Fray Juan Perez lächelte immer noch. Seine roten Apfelbäckchen strahlten, nur die ausgebreiteten Arme hatte der Prior inzwischen eingeklappt und die Hände anmutig zum Gebet gefaltet.
„Ich habe wie immer Wein und Oliven für euch mitgebracht, und auch etwas Brotgetreide“, erklärte Don Burro in nüchternem Geschäftsmannton. „Es ist alles auf dem Karren!“
„Ich weiß nicht, ob ich das alles gleich bezahlen kann“, erwiderte Fray Juan betrübt. Sein Lächeln blieb dabei unverändert quer über das runde Gesicht erhalten. „Ich sagte schon, wir haben nicht so früh mit Euch gerechnet.“
Don Burro hielt den Kopf leicht geneigt und blinzelte den Padre bauernschlau an. Er zögerte einen Moment mit der Antwort: „Ihr seid doch kluge und gelehrte Leute hier im Kloster, nicht war Fray Juan?“ Der Prior nickte.
„Und bisweilen zieht ihr auch gelehrsame Schüler groß, ist es nicht so?“
Wieder nickte der Prior.
„Nun seht, darum geht es mir. Einen solchen Schüler, den könnte ich gut gebrauchen. Einen, der folgsam ist und der lesen und schreiben kann. Ich brauch einen Burschen, der mein Schreiber werden soll. So einen suche ich. Habt Ihr einen solchen?“
Der Prior dachte nach und machte aber eine betrübte Miene: „Es ist bedauerlich, Señor Esquivel, ganz bedauerlich. Aber gerade in diesem Jahr sind wir ohne Zöglinge. Wir haben einen Jungen ausgebildet, der jetzt in Cadiz für einen edlen Hidalgo die Bücher führt. Erst einen Monat ist es her, dass er abgereist ist.“ Er wackelte mit seinem kürbisrunden Schädel und leckte nervös die dicken Lippen. Don Burro machte eine geringschätzige Geste mit der rechten Hand, fuhr mit ihr durch die Luft, als wolle er ein imaginäres Insekt verscheuchen. Mürrisch brummte er: „Und der dort? Was ist mit dem?“ Er zeigte, während er sprach, über den Innenhof des Klosters hinüber zum Kreuzgang, wo im Schatten des Gewölbes ein Knabe zu erkennen war, der sich mit einem älteren Padre unterhielt.
Das Mondgesicht des Priors verzog sich zu einer Grimasse, die innere Qual ausdrücken sollte: „Oh, oh! Nein! Das ist ein Sonderfall. Das ist kein Novize, das ist kein Schüler. Das ist der Sohn des Admirals, ein Herr von edler Abstammung. Er genießt den Schutz und das Wohlwollen unserer königlichen Majestäten Ferdinand und Isabella. Über diesen jungen Herrn können wir bescheidenen Mönche nicht verfügen.“
„Ein Söhnchen also, was?“, schimpfte der Eselhändler. „Wie sagtet ihr? Der Sohn des Admirals?“ Er spuckte verächtlich einen grüngelben Fladen Schleim aus, den er zuvor geräuschvoll aus den Tiefen seines rasselnden Brustkorbes heraufgezogen hatte. „Der Admiral? Etwa der ...?“ Er musste die Frage nicht aussprechen, schon bestätigte Fray Juan: „Es ist Diego Colón, der Sohn von Christóbal Colón, der heute Morgen mit den Pinzons ausgefahren ist.“
„Ei, sieh mal an“, brummte Don Burro und blinzelte gegen die Sonne, als er versuchte, den Knaben im Schatten des Kreuzganges etwas deutlicher wahrzunehmen. Es handelte sich um einen schmalen, etwas bleichen und nicht besonders groß gewachsenen Jungen. Er stand vor einem Padre, der sich entspannt mit dem halben Hintern auf das hüfthohe Mäuerchen gesetzt hatte, auf dem die Bögen des Kreuzganges aufsetzten. Offensichtlich erzählte der Junge dem Padre etwas, und dieser hörte geduldig zu.
„Das ist Bruder Fray Antonio de Marchena“, erläuterte Fray Juan Perez ungefragt. „Er unterrichtet den jungen Herrn in Himmelskunde.“ Der Prior unternahm einen weitschweifigen Anlauf, dem Eseltreiber zu erläutern, was alles zu den Künsten und Wissensgebieten eines „Astrolog“ gehörte. Außerdem erklärte er wortreich, dass die Franziskaner von La Rabida den jungen Colón bereits vor sieben Jahren als Fünfjährigen aufgenommen und seither beherbergt und ausgebildet haben. Der hochedle Don Christóbal Colón bezahle für diese Ausbildung seines Sohnes Diego alljährlich eine stattliche Summe und sei auch sonst ein gerne gesehener Gast im Kloster. Aber Don Burro war längst mit den Gedanken irgendwo anders. Den schweren Falten, die wie Ackerfurchen seine Stirn durchzogen, war anzusehen, dass es in ihm rumorte und arbeitete, dass er etwas ausheckte.
Er schöpfte sich einen Schluck Wasser, wischte sich mit einem Lappen, der aussah, als hätte er bereits ungezählte Kreuzzüge der letzten Jahrhunderte mitgemacht, den Schweiß aus dem Gesicht, scheuchte damit die Fliegen zurück zum Esel und drehte dann demonstrativ dem Prior den Rücken zu. „Dann nehmt ihr also Knaben auf und gebt ihnen Quartier und Unterricht?“, fragte er listig.
„Ja, ja!“, bestätigte der Prior, indem er sich wieder zu Don Burro umwandte und mit zwei schnellen Schritten zu ihm aufschloss. „Aber natürlich nur, wenn seine Familie entsprechend für ihn bezahlt. Wir haben ja Unkosten. Wir sind arm. Wir sind keine Herberge.“
„Schon gut, schon gut“, winkte Don Burro ab und bewegte sich weiter mit seinen typischen schlurfenden Schritten Richtung Klostertor. „Ich hätte da einen Knaben für Euch. Den habe ich auf der Straße aufgelesen. Er sitzt draußen vor dem Tor.“
Der Prior setzte ein fragendes Gesicht auf. Don Burro kam zur Sache: „Könnt Ihr für mich diesen Knaben bei Euch aufnehmen und ihm das Lesen und das Schreiben beibringen? Und wenn ich im Dezember aus Sevilla zurückkomme, nehme ich ihn mit?“
Es entstand eine Pause, in der der Prior unverständlich vor sich hin brummte und nervös an seiner Kordel nestelte, die die Kutte über dem Bauch zusammenhielt.
„Bis Dezember?“
„Bis Dezember. Vielleicht wird es auch Januar.“
Fray Juan Perez schüttelte kläglich den runden Kopf. „Das sind vier Monate. In vier Monaten einem Knaben das Lesen und Schreiben beizubringen, das wird nicht einfach sein.“
Don Burro zeigte auf seinen voll beladenen Karren: „Es soll Euer Schaden nicht sein. Ich bezahle Euch für Eure Anstrengungen. Ihr braucht Wein und Oliven. Sagt mir, wie viel es kostet, einen Knaben auszubilden. Und wie lange es dauert.“
„Oh je, oh je!“ Der Prior kratzte sich aufgeregt an der Tonsur. „Da können Monate vergehen, oder ein Jahr. Bei manchen dauert es zwei. Andere lernen es nie. Außerdem braucht der Schüler ein Quartier, er muss verpflegt werden, er braucht zu essen und zu trinken.“
Während Fray Juan Perez noch rechnete und schwadronierte und dabei im Geiste abwog, wie viel er verlangen konnte, ohne dass Don Burro von dem sich anbahnenden Geschäft zurücktrat, nahm der Plan beim Eseltreiber Gestalt an. Er würde diesen hergelaufenen Jungen dem Kloster überantworten. Der Junge war ihm nachgelaufen, also musste er nicht lange um sein Einverständnis gefragt werden. Don Burro brauchte dringend einen Gehilfen, der lesen und schreiben konnte. Immer häufiger mussten Urkunden angelegt werden, Verträge waren anzufertigen, Listen zu führen, Rechnungen zu erstellen, Protokolle aufzusetzen. Der städtische Notar von Palos war teuer und selten verfügbar. Die Kaufleute, die lesen und schreiben konnten, befanden sich immer im Vorteil und nutzten diesen weidlich. Denn wer kein Papier für seine Geschäfte vorweisen konnte, dem konnte es passieren, dass seine Rechte nichts galten und seine Ansprüche nicht anerkannt wurden. Francisco Esquivel war ein einfacher Mann, aber er war kein Dummkopf. Er sah die Notwendigkeit, sich gegen die Kaufleute, Rechtsgelehrten, Notare, Pfaffen und die Bürokraten der Krone abzusichern, die mit ihm Geschäfte machten und die zunehmend glaubten, ihn über den Tisch ziehen zu können. Der Junge, der ihm nachgelaufen war, hatte das richtige Alter. Aus ihm würden die Franziskanermönche einen Schreiber machen. Dass Miguel, der noch immer draußen vor dem Tor an der Mauer lehnte, weder in diese Überlegungen eingeweiht, geschweige denn gefragt werden musste, stand für Don Burro fest. Ihm kamen keinerlei Bedenken, über den Knaben zu verfügen. Schließlich hatte er ihm zu verstehen gegeben, dass er aus Palos abgehauen war und nicht mehr dorthin zurückkehren wollte. Das genügte.
Miguel besaß kein Mitspracherecht. Er folgte den Padres, die ihn auf Geheiß des Priors ins Klosterinnere befahlen. Stumm und ohne zu verstehen, was man von ihm wollte, vernahm er die trockene Erklärung Don Burros und die feierliche Ansprache Fray Juan Perez’. Er begriff nur, dass er im Kloster bleiben sollte. Mit dieser Fügung zeigte er sich ganz und gar einverstanden. Don Burro legte ihm die Hand auf die Schulter und verabschiedete sich knapp mit der Ankündigung: „Im Dezember kannst du lesen und schreiben, dann hole ich dich ab!“
Die Padres steckten Miguel sogleich in die braune Kutte der Franziskaner. Sein Exemplar mochte einem erwachsenen Mönch gehört haben, vielleicht einem Kleinwüchsigen, aber es hüllte ihn ein wie ein überdimensionaler Sack. Mit Hilfe des weißen Stricks, den er sich um die dürren Hüften band, zerrte er das Habit so weit zurecht, dass er nicht bei jedem Schritt über den eigenen Saum stolperte.
Der Padre, der sich um ihn kümmerte, hieß Fray Garcia Hernandez, ein kleiner, grauer Kerl mit einer spitzen Nase und einer wichtigtuerisch hohen Stimme, die sich bei jedem zweiten Satz überschlug. Miguel trottete wie benommen hinter ihm her, hörte und verstand nicht einmal den zehnten Teil dessen, was der geschwätzige Fray Hernandez an ihn hin predigte. So taumelte er durch den Rest des Tages und landete schließlich völlig orientierungslos im Abendgottesdienst der Brüder, der Vesper, bei der ihm vor Erschöpfung die Augen zufielen. Der schnarchende Knabe auf der harten Holzbank in der Klosterkirche war zumindest für die Mönche eine Abwechslung während ihres Gottesdienstes. Solange der Prior es nicht bemerkte, grinsten sie sogar wohlwollend. Nur einer rümpfte die Nase. Es war Diego Colón, der 13-jährige Sohn von Admiral Christóbal Colón. Dieser Junge kniete auf seinem ihm zugewiesenen Platz in der Bank neben der Sakristei, und er war gar nicht davon angetan, dass nun ein weiterer Junge neben ihm zur Klostergemeinschaft gehörte.
Bei Diego handelte es sich um einen ausgesprochen eitlen, von sich eingenommenen, blasierten, aber zu allem Übel tatsächlich hochintelligenten Jungen. Die Mönche hatten ihn in vielen Wissenschaften ausgebildet, er beherrschte mehrere Sprachen: Spanisch, Portugiesisch, Genuesisch und Latein; er verstand viel von Geografie und Kartografie, disputierte mit den Mönchen über die Schriften von Toscanelli ebenso wie über die Reiseberichte des Marco Polo. Er war der Liebling von Fray Antonio de Marchena, dem Sternseher, dem Mönch mit Kenntnissen von den Gestirnen und Himmelsdingen. Diese bevorzugte Position erhob ihn über alle anderen Klosterinsassen, insbesonder aber über einen hergelaufenen Hungerleider wie Miguel einer war.
Diego Colón trug keine Franziskanerkutte. Sein Status war der eines Gastes und Schülers, neuerdings nochmals um ein Vielfaches emporgehoben, denn es stand seit dem Frühjahr 1492 die Zusage der königlichen Majestäten Ferdinand und Isabella, den Sohn des Admirals an den Hof zu holen und ihn als Pagen bei Prinz Johann dienen zu lassen. Gab es eine höhere Auszeichnung, von der in Kastilien ein Knabe träumen konnte, selbst wenn er aus dem edelsten Geschlecht stammte?
So trug Diego Colón bereits als Dreizehnjähriger die Nase höher als jeder andere im Umkreis von hundert Leguas. Mit Miguel, dem stotternden Neuling im Konvent, würde er ohne Not kein Wort wechseln, so viel stand fest. Es musste diesem Bettlerjungen, den der Prior zur Ausbildung in die Obhut des einfältigen Fray Garcia gegeben hatte, sofort und unmissverständlich demonstriert werden, wer Herr und wer Knecht war. Und deshalb lauerte Diego bereits am nächsten Tag dem Neuankömmling auf. Miguel, eingeschüchtert wie ein Hase auf dem Wochenmarkt, machte in der besinnlichen Pause zwischen der Terz, dem vierten Gottesdienst des Tages, und der Sext, dem Mittagsgottesdienst, einen ersten Gang durch die Klostergemäuer. Fray Garcia hatte ihn ausdrücklich dazu ermuntert. Er solle sich umschauen, alle Räume und alle Gebäude kennenlernen. So erreichte er, indem er das Refektorium durchquerte, den Kapitelsaal, ein spartanisch eingerichteter Versammlungsraum, dessen niedere Decke von schweren Holzbalken getragen wurde. Rundum säumten hölzerne schwarze Bänke die Längs- und Stirnseiten des Raumes. Die Bank an der hinteren Stirnseite stand leicht erhöht und verfügte, anders als die Bänke auf den Längsseiten, über geschwungene Armlehnen. Dort saß Diego Colón, als Miguel den Raum betrat. Der blässliche Admiralssohn funkelte Miguel aus kalten Augen an und befahl: „Knie nieder, du Nichtsnutz. Und wage es nicht, die Augen auf mich zu richten. Schau auf den Boden!“
Miguel befolgte unverzüglich diese Anordnungen. Die Stimme des um drei Jahre älteren Admiralssohnes klang kalt und herrisch, herablassend und unduldsam. Miguel zitterte vor Respekt. Regungslos verharrte er auf den Knien, den Blick zu Boden gerichtet, und wagte nicht, etwas zu fragen oder sich zu rühren.
„Sprich! Wer bist du, Gemeiner? Wie ist dein Name, wo kommst du her, wie heißen deine Eltern?“, forderte die frostige Stimme.
Wie gelähmt verharrte Miguel.
Schließlich stammelte er: „Mmm ... Miguel, Miguel Sanchez!“
„Lauter!“, kommandierte der Admiralssohn.
„Mi... Mi ... Miguel ... Miguel Sa ... Sa .... Sanchez, Sanchez de Palos“, brachte Miguel schließlich heraus. Es trat eine kurze Pause bedrohlichen Schweigens ein.
„Und weiter!“, donnerte der junge Colón.
„U... u ... und ... au... au ... aus Palos!“
„Deine Eltern!“, kläffte Colón, hämisch und schadenfroh.
„M... m ... mmmm .... mmmm ....“ Es war unmöglich. Das Stottern verknotete Miguels Zunge. Außer Konsonanten und Krächzlauten brachte er nichts mehr über die Lippen. Diego Colón ließ ihn genüsslich immer wieder neu Anlauf nehmen. „Mmmm ... mmmm ... mmmm ...“, stammelte Miguel. Aber je mehr er sich anstrengte, desto mehr blockierte er. Noch unterdrückte er tapfer die Tränen, aber schon war sein Gesicht gerötet vor Anstrengung und Scham. Ungerührt wühlte Diego weiter in der Pein. Er erhob sich von seiner Bank und schritt mit der ernsten Miene eines königlichen Würdenträgers in die Mitte des Raumes, wo er schweigend stehen blieb. „Ich warte!“, kommentierte er schneidend und ließ Miguel weitere hilflose Versuche unternehmen, einen Satz zu formulieren. Um die Demütigung vollständig zu machen, befahl er dem Jüngeren schließlich, sich flach auf den Bauch hinzulegen und in dieser Position so lange liegen zu bleiben, bis er ihm die Erlaubnis erteile, wieder aufzustehen. Nachdem er es etwa zehn Minuten genossen hatte, den zitternden Knaben so vor sich ausgebreitet zu sehen, verließ Diego Colón den Kapitelsaal, um für einige Zeit seinen üblichen Vormittagsbeschäftigungen nachzugehen. Nach etwa einer Stunde kehrte er zurück um zu kontrollieren, ob der Junge noch so lag, wie er ihn verlassen hatte. Miguel hatte nicht die geringste Bewegung gewagt. Eine Stunde lang hatte er sich nicht vom Fleck gerührt. Er lag noch immer flach auf den Steinplatten, gelähmt vor Scham, Erniedrigung und Demütigung. Mit diabolischem Vergnügen entdeckte Diego Colón die feuchte Pfütze, die sich unter Miguels Kutte ausgebreitet hatte. „Du liegst in deiner eigenen Pisse und kannst nicht einmal deinen Namen aussprechen“, höhnte er verächtlich. „Was bist du nur für einer?“
Miguel blieb weiter auf dem Bauch liegen, den Kopf an die Steinplatten gepresst. So fand ihn um die Mittagsstunde Fray Garcia Hernandez.