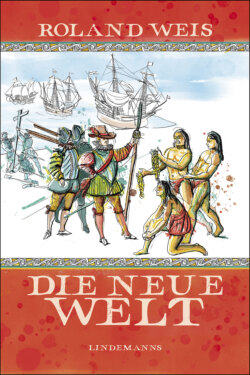Читать книгу Die neue Welt - Roland Weis - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеVIII. Der fremde Ozean
Dass irgendetwas mit dem Kompass nicht stimmte, fiel den Steuerleuten auf der Santa Maria etwa eine Woche nach der Ausfahrt zum ersten Mal auf. „Der Kompass ist verhext“, fürchtete der Leichtmatrose Jacomo Rico. Das Instrument bestand aus einer simplen Scheibe aus Pergament, auf der die Windrose eingezeichnet war – mit zweiunddreißig Fächern, den zweiunddreißig Kompassstrichen, unterschieden in Dreiecke, Rauten und Pfeile. Der Kompass lag in einer runden Schale, die an einem Zapfen so befestigt war, dass er sich mit den Bewegungen des Schiffs drehen konnte. Die Nadel, die Nord suchte, war mit einem Stück Magnetit magnetisiert worden.
Bitacora, so hieß das Kompasshäuschen, das darüber eine Schutzhaube bildete, um den Kompass vor den Unbilden des Wetters zu schützen. In der Bitacora stand ein Öllämpchen, um ihn nachts anzuleuchten.
Neben diesem wies an Bord noch ein zweiter Kompass die Richtung, der Steuer-Kompass. Er befand sich, alleine für den Gebrauch des Steuermannes, direkt neben der Ruderstange. Selbstverständlich verwahrte der Admiral weitere Reserveinstrumente und Nadeln in seiner Toldilla.
All dies erfuhr Rodrigo bereits in seinen ersten Tagen als Schiffsjunge. Vieles erklärte ihm Pablo, der viel schneller als Rodrigo begriff, wie das Schiff gesteuert wurde: Mit dem großen Außenbordruder, das mit einer hölzernen Ruderpinne verzapft war, konnte der Pilot den Kurs nach Belieben ändern. Am Vorderende der Ruderpinne, da wo der Rudergänger stand, erleichterten die Flaschenzüge der Entlastungstaljen jede Bewegung der Ruderstange. Selbst die Schiffsjungen konnten ohne großen Kraftaufwand das Steuerruder bewegen. An der Stelle, an der die Ruderpinne am Außenruder befestigt war, klaffte eine große Öffnung im Heck des Dreimasters, durch die gelegentlich auch Wellen hereinzüngelten, wenn das Schiff vor schwerer See herlief.
Der Rudergänger stand unten drin im Poopdeck und sah aus dieser Position von Segel, See und Himmel nichts. Er steuerte den Kurs nach seinem Steuer-Kompass und nach dem Gefühl, das ihm das Schiff gab. Außerdem stand über ihm auf dem Achterkastell der wachhabende Offizier, der die nötigen Befehle und Kursänderungen hinunterrief.
Nicht jeder durfte an die Ruderpinne, jedenfalls nicht, solange der Admiral in der Nähe stand. Aber in den langen Nachtwachen, besonders in der Grabeswache von Mitternacht bis vier Uhr morgens, stellte der Rudergänger schon mal einen der Schiffsjungen hin, um sich selbst ein Nickerchen zu gönnen. Es konnte bei gleichbleibendem Kurs und Wind nicht viel passieren. So meinte man.
Jedermann an Bord kam an beiden Kompassen an Deck täglich mehrfach vorbei und warf dabei gewohnheitsmäßig einen Blick darauf. So konnten die Matrosen selbst den Kurs kontrollieren, was viele auch eifrig taten. Allerdings gab es nicht viel abzulesen auf den Kompassscheiben, und welcher Matrose konnte schon lesen? Es waren weder die Namen der Winde noch die Anzahl der Grade oder die Abkürzungen für die Windrichtungen aufgeführt. Auf der Kompassscheibe stand nichts von alledem. Um die verschiedenen Richtungen voneinander zu unterscheiden, orientierte man sich an der Breite, der Form und der Farbe der verschiedenen Dreiecke, Rauten und Pfeile. Diese Zeichen kannte jeder auswendig. Nur der Norden war anders markiert, nämlich mit einer Lilie als unveränderlichem Symbol.
Mit viel Geduld erklärte Schiffseigner Juan de La Cosa Rodrigo und Pablo das Prinzip und die Bedeutung der einzelnen Zeichen. Zeit dafür gab es im täglichen Einerlei des Segelns genug. Dem erfahrenen Seemann schien es Spaß zu machen, vielleicht genoss er auch die unverblühmte Bewunderung, welche die Jungen vom ersten Tag an für ihn hegten. Obwohl Rodrigo bald all diese Einzelheiten begriffen hatte, fand er längst nicht den gleichen Gefallen wie Pablo daran. Für Rodrigo galt: Hauptsache die Santa Maria segelte, Hauptsache es gab täglich genug zu essen, niemand verprügelte ihn. Bei Pablo hingegen konnte es passieren, dass er zu Füßen des baskischen Besitzers der Santa Maria saß, dem Haudegen staunend zuhörte und davon träumte, selbst einmal als Kapitän eines Schiffes über die Meere zu segeln. Vollbeladen mit Schätzen und Reichtümern!
Am Dienstagnachmittag, 11. September, herrschte wieder einmal Aufregung auf der voraussegelnden Pinta. Die Mannschaft auf dem Schiff von Kapitän Martin Alonso Pinzon hatte irgendetwas entdeckt, was im Meer trieb. Über den großen Sprechtrichter und ein Rauchzeichen der Fumos machten die Pinta-Leute die Santa Maria darauf aufmerksam. Alle Mann stürzten an die Reling und starrten in die Wellen: Da nur leichter Seegang herrschte, erkannten alle das hölzerne Wrackteil, ein schwerer Maststumpf.
Juan de La Cosa ließ beidrehen. Der Admiral kam dazu und auch Peralonso Niño. Rodrigo, der nur ein paar Schritte von den hohen Herren entfernt stand, hörte, wie die drei sich über das Treibgut unterhielten.
„So wie das aussieht, gehörte der Mast zu einem größeren Schiff. 100 Toneladas würde ich schätzen“, sagte Juan de La Cosa.
„120 Toneladas“, bestimmte der Admiral. Niemand widersprach. Rodrigo begutachtete den abgebrochenen Mastbaum, der sich in geringer Entfernung an der Santa Maria vorbeiwälzte. Was musste das für ein mächtiges Schiff gewesen sein. Die Santa Maria brachte es auf gerade 100 Toneladas, Niña und Pinta auf je 60. Auch das gehörte zu den Dingen, die Rodrigo gelernt hatte: Mit dem Laderaum, der einem Schiff für den Transport kastilischer Weinfässer, Toneladas, zur Verfügung stand, bezeichneten die Seeleute die Tragfähigkeit ihrer Schiffe.
Der auf den Wellen vorbeitreibende Mast sah ramponiert aus und war erkennbar schon lange im Wasser. Ein paar Matrosen, die Baskenfreunde von Chachu dem Bootsmann, versuchten das Monstrum mit Haken und Tauen einzufangen. Aber der Versuch schlug fehl. Die Santa Maria machte noch zuviel Fahrt und der mächtige Stumpf torkelte an ihnen vorbei ins Kielwasser, wo er schnell wieder in den Wellen verschwand.
Rodrigo stand gerne dabei, wenn Pablo den Herren Offizieren mit Fragen auf die Nerven ging, die oftmals weit über den Seemannsalltag hinaus gingen: „Wie tief ist das Meer, Meister de La Cosa?“
Der Kapitän runzelte die Stirn. Pablos Frage gefiel ihm nicht. „Nimm das Lot und miss es nach!“, empfahl er mürrisch.
Pablo nahm sich den Matrosen José Pequinos zu Hilfe: „Hast du schon einmal gemessen, wie tief das Meer ist?“
Wie jeder weitgereiste Seemann, so hielt auch José Pequinos sofort einen unerschöpflichen Fundus von Geschichten und Erklärungen parat: „Das ist ganz unterschiedlich, mein Junge. Nähert man sich einem Hafen oder einem Ankerplatz, dann kann man die Leine auslaufen lassen, bis das Lot den Boden gefunden hat.“ Pequinos wettergegerbten, rissigen Hände spielten mit der Schnur und dem daran befestigten Bleikegel – er ließ beides durch die Finger gleiten: „Wenn das Lot aber auf keinen Grund stößt, was ist dann? Ich bin der Meinung, dass es gänzlich unmöglich ist, auf den Ozeanen irgendwo Grund zu finden, selbst wenn wir alle Leinen der Welt aneinanderknüpfen sollten.“
Rodrigo hörte ungläubig zu. War Wasser nicht überall gleich? Spielte es eine Rolle? Die Schiffe segelten, egal wie tief das Meer unter ihrem Kiel reichte.
Jacomo Rico, der kraushaarige, immer fröhliche Leichtmatrose, mischte sich ein, besserwisserisch, wie es seine Art war: „Das ist nicht wahr, José!“, verbesserte er Pequinos. „Was ich selbst erlebt habe ist, dass man mit dem Lot die Gegenden und Länder bestimmt, in denen man sich gerade befindet. Man wirft das Lot und wartet, welchen Grund es mit heraufbringt. Ist es Schlamm, dann sind wir in Venedig oder Genua, meiner Heimat.“ Er lächelte stolz und entblößte dabei seine weißen Zähne. „Bringt der Lotkegel aber Kies mit herauf, dann ist das guter Ankergrund und wir sind vielleicht vor der Bretagne. Wenn nichts mit heraufkommt, dann ist der Grund felsig und das deutet auf afrikanisches Gewässer hin.“ Jacomo Rico äußerte seine Überzeugungen mit unerschütterlichem Selbstbewusstsein.
Pequinos schüttelte nur den Kopf: „Das kann nur ein Genuese erzählen, der noch nie über Gibraltar hinausgekommen ist.“
Am Morgen des 13. September, eine Woche nach der Ausfahrt aus dem Hafen von San Sebastian auf La Gomera, blieb der Admiral länger als üblich an der Bitacora stehen. Rodrigo stand nahe dabei und sah, wie Colón mehrfach den Kopf schüttelte. Auch La Cosa fiel das Zögern des Admirals auf und er trat näher an Colón heran. „Was ist los, mein Herr?“
Christóbal Colón reckte seine hagere Gestalt, atmete tief ein und schloss die Augen, wie in stiller Andacht. Dann blickte er auf den Kompass und schüttelte erneut den Kopf: „Ich glaube ich träume, La Cosa! Wüßte ich nicht, dass der Allmächtige schützend die Hand über mich hält, müsste nun auch ich den Mut verlieren. Schaut Euch den Kompass an, Señor Kapitän!“
Der Kapitän und Schiffseigner folgte der Aufforderung. Rodrigo reckte sich, um ebenfalls einen Blick zu erhaschen.
Jetzt sah auch La Cosa erschrocken aus: „Admiral, die Nadel zeigt nicht mehr nach Nord. Sie steht einen halben Strich auf Nordwest!“
„Famos! Und was folgert Ihr daraus?“
La Cosa blieb still, zuckte die Schultern. Der Blick des Admirals fiel auf Rodrigo. „Hat irgendjemand am Kompass herumgespielt?“ Rodrigo verneinte.
„Behaltet das gut im Auge, La Cosa. Ich will sehen, was der Steuer-Kompass anzeigt.“
Colón kletterte hinunter zum Rudergänger, fand am dortigen Kompass aber offensichtlich das gleiche Phänomen vor.
„Habt Ihr eine Erklärung, Admiral?“, fragte La Cosa, sichtlich besorgt. Colón gab keine Antwort. Stattdessen blickte er grübelnd auf die rätselhafte Abweichung der Kompassnadel. „Vorläufig haltet den halben Strich nach West zu Süd. Wir warten die Nacht ab. Wenn der Polarstern auftaucht, können wir die Nadel überprüfen. Ich habe da einen Verdacht. Bis dahin La Cosa, kein Wort, zu niemandem! Das gilt auch für den Groumette! Ich muss meine Aufzeichnungen überprüfen, ob ich irgendwo eine Erklärung für dieses Phänomen finde.“
Alles, was Offiziere auf einem Schiff unter dem Siegel der Verschwiegenheit untereinander austauschen, macht so zuverlässig die Runde wie der Tripper in einem Freudenhaus. Kaum hatte der Admiral sich in seine Toldilla entfernt, winkte La Cosa Chachu den Bootsmann zu sich heran und zeigte ihm die Kompassnadel. Es dauerte nicht lange, da wusste die halbe Mannschaft von der rätselhaften Deklination. Das war La Cosa kaum zu verübeln. Weder er noch sonst jemand in der Mannschaft hatte je ein derartiges Phänomen erlebt. Wie sollte man diese Beobachtung geheimhalten?
La Cosa beriet sich auf dem Achterdeck mit Peralonso Niño und mit Chachu, auch Escobedo und Gutierrez kamen dazu. „Der Teufel lenkt die Flotte“, hörte Rodrigo Escobedo sagen. „Es wird Zeit, dass wir umkehren.“ Die tief in den Höhlen liegenden Augen des Notars blitzten aufrührerisch. Aber die übrigen Männer senkten die Köpfe.
Christóbal Colón ließ sich den ganzen Tag über nicht mehr blicken, er vergrub sich in seiner Toldilla. Nur der junge Pedro de Tereros, Colóns persönlicher Page, durfte hinein, um dem Admiral das Essen zu bringen. Als er wieder auftauchte, bestürmten die anderen den hochnäsigen Pagen mit Fragen: „Was macht er? Was hat er gesagt?“
Tereros warf sich wichtigtuerisch in die Brust: „Er hat gebetet und über seinen Karten gerechnet. Ich weiß nicht, was er macht.“
„Er betet“, höhnte Escobedo laut und schüttelte seinen Geierkopf. „Als ob Gebete helfen würden. Er soll um sein eigenes Seelenheil beten, aber das unsere möchten wir gerne selbst in die Hand nehmen.“ Um Zustimmung heischend, blickte Escobedo um sich.
Escobedo verstand es wieder einmal bestens, die aufgeregte Stimmung an Bord noch weiter zu schüren. Er bedrängte vor allem Juan de La Cosa: „Ihr seid ein erfahrener Kapitän. Herr, wie lange lasst Ihr Euch noch ins Bockshorn jagen? Wie lange glaubt Ihr noch das Märchen vom Seeweg nach Indien? Wo schon die Kompassnadeln ihre Richtung nicht mehr finden, wie sollen wir es tun? Nehmt das Kommando in die Hand, Señor La Cosa, und führt uns zurück!“
Die Matrosen standen in einzelnen Gruppen beisammen und führten hitzige Debatten. Im Mittelpunkt der Basken stand Chachu, der schwergewichtige Bootsmann. Seine Landsleute sahen allesamt so aus, als könnten sie jederzeit das Messer zwischen die Zähne nehmen und das Achterdeck entern. Anders als die vielen Seeleute aus Palos hatten sie schon zur Mannschaft der La Gallega gehört, bevor Christóbal Colón das Schiff in Palos übernommen hatte. Bei den Basken handelte es sich um einen verschworenen Haufen, knapp ein Dutzend verwegener Burschen, die ihrem Kapitän Juan de La Cosa treu ergeben waren. Mit der übrigen Mannschaft, den „Neuen“ aus Palos, wollten diese galizischen Eigenbrötler möglichst wenig zu tun haben. Der kleiderschrankbreite Chachu war ihr Anführer. Zu der Gruppe gehörte ein finsterer Bursche namens Lope Chips, der Schiffszimmermann und Kalfaterer, dann Diego Perez, der Kanonier, und Domingo Vizcaino, der Küfer der Santa Maria. Diese vier traten als die Wortführer der mehr als zehnköpfigen „Baskenbande“ auf, wie sie von den anderen an Bord genannt wurden.
Eine zweite Gruppe, die sich in den letzten Tagen auf dem Schiff zusammengefunden hatte, bestand aus den eher besonnenen und erfahreneren Matrosen aus Palos. Dazu gehörte der zerknitterte José Pequinos, stets mürrisch und wortfaul, aber im Grunde gutmütig, Rodrigo de Jerez, den alle „Graubart“ nannten, wegen seines wilden Bartwuchses, und Anton Callabres, ein freundlicher Kalabrier, der immerzu von seiner feurigen Geliebten in der Heimat schwärmte.
Einen eigenen Haufen bildeten die jungen Heißsporne und Aufschneider, Jacomo Rico zuvorderst, aber auch Pablo oder Juan de Medina, der Schneider, ein klappriges Bürschchen mit großem Mundwerk.
Zivilisten wie Escobedo, Gutierrez, Schatzmeister Sanchez de Segovia oder auch Harana, der Alguacil, gehörten ebenso einer eigenen Gruppe an wie auch die Offiziere Colón, de La Cosa, Niño und Maestre Juan Sanchez, der Schiffsarzt.
Dazwischen standen Einzelgänger wie der schöne Jakob oder der unbeliebte Kapitäns-Page Pedro de Tereros, der sich zu fein war, mit den einfachen Seeleuten zu verkehren. Juan Vecano, ein kränkelnder Matrose, der wegen seiner Krätze außerdem gemieden wurde, sowie Martin de Urtubia, der jüngste Schiffsjunge, verstockt und unnahbar. Rodrigo hielt sich bewusst von den Gruppen fern.
So befehligte Christóbal Colón keineswegs eine homogene Mannschaft. Die zusammengepferchten Männer verband weder eine klar definierte gemeinsame Meinung noch ein gemeinsames Interesse. Vielmehr bestimmten in diesem Gewirr von teilweise vernetzten Gruppen und Grüppchen viele Faktoren und Unwägbarkeiten die Freundschaften und Feindschaften, Eifersüchteleien und Rivalitäten. Je länger die Fahrt andauerte, desto schärfer bildeten sich die Spannungen heraus, desto gereizter reagierten die einen auf die anderen. Was war auf einer Nussschale auch anderes zu erwarten?
Als baskische Nao gebaut, rollte die Santa Maria als runder und behäbiger Frachtsegler stets hinter den beiden schnellen Karavellen Pinta und Niña her. Sie war zwar etwas länger und breiter als die beiden anderen Schiffe, aber alles in allem immer noch von eher bescheidenen Ausmaßen. Rund 25 Meter lang und keine acht Meter breit, bot sie wenig Rückzugsmöglichkeiten für den Einzelnen, selbst wenn er sich in die Laderäume im vollgepackten Zwischendeck verkroch oder in die Back, zwischen Segeltuch und Tauwerk. Ständig begegnete man sich, arbeitete, aß und betete miteinander, schlief Seite an Seite auf engstem Raum.
Als Colón nach einem Tag voller unausgeräumter Spannungen endlich am Abend aus seiner Toldilla auftauchte, lag eine gespannte Stille über dem Schiff. Man vernahm nur die natürlichen Geräusche des Segelns, das Spiel von Wind und Meer, das Ächzen der Rahen und der Takelage. Keine Rufe, keine lauten Kommandos, kein Gelächter, keine Scherze. Alles schielte zum Admiral hinüber. Colón wirkte munter und war guter Dinge. Er strahlte wie immer große Ruhe und Zuversicht aus, sein unerschütterliches Lächeln umspielte seine Lippen.
Die Abenddämmerung flutete in rotgelbem Farbenüberschwang über das Meer. Am Himmel stand bereits in gewohnter Pracht der Polarstern. Mit einem kurzen, prüfenden Blick überzeugte sich Colón, dass die Kompassnadeln noch immer einen halben Strich oder mehr vom Norden abwichen. Er winkte La Cosa und Peralonso Niño heran: „Stellt den Norden fest und markiert ihn!“, befahl er. „Ich glaube, ich kenne die Ursache der Abweichung.“
Den Norden feststellen und markieren! Zum ersten Mal sah Rodrigo nun diese alte Technik zur Ermittlung der Himmelsrichtung, die man den „Segensgruß des Piloten“ nannte. Er bestand darin, dass man den Arm erhob und die flache Hand zwischen den Augen in die Richtung des Polarsterns brachte, darauf die Hand in ihrer flachausgestreckten Haltung auf die Kompassrose herabsenkte und so feststellte, ob die Nadel von der wahren Nordrichtung abwich.
Bei dieser Probe nun stellten La Cosa und Peralonso Niño übereinstimmend fest, dass die Nadeln sogar um einen vollen Punkt abwichen. Verständnislose Gesichter bei den beiden Piloten und bei allen übrigen Männern, die nähergerückt waren. Nur der Admiral lächelte mild und selbstsicher. Sein zufriedener Blick in den Sternenhimmel machte die anderen noch ratloser. Zum ersten Mal erlebte Rodrigo Juan de La Cosa gereizt und aufgebracht: „Die Grundgesetze der Natur gelten hier nicht mehr“, hielt der Schiffseigner dem Admiral mit sich überschlagender Stimme vor. „Wir sind in eine Welt eingedrungen, in der unbekannte unheimliche Einflüsse regieren und der Kompass kein Führer mehr zu sein vermag. Führt uns zurück Colón, bevor wir alle verloren sind!“
Gestandene Männer, Seeleute mit der Erfahrung von tausenden von Seemeilen auf allen Meeren der bekannten Welt, unerschrockene Haudegen, prahlerische Aufschneider – sie alle schrumpften zu abergläubischen Zwergen angesichts einer zitternden Kompassnadel, die in die falsche Richtung zeigte. Nicht das Gerät löste die Bestürzung aus, das war nur ein Auslöser. Vielmehr sank den Männern der Mut angesichts der unbekannten Weite, in die sie Colón von Tag zu Tag tiefer hineinführte. Diese kleinmütige Furcht suchte sich ihr Ventil. Heute fand sie es in einem verwirrten Kompass, morgen würde es vielleicht ein geheimnisvolles Geräusch unter den Planken sein, übermorgen die Farbe des Meeres.
Hinter de La Cosa versammelten sich all die anderen: Niño, Escobedo und die ganze Mannschaft. In ihren finsteren Gesichtern stand Furcht. Sie suchten nach einer Begründung zur Umkehr. So weit durfte Colón es nicht kommen lassen, er musste jetzt jedes Wort abwägen. Es galt für ihn und den Erfolg seiner Mission, diesen ersten wirklich kritischen Moment zu überstehen. Seine wasserblauen Augen blitzten fröhlich. Er schien sich überhaupt keine Sorgen zu machen. Theatralisch zeigte er zum Polarstern hinauf: „Seht ihr alle den Polarstern da oben? Jeder von uns hat gelernt, dass die Magnetnadel sich an diesem Stern orientiert, dass dieser Stern also exakt unseren Norden bezeichnet. Ich bin aber zu dem Ergebnis gekommen, dass nicht unser Norden plötzlich verschwunden ist, oder die Nadeln in die falsche Richtung zeigen, sondern dass dieser Stern sich bewegt.“
Ein Raunen und Ausrufe des Erstaunens gingen durch die Reihen. Die meisten verstanden allerdings nicht, was diese Einschätzung zu bedeuten hatte. Aber jene, die es erahnten, wie der Kapitän oder der Steuermann, blickten ungläubig. Ihr nautisches Grundwissen hing von bestimmten Gewissheiten ab, die sie nicht ohne Weiteres von einem Tag auf den anderen aufzugeben bereit waren. Alle Mann blickten zum Himmel, als könnten sie sofort irgendwelche Bewegungen des Sterns wahrnehmen.
„Die Kompassnadel neigt sich Richtung Norden weiterhin zum richtigen Punkt“, führte Colón weiter aus. „Aber dieser Punkt unterscheidet sich von dem, welcher durch den Polarstern angegeben wird.“
Juan de La Cosa schüttelte zweifelnd den Kopf. Immerhin galt er als erfahrenster und kundigster Seemann. „Colón, Admiral, wie soll ich glauben, was Ihr da sagt, wo doch vor uns noch nie ein Pilot diese Beobachtung gemacht hat?“
Mit geradezu beängstigender Ruhe und Selbstsicherheit erwiderte Colón: „Wie sollte er auch? In diese Breiten, in die wir uns vorgewagt haben, hat bisher auch noch nie ein Seefahrer den Mut gehabt vorzudringen. Die Bewegung des Polarsterns am Himmelsbogen ist vielleicht nur aus unserer Warte so exakt zu ermitteln. Es ist eine Frage des Winkels, in dem man zu den Sternen steht. Versteht Ihr?“
La Cosa schaute zweifelnd zu Peralonso Niño. Außer diesen beiden und vielleicht noch dem einen oder anderen älteren Matrosen wusste niemand mit solchen Erläuterungen etwas anzufangen. Bewegungen der Himmelskörper? Polarstern? Neigungswinkel?
Letztlich schaffte es die ungeheure Selbstsicherheit des Admirals, die Gemüter halbwegs zu beruhigen. Alle spürten: So überzeugt konnte nur jemand sein, der sich seiner Sache sicher war.
„Wenn Ihr Recht habt, Euer Gnaden“, überlegte La Cosa, „dann müsste sich die Abweichung ja beständig ändern. Oder bewegt sich Eurer Meinung nach der Polarstern ruckartig und verharrt dann wieder in bestimmten Positionen für längere Zeit?“
Colón nickte: „Ihr vermutet richtig, Kapitän. Heute Morgen hatten wir einen halben Strich Abweichung. Jetzt haben wir soeben einen vollen Punkt Abweichung nach Nordwest festgestellt. Ich glaube, dass die Abweichung morgen früh nochmal eine andere sein wird. Und ich glaube, dass auch der Tag kommen wird, wo Polarstern und Nadeln wieder übereinstimmen werden. Mir scheint, dass unser Stern um jenen Punkt herum, den wir als Norden bezeichnen, eine Kreisbewegung beschreibt.“
Die Erklärung wirkte auf jeden Fall auf die Mannschaft und die Offiziersleute beruhigend, so sachlich und fachmännisch, wie der Admiral sie vortrug. Ob sie allerdings jedermann sogleich einleuchtete oder nicht, oder ob sie überhaupt verstanden wurde, blieb offen. Bei den meisten Matrosen kam lediglich an, dass Colón eine Erklärung präsentiert hatte, welche die erfahrenen Seeleute besänftigte. Mit einer Mischung aus Intuition und wagemutiger Spekulation, gepaart mit seinem Fachwissen und der Grandezza des Visionärs, kam Colón der Wahrheit auf die Spur. Er hatte wohl eher aus dem Gefühl heraus und weniger aus konkreter Berechnung die richtige Vermutung angestellt und als seine feste Überzeugung weitergegeben. Tatsächlich entdeckte er die tägliche Umdrehung der Polaris, beziehungsweise zog sie als Erklärung heran, obwohl er wohl nicht davon wusste, dass darüber an den Universitäten in Spanien, Italien oder Frankreich die Gelehrten bereits seit Jahren kontrovers diskutierten.
Die murrenden Stimmen wurden leiser, aber sie verstummten deshalb nicht.
„Bin gespannt, was er uns morgen erzählt, wenn vielleicht plötzlich der Mond verschwindet oder das Meer anfängt zu kochen!“, lästerte inmitten einer Gruppe erregter Männer der stets an Unfrieden interessierte Rodrigo de Escobedo. Der dürre Notar fuchtelte wild mit den Armen: „Sollen wir alles glauben, was dieser Wahnsinnige uns erzählt? Ich war an der Universität in Salamanca. Dort habe ich niemals von den Astronomen solchen Unsinn gehört, dass der Polarstern sich bewegen soll. Und das sind zuverlässige Gelehrte, die Besten, die es gibt. Wenn der Name Diego de Deza euch etwas sagt. Oder schon einmal vom berühmten Talavera gehört?“
Das war natürlich nicht der Fall, Escobedo hätte jeden beliebigen Namen erfinden können. Entscheidend war, dass er jenes Unbehagen schürte, das sich in der Mannschaft breitgemacht hatte und schon kurz nach der Abfahrt nicht mehr weichen wollte.
„Was glaubst du, Jakob?“, fragte Rodrigo seinen Beschützer und Freund. Die beiden saßen etwas abseits an der Reling, den Rücken angelehnt, die Knie angewinkelt, ein inzwischen gewohntes Bild. Jakob deutete zum Sternenhimmel: „Dort oben steht der Nordstern. Schau ihn dir doch an. Bewegt er sich etwa? Mir kann der Alte nichts erzählen. Irgendwas ist los mit unserem Kompass, das ist es.“
Rodrigo, der, ungeachtet des Vorfalls auf Gomera, oder gerade auch deswegen, für Admiral Christóbal Colón unverholene Bewunderung hegte, andererseits inzwischen aber auch großes Vertrauen zu Jakob gefasst hatte, wollte nicht so schnell urteilen: „Aber es könnte doch sein, dass es stimmt, was der Admiral erklärt hat?“
„Vieles könnte sein.“ Jakob legte den Arm um Rodrigos Schultern. „Es könnte auch etwas ganz anderes sein, was ich auch gehört habe ...“
„Was meinst du?“
Jakob flüsterte: „Es wäre möglich, dass wir über ein Magnetgebirge unter uns am Meeresgrund fahren. Es heißt, dass es auf den Meeresböden riesige Magnetfelsen gibt? Die ziehen alles auf den Grund, was magnetisch ist!“
Einige Sekunden ließ Jakob die Worte wirken, dann fuhr er fort, immer noch im Flüsterton: „Die empfindliche Kompassnadel registriert den Magnetfelsen natürlich als Erstes. Zunächst ganz schwach. Aber warte ab, wenn wir weiterfahren. Dann wird er die Nägel aus den Planken ziehen und dann nach und nach alle Eisenteile, die das Schiff zusammenhalten.“
Rodrigo ließ den Blick über die Decksplanken und die Aufbauten schweifen, ob schon Anzeichen des drohenden Zerfalls erkennbar wären. Aber nichts dergleichen. Die friedliche und stetige Fahrt durch ein zwar unbekanntes, aber bislang durchweg freundliches Meer, der klare Sternenhimmel, die milde Luft, die zuverlässig gleichbleibenden Segelgeräusche, das rhythmische Auf und Ab der Santa Maria bei ihrem leichtfüßigen Tanz Richtung Westen, all das kein Anlass zur Sorge. Standen diese unbeschwerten äußeren Umstände der Fahrt nicht in krassem Gegensatz zu den an die Wand gemalten Gefahren? Rodrigo erlebte die bisherige Reise als eine Abfolge angenehmer Tage – ausgenommen natürlich die rohe Machtdemonstration Escobedos im Laderaum. Zwar warteten an Bord immer Arbeit und Pflichten, vor allem die anstrengenden Wechsel zwischen Wach- und Freischichten, aber ansonsten empfand Rodrigo die Fahrt bislang als großartiges Erlebnis. Nach seiner Einschätzung waren der Flotte bislang noch keine ernsthaften Hindernisse begegnet. Rodrigo hegte unumstößliches Vertrauen zu Admiral Colón, mochten auch Männer wie Escobedo und Gutierrez ganz anderer Meinung sein.
Schiffseigner Juan de La Cosa, der beim Signalmann José Pequinos stand und die Kommandos überwachte, murmelte mehr zu sich selbst: „Der Pinzon macht das nicht lange mit. Irgendwann wird er die Machtprobe suchen.“
Obwohl nicht für ihn gedacht, verstand Pequinos die Worte sofort. Der alte Seebär kaute eine Weile daran, bis er ihre Bedeutung verdaut hatte. Dann erwiderte er dem verkniffen dreinschauenden Schiffseigner: „Kapitän, sagt das nicht zu laut. Manche hier an Bord warten nur darauf, dass sich bei Pinzon etwas tut.“
„Du glaubst auch nicht, dass der alte Fuchs noch lange neben Colón herfahren wird, oder?“
„Ich glaube gar nichts! Ich weiß nur, dass Martin Alonso Pinzon auf der Pinta die treuesten und besten Seefahrer Andalusiens versammelt hat. Und er gilt als der erfahrenste Kapitän weit und breit. Einem Genuesen folgen die nicht bis ans Ende ihrer Tage, das riecht man doch auf hundert Leguas Entfernung.“
La Cosa spuckte über die Reling, seine braunschwarzen Augen fixierten den alten Matrosen. Er schnaubte grimmig: „Colón ist der Admiral, das wissen auch die Pinzons. Und er hat die Vollmachten Ihrer Majestäten!“
„Aber er hat die Aufpasser der Krone am Hals, Escobedo und Gutierrez! Und Pinzon ist Pinzon. Ihr werdet schon sehen“, sagte Pequinos trotzig.
Am nächsten Morgen stürzte ein Feuerschein vom Himmel direkt ins Meer, ein verglühender Meteorit oder ein Komet. Trotz der Geschwindigkeit, in der es geschehen war, hatten einige Matrosen die Feuerflamme beobachtet, vor allem auf der Pinta, wo aufgeregte Schreie laut wurden. Auch diesen Vorfall nahm man als schlechtes Omen.