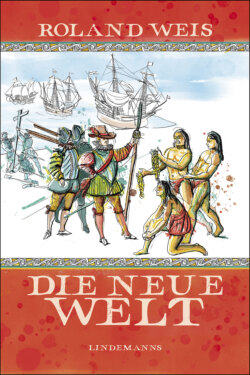Читать книгу Die neue Welt - Roland Weis - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеVII. Mord in der „Schildkröte“
Maestre Bezal stand wie immer hinter seiner selbst gezimmerten Brettertheke in der Spelunke „La Tortuga“ und panschte im Schutz des Bretterverschlages heimlich den Wein. Er streckte das Gesöff, das ohne diese „Veredelung“ mit Wein wenig zu tun hatte, mit ausgepresstem, mit Wasser vermischtem Saft von Roter Beete, Johannisbeeren, Zuckerrüben und Fallobst. Manchmal gab er noch etwas Bitterwasser hinein, zusammengerührt aus gestampften Walnussschalen. Schon sah die Brühe, die nach brackigem Hafenwasser schmeckte, im Schummerlicht der Kneipe wie roter Wein aus. Die armseligen Fischer, Handwerker, Seeleute und Tagediebe, die sich hier nach Einbruch der Dunkelheit versammelten, spülten das saure Gebräu hinunter, ohne auch nur eine Miene zu verziehen. Die Tatsache, dass sie trotz gewaltiger Mengen, die sie in sich hineinschütteten, kaum Ausfallserscheinungen hatten, dafür aber am Folgetag einen Schädel wie nach der Attacke durch einen Wespenschwarm, schrieben sie meistens ihrem Stehvermögen zu. Maestre Bezal kam jedenfalls seit Jahren ungeschoren davon. Als Kneipenwirt der „Schildkröte“ verdiente er nur ein karges Zubrot, denn die armseligen Hungerleider, die bei ihm einkehrten, hatten meistens selbst keinen Maravedi in der Tasche. Sie ließen anschreiben und vergaßen dann ihre Zeche für Monate und Jahre oder sie bezahlten in fragwürdigen Naturalien, brachten zwei Tage alte Fische, die auf dem Markt niemand mehr kaufen wollte, faulen Salat, ranzige Butter oder versteinerte Hühnereier. Maestre Bezal war das egal. Aus diesen Rohstoffen brühte er seine Suppe. Palos besaß mit der „Schildkröte“ die übelste Absteige Andalusiens. Ein einziger winziger und niedriger Raum mit steinernen Platten auf dem Lehmboden bildete die Wirtsstube. Zwei windschiefe Tische standen auf der Wandseite, links von der niedrigen Eingangstür. Gegenüber dieser hölzernen und fragwürdig in den Angeln hängenden Pforte befand sich Bezals Theke. Rechts der Tür stand eine grob gezimmerte lange Bank. Auf ihr behandelte Bezal tagsüber seine Patienten, denn er schimpfte sich auch Arzt und konnte über mangelnde Kundschaft nicht klagen. Er verabreichte mit beachtlichem Erfolg Klistiere, zog Zähne, vernähte Wunden, öffnete Furunkel, renkte ausgekugelte Gelenke ein und salbte mit selbst zusammengerührten Pasten die Skrofulösen, Gichtigen und Epileptischen ein, wobei die ranzige Pampe mehr juckte als jeder Aussatz, den einer nur haben konnte.
Daneben verdiente der Maestre seinen Lebensunterhalt noch als Barbier. Auch für die Kunden, denen er die Bärte stutzte oder die Haare rodete, benutzte er die lange Holzbank als Arbeitsplatz.
Jetzt aber, an diesem späten Abend im September, saß dort, die Bank zwischen die Schenkel genommen, die bis übers Knie bloßen Beine weit gespreizt, die alte Sanchez und lachte ihr kreischendes und affektiertes Geschäftslachen. Sie war auf Kunden aus. Seit die meisten Söhne von Palos mit der kleinen Flotte des Admiral Colón ausgefahren waren, herrschte Flaute im trüben Gewässer der Hurerei. Die Zurückgebliebenen waren Tagediebe und Habenichtse. Die anständigen Männer von Palos saßen zu Hause bei ihren Frauen. Die Zahlungskräftigen ließen sich ihreDirne nach Hause kommen oder besuchten ihre Lustdamen in deren Palästen in Huelva oder Sevilla. Für die Hure Sanchez im Hafen von Palos blieb nur der Abschaum übrig, der Bodensatz: zahnlose alte Männer, Krüppel, Säufer, Idioten oder Perverse. Sanchez gehörte längst selbst in diese Riege. Ihre ölig glänzenden Schenkel lockten im Zwielicht der Kneipe mit ordinärem Reiz, ihr breites Becken kreiste auf zwei prallen Pobacken unzweideutig auf der Bank, den Oberkörper beugte sie weit zurück, damit die drallen Brüste vorteilhaft zur Geltung kamen und nicht herunterhingen wie ausgepresste Datteln. Den Kopf mit der wallenden schwarzen Haarmähne warf sie kokett nach hinten. So gackerte sie aus einem zahnfaulen Mund ein einfältiges Lachen und rollte dazu die großen schwarzen Kugelaugen. Einst war sie die Dorfschönheit gewesen. Aber das war lange her. Übrig geblieben war eine abgelebte, marode Frau, die außer der allzeit bereiten Öffnung im Unterleib keinerlei Verlockungen mehr zu bieten hatte.
Sanchez war die Mutter von Rodrigo und Miguel Sanchez. Außer dem alten Seemann Pedro Vasquez, der sabbernd versuchte, seine Hand zwischen ihre Brüste zu schieben, interessierte sich an diesem Abend niemand für sie. Rund um die Brettertheke hatten sich einheimische Fischer um zwei fremde Seeleute versammelt, die mit großen Sprüchen und theatralischen Gesten von ihren jüngsten Fahrten und Abenteuern berichteten. Die beiden waren gerade erst von den kanarischen Inseln zurückgekehrt. Von dort brachten sie die letzten Neuigkeiten von der Indienflotte Admiral Christóbal Colóns mit.
„Es hat ein großes Abschiedsfest gegeben, im Palast der Gouverneurin“, so berichtete der eine der beiden Männer. Der andere ergänzte: „Sie haben den ganzen Palast leer gesoffen, so ausgetrocknet waren sie.“
„Und als sie nach Westen segelte, da qualmte der Pico de Teide wie ein rußiger Ofen. Drei Tage lang spuckte er nur schwarzen Rauch. Das hättet ihr sehen sollen!“
Die Fischer spitzten die Ohren und wollten weitere Details hören. „Habt ihr mit der Mannschaft gesprochen?“
„Wie geht es meinem Patron, Christóbal Quintero? Ihr müsstet ihn doch gesehen haben. Er ist der erste Offizier auf der Pinta?“
„Haben sie Nachrichten hinterlassen? Sollt ihr etwas ausrichten?“
„Sie hatten ein Problem mit einem ihrer Schiffe“, so wusste einer der beiden kanarischen Seeleute. „Bis das repariert war, sind sie auf den Inseln geblieben. Zwei oder drei Wochen ungefähr.“
„Man munkelt, es war Sabotage im Spiel. Einen Schiffsjungen haben sie deswegen drei Tage lang in den Palastkerker gesperrt“, so ergänzte der andere.
Während sie Auskünfte gaben und dabei fleißig eigene Ausschmückungen hinzufügten, taxierten die zwei fremden Seemänner aus ihren Augenwinkeln die Nutte gegenüber auf der Holzbank. Der Abend war freilich noch zu jung, um ihn schon derart zu besiegeln. War das die einzige Hure, die sich in diesem Hafen feilbot? Was kostete sie? Was bot sie? Mit welchen Krankheiten steckte sie ihre Freier an? Fragen, die die beiden fremden Seeleute ungeniert vor den Ohren der umstehenden Einheimischen untereinander diskutierten und zur öffentlichen Erörterung freimütig an Maestre Bezal richteten.
„Das ist Sanchez, von oben, von den Lehmhütten“, flüsterte Yanez de Montilla, ein schnauzbärtiger Seemann mit fettigen und strähnigen schwarzen Haaren. „Passt bloß auf, mit der ist nicht zu spaßen. Ihren letzten Freier hat sie umgebracht.“
„Sagt bloß?“, staunte der erste Seemann.
„Abgemurkst wie ein Schwein“, ergänzte Montilla. „Sie hat ihn hinterrücks abgestochen. Ein unberechenbares Luder. Drei Tage lang hat der arme Kerl gejammert und gebrüllt wie am Spieß. Dann war Schluss, dann ist er abgekratzt.“
Einer der umstehenden rauen Kerle lachte hönisch: „Da oben im Elendsviertel lebt nur Gesindel. Die haben ihn schreien und sterben lassen – und unterdessen seine Alte gevögelt.“
Ein anderer fügte hinzu: „Sogar ihre eigenen Söhne haben es nicht mehr ausgehalten. Die zwei Ältesten sind seither spurlos verschwunden. Entweder sie sind ausgebüchst, oder ...“ Er ließ offen, was er meinte. Sein Nachbar vollendete den angebrochenen Satz: „ ... oder sie hat die beiden ebenfalls abgemurkst. Zuzutrauen wär’s ihr auf jeden Fall.“
Die beiden fremden Seemänner konnten all diese Schauergeschichten nicht von ihrem Vorhaben abhalten. Im Gegenteil. Das machte die Hure besonders interessant. „Ein wildes Luder, wie es scheint“, fasste der eine zusammen und klopfte seinem Partner auf die Schultern: „Was meinst du, Luis, wollen wir sie zusammen reiten?“
Der lachte meckernd und winkte in die Runde der Zaungäste: „Lass nur Antonio, du hast den Vortritt. Ich trinke solange noch einen mit den Herren hier!“
In das zustimmende Gelächter und Schulterklopfen, das dieser als Einladung empfundenen Ankündigung folgte, schlug krachend die Eingangstür der „Schildkröte“ auf. Zwei Männer traten ein und nahmen sofort alle Aufmerksamkeit in Anspruch, indem sie sich raumfüllend, laut und selbstbewusst in der Mitte der Spelunke aufbauten. Beide waren gut gekleidet, in schmucklose Gewänder, die aber erkennbar aus teuren Stoffen geschneidert waren. Außer den beiden fremden Seeleuten kannte jedermann im Raum die beiden: Martin Arias Pinzon und Juan Pinzon, die Söhne des Kaufmanns und Seefahrers Martin Alonso Pinzon. Augenblicklich trat Stille ein. Nur das billige Gelächter von Sanchez tönte noch nach, weil sie die Neuankömmlinge nicht schnell genug registrierte.
Die Pinzon-Söhne standen um Aufmerksamkeit heischend im Eingang und ließen suchend ihre Blicke über die Gäste gleiten. Dort auf der Bank die Hure mit dem betagten Freier Pedro Vasquez, der ihr ungeachtet seines hohen Alters an die Wäsche wollte; die Tische alle leer, an der Brettertheke eine Versammlung von einem halben Dutzend einheimischer Männer, in deren Mitte die zwei fremden Seeleute standen. Wie üblich stand Maestre Bezal hinter seinem Bretterverschlag, wo er jetzt den breiten, in die Wand eingelassenen, offenen Kamin befeuerte, obwohl es bereits sehr warm im Schankraum war. Aber das knisternde Feuer sorgte zusammen mit zwei tranigen Ölfunzeln an der Decke für die Beleuchtung in der „Schildkröte“. Der Raum besaß nur ein einziges schmales, schiefes Fenster. Die Schatten flackerten wild an den Wänden. Martin Arias Pinzon schlug seinen Mantel zurück, so dass der Griff seines Degens erkennbar wurde und jedermann sehen konnte, dass er bewaffnet war. Martin gehörte zu jener Sorte von Menschen, für die Macht- und Statusdemonstrationen in allen Lebenslagen dazugehörten. Wo er auftauchte, da trat er immer als der Sohn des Patron auf, als der reiche Pinzon, der Günstling des Glücks und der Herr über Hunderte von Bauern, Fischer, Handwerker, Matrosen und Tagelöhner. Dabei verströmte Martin Arias eine natürliche Autorität. Er füllte die Räume, die er betrat, mit seiner Ausstrahlung und seiner Präsenz. Dazu trug sein, trotz relativer Jugend, bereits fülliger, massiger Körperbau bei, seine Furcht einflößenden kleinen Schweinsäuglein, aus denen er Blicke abfeuern konnte, und sein schmaler, immer leicht verkniffen wirkender Mund, der seinen Zügen eine verschlagene Härte und Hinterhältigkeit gab, die ihm womöglich in dieser Ausprägung gar nicht innewohnte. Zum Respekt, den Martin Arias Pinzon verbreitete, trugen aber auch seine Intelligenz und seine Erfolge als Kaufmann bei. Er zählte erst knapp dreißig Jahre, blickte aber bereits auf mehrere erfolgreiche Kaufmannsfahrten zurück, im Mittelmeer bis an die Levante und im Atlantik bis hinunter zu den afrikanischen Küsten. Er führte die Geschäfte im Hause Pinzon, wenn der Alte unterwegs war, und jedermann wusste, dass er eines Tages die Nachfolge seines Vaters an der Spitze der Familie und in der Führung der Geschäfte antreten würde. Jedenfalls duckten die Menschen sich vor ihm und bezeugten unaufgefordert devoten Respekt. Auch jetzt, im Niemandsland der „Schildkröte“, nahmen all die rauen und unerschrockenen Männer, die hier versammelt waren, unaufgefordert zum Gruß ihre Mützen ab, senkten verlegen die Blicke und beugten leicht die Köpfe. Der „Herr“ war erschienen. Was auch immer ihn hierher getrieben hatte, er war hier nicht Gleicher unter Gleichen, sondern sofort der Ehrfurcht gebietende junge Patron, dem alle zu Gehorsam verpflichtet waren.
Ganz anders sein jüngerer Bruder. Juan Pinzon schleppte ungeachtet seiner erst knapp 25 Lebensjahre bereits einen nicht mehr revidierbaren Ruf als arroganter, überheblicher und vollkommen verzogener Schnösel mit sich herum. Er galt als faul, liderlich, aufgeblasen und gemeingefährlich. Seine Jähzornanfälle waren legendär. Er prügelte Angestellte und Untergebene, demütigte Frauen, beleidigte Menschen, mit denen er Geschäfte machte, denunzierte Mauren und ließ keine Gelegenheit aus, sich als Wüstling und übler Zecher zu etablieren. Dabei warf er mit dem Geld seiner Familie um sich, war aber gleichzeitig ein Taugenichts, der zuverlässig jedes Geschäft vermasselte, in das man ihn einbezog. Im Gegensatz zu Martin Arias wirkte Juan Pinzon alles andere als füllig. Trotz ausgiebiger Genusssucht war er schlank geblieben, nicht nur am Leib, auch in den Gesichtszügen. Er blickte aus kalten, schwarzen Augen, sein Mund spitzte sich ähnlich schmallippig wie der seines Bruders zu, wirkte aber im viel kantigeren Gesicht des Jüngeren energisch und draufgängerisch. So gab er eine sehr ansehnliche Figur ab, wirkte blendend auf Frauen, wusste sich auf dem Parkett zu bewegen, glänzte bisweilen auch als Stierkämpfer und gefiel sich selbst als Hidalgo und spanischer Grande. Er verachtete Conversos, hasste Morisken, fürchtete und verfluchte die Juden und versäumte keine Gelegenheit, dem heiligen Inquisitionsgericht in Madrid verdächtige Personen zu melden und sich als Informant wichtig zu machen.
„Es heißt, in Huelva hat ein Schiff aus Gran Canaria festgemacht und Matrosen von dort sollen nach Palos herauf gekommen sein“, sprach Martin Arias Pinzon in die merkwürdige Stille hinein. Er ließ den Blick über die Runde der versammelten Männer schweifen. Er kannte alle Einheimischen hier: den liderlichen Seemann Yanez de Montilla, der oft genug auf Schiffen der Pinzons mitgefahren war; er kannte Maestre Bezal, den zwielichtigen Wirt und Quacksalber und Lopez und Enrice, die zwei Fischer, Alonso, den Schäfer, der in seiner nach Schafscheiße stinkenden Felljacke schwitzend dazwischen stand; er kannte auch den alten Fabulierer Pedro Vasquez, der unverfroren die Brüste der Hure knetete, obwohl diese immer wieder versuchte, ihn wegzuschieben, wie ein lästiges Insekt. Und selbstverständlich kannte er auch Sanchez. Wer kannte sie nicht in Palos?
Nur die zwei Männer in der Mitte der Zecher, die waren ihm noch nie unter die Augen gekommen. Das mussten die Matrosen aus Gran Canaria sein.
Einer von ihnen, Luis, hob den Arm: „Hier, edler Herr, hier sind wir. Sehr zu Diensten, Luis de La Vega aus Las Palmas. Und das hier“, er zeigte auf seinen Gefährten und legte diesem den Arm um die Schulter, „ist mein Kamerad Antonio de Aribe von der Insel Gran Canaria.“
Mit einem breiten Lächeln, das wohl einladend gemeint war, aber verkniffen wirkte, schob sich Martin Arias Pinzon in die kleine Runde und orderte Wein: „Maestre Bezal. Ab jetzt geht die Rechnung auf die Familie Pinzon. Hol kühlen Wein aus dem Keller, aber von dem Guten, hörst du?“
Maestre Bezal nickte dienstbeflissen, sodass die wenigen Haarsträhnen, die seine fortgeschrittene Glatze dekorierten, flatterten wie Schiffswimpel. Dann verschwand er in einem niedrigen Kellerabgang an der Wand hinter der Theke.
Während die Eingeladenen die Familie Pinzon hochleben ließen und bereitwillig Platz für Martin Arias machten, wahrte dessen Bruder Juan mürrisch und missmutig Distanz. Es behagte ihm nicht, sich mit diesem Pöbel abzugeben. Der Widerwille stand ihm ins kalte Gesicht geschrieben. Nichtsdestotrotz ließ er sich von Maestre Bezal als Erster einen vollen Becher reichen und hatte ihn schon geleert, noch ehe die der übrigen Zecher auch nur alle gefüllt waren. Als sie endlich dem Gönner und Wohltäter dankend zuprosteten, nahm Juan Pinzon bereits den zweiten zu sich. Nachdem Martin Arias auf den fragenden Blick von Bezal zustimmend nickte, bekamen sogar der alte Pedro Vasquez und die Hure Sanchez ihre Ration. Daraufhin verlor Pedro vorübergehend das Interesse an deren Brustwarzen und gesellte sich zu den Männern an der Theke.
„Erzählt, erzählt!“, forderte Martin Arias die beiden Fremden auf. „Berichtet von unseren Schiffen und von ihrer Weiterfahrt nach Westen.“
Die beiden Seeleute wiederholten mit allen alten und etlichen neuen Ausschmückungen all das, was sie in Bruchstücken zuvor schon einmal erzählt hatten. Pinzon wollte jedes Detail wissen, fragte viel nach und ließ immer wieder die Becher nachschenken. Er selbst nahm davon allerdings wenig zu sich, ganz im Gegensatz zu seinem Bruder Juan, der wenig sprach, dafür unaufhörlich trank.
Luis und Antonio sparten nicht mit Ausschmückungen: „ ... und dann brach auch noch aus dem Vulkan des Pico del Teide ein Ascheregen heraus, wie man ihn seit Jahrzehnten auf Teneriffa nicht mehr erlebt hat.“ Luis de la Vega legte eine Pause ein, um die letzten Sätze wirken zu lassen, und nutzte die Unterbrechung, um einen tiefen Schluck zu nehmen. Inwischen füllte Bezal zum wiederholten Mal den Krug nach, und zwar mit einem Wein, der diesen Namen tatsächlich verdiente.
„Es lauert noch vieles auf dem Meer, noch viele Naturgewalten, viel schlimmere ...“, so ließ sich mit leichtem Lallen Antonio vernehmen.
„He, ihr Landratten, ihr Tölpel, hört mal einem echten Seefahrer zu!“, schwadronierte jetzt der alte Seebär Pedro Vasquez dazwischen. Pinzon ließ ihn gewähren, wusste er doch, dass der Alte als junger Mann tatsächlich viele ferne Meere befahren hatte und es bisweilen lohnte, ihm zuzuhören. „Da draußen auf dem Ozean, da passiert ihnen gar nichts, euren Leuten. Da fahren sie durch eine grüne Suppe, als hätte der Herr im Himmel Spinat ins Meer gestreut. Das ist es, was ihnen an Naturgewalten begegnet, und sonst nichts.“
„Woher willst du das wissen, Alter?“, schnauzte Juan Pinzon. „Du fabulierst, du weißt gar nichts!“
„Ha!“, ereiferte sich Pedro Vasquez. „Da warst du noch gar nicht auf der Welt, und dein Vater war ein junger Mann, und dein Großvater war mein Patron. Das ist vierzig Jahre und mehr schon her. Damals bin ich hinausgefahren mit Diego de Teive aus Madeira. Und wir haben dieses grüne Spinatmeer durchquert, so wahr mir Gott helfe, das schwöre ich bei der heiligen Jungfrau Maria, verflucht und gehörnt noch mal!“ Er spuckte einmal kräftig aus seinem zahnlosen Mund und fuchtelte mit dem halbgefüllten Glas herum, sodass die Fischer Lopez und Enrice in Deckung gehen mussten.
„Besoffner alter Spinner“, kommentierte Juan Pinzon abschätzig. „Aufschneider!“
„Dir sag ich’s Jüngelchen ...“, empörte sich der Alte, und musste vom besonnenen Martin Arias Pinzon sanft zurückgehalten werden, sonst wäre der alte Mann auf den jüngeren Bruder losgegangen.
In Anbetracht der drohenden Handgreiflichkeiten entfernten sich die Ersten aus der „Schildkröte“. Antonio, der Schäfer, wankte hinaus, um sich um seine Herde zu kümmern, bei der er irgendwo außerhalb der Stadt die Nacht verbringen würde.
Auch die zwei Fischer verdrückten sich. Für sie begann der morgige Tag in aller Frühe, noch bei Dunkelheit, und sie hatten für ihre Verhältnisse bereits viel zu viel Wein getrunken.
Yanez de Montilla, der Seemann, suchte den Blickkontakt mit Sanchez um auszuloten, ob sie nach dem vielen kostenlosen Wein vielleicht geneigt wäre, ihre Dienste in dieser Nacht ohne Gegenleistung feilzubieten. Es sah vielversprechend aus.
Nur Juan Pinzon schien sich in Rauflust getrunken zu haben. Ausgerechnet der steinalte Seemann Pedro Vasquez reizte seinen Jähzorn.
„Du weißt vom Meer so viel wie ein Schlachter vom Käse“, spottete der Alte und kümmerte sich nicht um die wachsende Erregung bei Juan Pinzon. „Ich sage dir etwas, du verzogener Knabe, pass auf: Als ich damals Lotse war, da kamen wir ganz weit draußen im Westen zu einer großen Insel. Da glänzten die Felsen aus purem Gold. Und nur weil plötzlich dichter Nebel einsetzte, Nebel, so dicht wie Rauch, verloren wir die Insel aus den Augen. Und das war jenseits der westlichsten Azoren, viel weiter im Westen. Da ist etwas! Das sage ich euch. Und das habe ich auch eurem Vater schon oft gesagt, dem edlen Herrn Martin Alonso.“ Er gluckste zufrieden. „Und das ist auch der Grund, warum sich Euer Herr Vater überhaupt nur auf diese Fahrt eingelassen hat. Weil er es von mir weiß, was dort draußen im Meer auf ihn wartet. Von mir, von mir weiß er es, von Pedro Vasquez de la Frontera.“ Er beendete seine Ausführungen mit einem kräftigen Rülpser, der ihn so durschüttelte, dass er sein gesamtes Weinglas über dem Wams von Juan Pinzon entleerte.
Der jüngere der beiden Pinzon-Brüder bebte. Er war ohnehin schon bis zur Weißglut gereizt. Der verschüttete Wein gab ihm den Rest. Wütend fletschte er die Zähne, packte den alten Mann am Hemdkragen und schleuderte ihn gegen die Brettertheke. Das bedurfte keiner sonderlichen Kraft, weil der alte Vasquez leicht wie ein morscher Ast war. Noch im Fallen schleuderte der unerschrockene alte Seebär seinen leeren Becher Richtung Juan Pinzon. Der duckte sich zu spät. Der Becher traf ihn im Gesicht unterhalb des rechten Auges, was seine Wut noch mehr anstachelte. Der Alkohol mochte das Seine dazu beitragen, jedenfalls zückte Juan Pinzon seinen Degen und bohrte die Spitze der Waffe mit einem wilden Ausfallschritt geradewegs dem Alten in die Brust. Martin Arias, der den Arm seines Bruders noch zurückreißen wollte, kam zu spät. Pedro Vasquez röchelte, spuckte schaumiges Blut und starrte ungläubig an sich hinunter. Langsam tasteten seine knochigen Hände nach der Stelle direkt am Herzen, wo Juan Pinzon ihn getroffen hatte.
Maestre Bezal stürmte mit seltsamen Jammerlauten hinter der Theke hervor, zu spät, um das angerichtete Unheil rückgängig zu machen. Pedro Vasquez lag bereits im Sterben. Schon verstand man nicht mehr, was er röchelte und stammelte. Die beiden Seeleute aus Gran Canaria, unvermittelt ernüchtert, drückten sich angstvoll an die Wand. Am liebsten hätten sie sich unsichtbar gemacht.
Yanez Montilla, der schmierige Seemann, nutzte die Verwirrung, um flink und geräuschlos der Hure Sanchez zu folgen, die, nachdem sie stummes Einverständnis signalisiert hatte, kurz vorher die Kneipe verlassen hatte.
Konsterniert stand Martin Arias Pinzon vor dem sterbenden alten Seebär, bei dem der hilflose Bezal kniete. Juan Pinzon grinste blöde und warf aggressive Blicke in die Runde. „Will sich jemand mit mir anlegen?“, fragten diese Blicke, und sie drohten gleichzeitig: „Dann fließt noch mehr Blut!“
„Du hast ihn umgebracht“, entfuhr es Martin Arias. „Meine Güte, was hast du getan?“
„Er hat mich angegriffen, er hat mich gereizt, verspottet, er hat ..., er hat ...“, haspelte Juan Pinzon mit hoher, sich überschlagender Stimme, aber sein Bruder unterbrach ihn: „Halt’s Maul. Er ist, ... er war ein alter Mann, und besoffen dazu!“
Der kühle und praktische Geist Martin Arias Pinzons begann zu arbeiten. Dieser Mord, denn nichts anderes war es, durfte nicht bekannt, er musste vertuscht werden. Wer war Zeuge gewesen? Pinzon wandte sich zu den beiden Seemännern aus Gran Canaria um. Sie schwiegen und zitterten. Er nickte ihnen zu: „Geht! Ihr habt nichts gesehen und nichts gehört. Morgen kommt ihr zur Casa Pinzon. Wir reden. Die Familie Pinzon wird eure Treue und euer Schweigen großzügig belohnen. Habt ihr verstanden?“
Die beiden nickten. Pinzon wiederholte: „Euer Schweigen wird belohnt werden. Geht jetzt!“
Antonio de Ariba und Luis de la Vega ließen sich nicht zweimal bitten. Schnell huschten sie aus der „Schildkröte“ hinaus und verschwanden zwischen den Gassen, wo sie sich ein Nachtlager suchten.
Maestre Bezal bedurfte keiner ausdrücklichen Unterweisungen. Als treuer Gefolgsmann der Familie Pinzon, vielfach in seinen Geschäften von den Pinzons abhängig und mit ihnen verbunden, blieb ihm gar keine andere Wahl als die Herren zu decken.
„Wohin mit der Leiche?“, fragte er nur und signalisierte damit gleichzeitig, dass die Pinzons ihn als Verbündeten betrachten durften.
Juan Pinzon grinste immer noch blöde, als könne sein aus den Fugen geratenes Gesicht ihn nachträglich ins Recht setzen. Es war Martin Arias, der handelte: „Wir legen ihn im Hafen in eines der Fischerboote“, bestimmte er. „Das ist gleich um die Ecke, da sieht uns keiner und es ist schnell erledigt. Vorwärts!“
So geschah es. Keiner dachte an Yanez de Montilla, den Seemann, der alles mitverfolgt hatte, ehe er Sanchez gefolgt war. Ein Zeuge, den sie besser nicht übersehen hätten.
In der Casa Pinzon wurden die Lichter in dieser Nacht nicht gelöscht. Die Damen des Hauses saßen ungeduldig in ihren breiten Korbstühlen und warteten auf die Rückkehr der Männer. Doch die Brüder tauchten bis in die frühen Morgenstunden nicht auf.
Am Abend, kurz vor Einbruch der Dämmerung, hatte ein Diener die Nachricht gebracht, dass ein Schiff aus Gran Canaria im Hafen von Huelva eingelaufen sei und dass mehrere Matrosen von diesem Schiff in Palos gesichtet worden wären. In aller Eile hatten sich die beiden Brüder aufgemacht, gierig nach Neuigkeiten. Den Frauen versprachen sie ihre baldige Rückkehr. Und weil auch die Frauen vor Neugierde platzten, die Mama Maria Alvarez ebenso wie die drei Töchter Catalina, Leonora und Isabella, blieben sie alle gemeinsam wach. Sie vertrieben sich die Zeit mit Handarbeiten, dann mit Karten- und Brettspielen. Zu fortgeschrittener Stunde machten sich Sorge und Unruhe breit. Da die Casa Pinzon eine halbe Legua außerhalb des Ortes gelegen war, hörten und sahen die Frauen nichts von dem, was drunten im Hafenstädtchen vor sich ging. Sie schickten schließlich gegen Mitternacht Nicolas den Stallmeister aus, um Klarheit zu bekommen. Dieser fand sowohl die „Schildkröte“ als auch die übrigen Hafenkneipen in Palos dunkel und verlassen vor, den Hafen schwarz und die Gassen leer, und nirgendwo eine Spur der beiden Pinzon-Brüder. Mit diesen Auskünften trug er bei seiner Rückkehr in der Casa Pinzon nicht gerade zur Beruhigung der Gemüter bei. Es blieb die Vermutung, dass die beiden Männer in Palos keinen der Matrosen angetroffen hatten und sich deshalb vielleicht auf den Weg nach Huelva gemacht haben. Wenn das der Fall war, dann nächtigten sie wohl dort. Dazu hätten sie allerdings mit einem Boot den Rio Tinto queren oder die flussaufwärts gelegene Furt bei Moguer benutzen müssen. Dann wären sie aber wieder an der Casa Pinzon vorbeigekommen und hätten ganz sicher Bescheid gesagt ...
Irgendwann in den Morgenstunden schlief die kleine Isabella schließlich ein. Die Amme Fernanda hob sie auf ihre Arme und brachte das Kind zu Bett. Die Mutter fand erst in den Schlaf, als bereits die Sonne über die Hügel geklettert kam. Übernächtigt reckten auch die beiden Schwestern ihre steifen Glieder.
„Wir lassen Alonso holen, damit er uns hilft“, schlug Catalina vor. „Es hilft alles nichts, wir als Frauen können uns ja wohl kaum auf die Suche machen.“
Leonora, ein verhuschtes, mausgraues Täubchen, verzogen und voller Angst vor der Welt, nickte stumm. Ihr war es recht, dass die viel entschlossenere Catalina die Entscheidungen traf. Außerdem wollte auch sie endlich schlafen. Sie unterdrückte ein Gähnen. Und Sorgentränen.
Sie schickten einen Boten aus, um Alonso Medel aus Moguer herbeizurufen, den Bräutigam Catalinas.
Unterdessen war Isabella wieder aufgewacht. Die frühen Sonnenstrahlen, die durch die hohen Fenster fielen, weil die Amme in der Nacht vergessen hatte, die Läden zu schließen, tauchten ihr Zimmer in feierliches, helles Licht. Draußen zirpten die Grillen bereits fleißig und die Vögel zwitscherten eifrig.
Es war aber der Lärm der Schweineherde, die wie allmorgendlich unter ihrem Fenster vorbeigetrieben wurde, der sie aus dem Schlaf gerissen hatte. Im Herbst verbrachten die Schweine die Nächte bereits in ihrem steinernen Koben, einem niedrigen Anbau an der rückwärtigen Seite der Casa Pinzon. Die Aufgabe des Schweinehirten war es, jeden Abend die Tiere dort hineinzuführen und sie am Morgen wieder in aller Frühe hinauszujagen und zu den Sumpflöchern und Suhlplätzen auf den Weiden zu treiben. Das fröhliche und aufgeregte Grunzen, Schnorcheln, Schnaufen und Quieken war Isabellas Morgenläuten.
Auch jetzt, obwohl sie kaum geschlafen hatte, sprang sie auf, schob die luftigen Decken beiseite.
Die Schweineherde, ein aufgeregtes vielschwänziges Rudel, in dem die zänkischen Muttertiere den Ton angaben, schwärmte aus. Vorneweg die aufgeregten Jungtiere, dann die Sauen mit ihren Bachen, oft zehn und mehr, wie an einer Perlenschnur aufgereiht, dazwischen die fetten Mastschweine, die nicht ahnten, dass im Herbst das Ende ihrer Tage nahte. Die Pinzons besaßen auch noch zwei monströse Eber, die ihr Schweinedasein in einem eigenen, von Mauern umfassten Gehege fristeten. Der Schweinehirte kümmerte sich um sie, sobald er die übrigen Tiere sicher auf ihren täglich wechselnden Weideplatz geführt hatte. Es war nicht mehr der Junge, den Isabella kannte. Seit einigen Wochen schon hütete ein neuer Hirte die Pinzon-Schweine. Wo war der alte geblieben? Der, der ihr immer seine schmachtenden Blicke zugeworfen hatte, wenn sie sich am Fenster zeigte? Der ihr im Hafen das Silberkettchen aus dem Wasser geholt hatte? Irgendwie war Rodrigo plötzlich verschwunden und der Verwalter hatte einen neuen eingestellt. Der gefiel ihr nicht; es war ein humpelnder alter Mann, vielleicht ein ehemaliger Seemann oder Fischer. Jedenfalls ein mürrischer Kerl.
Rodrigo war ihr Verehrer gewesen, das hatte sie gespürt, und das hatte ihr mächtig geschmeichelt. Wenngleich sie nie, niemals auch nur das kleinste Signal gegeben hätte, den Burschen zu ermuntern. Aber schön waren sie doch gewesen, seine offensichtlichen Bemühungen, einen Blick auf sie zu werfen oder ihre Stimme zu hören.
Und auch ihr zweiter Verehrer war verschwunden, der schöne Pablo. Von dem wusste sie immerhin, wo er geblieben war. Er hatte lange genug damit geprahlt, dass er als Schiffsjunge die Fahrt nach den indischen Ländern mitmachen würde. Die ganze Stadt wusste es. Beim Gedanken an Pablo pochte Isabellas Herz etwas schneller. Das war ein Junge! Aber auch Pablo Christóbal Perez, wie er mit vollem Namen hieß, war nur ein unbedeutender Dorfjunge, ein Habenichts, ein namenloser Tischlersohn, aus der Familie Perez, unten in der Stadt.
Es ziemte sich nicht für ein Mädchen von der Herkunft Isabellas, an einen solchen Jungen auch nur einen Gedanken zu verschwenden, mochte er noch so aufregend sein. Eines Tages würde sie als beste Partie von ganz Palos standesgemäß verheiratet werden. Einen jungen Hidalgo und Edelmann, einen Caballero, würde man für sie auswählen, vielleicht sogar einen Granden von den bedeutenden Familien, die am Hofe verkehrten. Das war die vorhersehbare Zukunft. Pablo war nur ein verbotener Traum.
Real hingegen war ein dritter Verehrer: der widerliche Alonso Medel aus Moguer, ihr Vetter, der schon früh an diesem Morgen auf seinem Pferd über die Hügel geprescht kam und in den Hof der Casa Pinzon stürmte, als gelte es, maurische Rebellen zu vertreiben.
„He, ho“, brüllte er, noch während er sich aus dem Sattel schwang. „Hier bin ich, euer treuer Diener.“ Er sah sich suchend um. Wollte ihn niemand in Empfang nehmen? Donna Maria Alvarez lag noch schlafend in ihrem Bett, ebenso ihre ältesten Töchter, seine Braut Catalina und die etwas jüngere Leonora. Die beiden hatten sich ja erst vor knapp einer Stunde hingelegt. Der Stallmeister war unterwegs, der Verwalter ebenso; die Knechte und Diener des Hauses galten nichts, sie waren Luft für den Besucher.
Es blieb also nur die kleine Isabella, ihn zu begrüßen und in Empfang zu nehmen. Begleitet von ihrer treuen Amme trat sie in den Hof. Gemäß ihrer Erziehung und entsprechend der Etikette, die man ihr mühsam beigebracht hatte, knickste sie artig vor dem Freund des Hauses, hieß ihn willkommen und bat ihn in die kühle Empfangshalle.
Die Amme übernahm es, das Warten der vergangenen Nacht zu schildern. „Und so war die Hoffnung der Señora, hochlöblicher Herr Alonso Medel, Ihr möget vielleicht in die Stadt hinuntergehen und nach dem Verbleib der beiden jungen Herren Pinzon sehen. Seid Ihr doch der einzige Edelmann, dem meine Herrinnen vertrauen können, und sehen sie Euch doch als baldiges Mitglied der Familie an, dem man als sich ängstigende Mutter und Schwester seine Sorgen und Nöte anvertrauen kann.“ Die Amme verstand es ausgezeichnet, dem blasierten Alonso so viel Honig einzuträufeln, dass dieser sich wie ein Held aus einem Ritterroman fühlte. Das beflügelte ihn derart, dass er sich ermutigt sah, Isabella sogleich zu umarmen und ihr die Stirn zu küssen. Steif stand sie im Raum, unfähig zu reagieren. Er aber machte eine theatralische Verbeugung und salbaderte drauflos: „Ich finde sie. Ich eile sofort. Seid unbesorgt, mein Herzchen. Bis Eure hochverehrten Schwestern und die Mama aufwachen, habe ich Eure Brüder gefunden. Das ist ein Ehrendienst.“ Er fügte noch allerlei verbale Verbeugungen und Beflissenheitsbezeugungen hinzu, aber Isabella blieb nur ein verstörendes Wort im Sinn: „Mein Herzchen!“ Diesen Kosenamen hatte er benutzt. Was für eine Unverschämtheit. Dieser ungezogene Wicht! Was nahm der sich heraus? Hoffentlich verschwand er bald.
Die Damen Pinzon hatten sich umsonst gesorgt. Alonso Medel wusste sofort, wo er seine künftigen Schwager finden würde. Die Kaufmannsfamilie Pinzon besaß neben den Ländereien zwischen Palos und Moguer, auf denen die Casa Pinzon stand, auch noch eine Reihe von Hütten und Lager am Hafen und dazwischen auch eine Faktoria, eine Handelsniederlassung, von wo aus die meisten der Fernhandelsgeschäfte abgewickelt wurden. Dort gab es genug Kammern, um die Nacht zu verbringen. Und tatsächlich traf Alonso dort auf die beiden Brüder, die bereits auf den Beinen waren und sich heißhungrig einem Frühstück widmeten, welches ihnen einer der dort beschäftigten Kanzleigehilfen vorgesetzt hatte.
Die Sympathien zwischen den Brüdern Pinzon und Alonso Medel hielten sich in Grenzen. Man mochte sich nicht wirklich. Martin Arias konnte mit dem eitlen Gecken wenig anfangen, vor allem weil Alonso Medels Heldentaten nur aus Worten bestanden. Er hatte bisher nicht einmal den Mut aufgebracht, an einer Schiffsreise seiner Familie teilzunehmen. Und Juan Pinzon, an Einbildung und Eitelkeit dem anderen in nichts nachstehend, sah in Alonso eher einen Rivalen als einen Partner oder Verwandten. Als der künftige Schwager und Vetter eintraf, warfen Martin und Juan sich jedenfalls einen kurzen Blick zu, mit dem sie sofortige Einigkeit darüber herstellten, vorerst still zu schweigen. Was in der vergangenen Nacht geschehen war, durfte niemand wissen. Es ging um die Ehre der Familie.
Zwar galt ein Menschenleben nicht viel in diesen Zeiten, und so mancher Mord blieb unverfolgt, wurde vertuscht, verdrängt oder gar allgemein begrüßt. Aber bei Pedro Vasquez hatte es sich um einen geachteten und stadtbekannten Seemann gehandelt, um einen Mann, der an ruhmreichen Fahrten teilgenommen hatte und dessen Wort unter Seeleuten etwas galt. Wenn dieser stadtbekannte Seemann in der Nacht ermordet worden war, das würde Palos empören und zu Nachforschungen führen. Die Stadt würde davon früh genug erfahren, sobald der Fischer, dem das entsprechende Boot gehörte, die Leiche darin fand.
Statt auf die Fragen Alonso Medels zu antworten, zeigte Martin Arias auf einen freien Stuhl und sagte zwischen zwei Bissen: „Setzt Euch zu uns und lasst Euch etwas zu essen bringen, verehrter Freund.“ Er nickte aufmunternd: „Dann erzählen wir Euch, was wir über die Flotte in Gran Canaria erfahren haben.“ Er verdrehte den Blick seiner Augen Richtung Zimmerdecke, als wolle er damit nächtliche Mühen andeuten, und ergänzte: „Und weil wir den zwei Matrosen, von denen wir das alles erfahren haben, erst die Kehle ölen mussten, war es eine sehr lange und anstrengende Nacht. Das ist auch der Grund, warum wir nicht mehr hinausgeritten sind, sondern hier übernachtet haben.“
Vorsichtig schielte Martin bei diesen letzten Worten erst zu Alonso, ob dieser die Erklärung schlucken würde, und dann zu seinem Bruder, ob dieser verstanden und die in die Welt gesetzte Version verinnerlicht hatte.
Beide Reaktionen stellten ihn zufrieden. Sein Bruder Juan grinste selbstgefällig, der Vetter nickte abwesend und zustimmend. Das Frühstück, das der Kanzleisekretär soeben auftrug, schien ihm wichtiger zu sein.