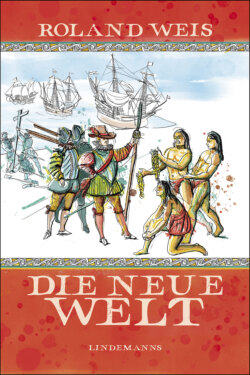Читать книгу Die neue Welt - Roland Weis - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеIII. Blinder Passagier
So stank es vielleicht in der Hölle: Ein säuerlich-schwefeliger Brodem aus Fäulnis und Verwesung schlug Rodrigo entgegen. Knietief stand das Brackwasser im Kielraum des Flaggschiffs. Es herrschte vollkommene Finsternis. Rodrigo musste sich auf sein Gehör, seinen Tastsinn und auf seine Nase verlassen. Aber weder die Geräusche noch die Gerüche waren vertrauenserweckend. Der Wellenschlag des Meeres an der Außenseite des Schiffsbauches verursachte ein bedrohliches Klopfen – mit jedem Heben und Senken des Schiffsrumpfes ein neuer Schlag. Vom Deck herunter drangen dumpf die fremden Geräusche des Schiffes: Klappern, Knarren und Flattern der Segel, Taue und Masten, das dumpfe Rauschen des Meeres, dazwischen die aufgeregten Stimmen der Matrosen, die lauten Kommandos, das Schimpfen, das Fluchen.
Zitternd tastete Rodrigo sich an der feucht-kalten Innenwand im Bauch der Gallega vorwärts. Schwere Bohlen, vertikale Stützen, horizontale Träger; ein verwirrendes System von Balken und Planken, an denen er sich entlanghangelte wie eine blinde Raupe an der Unterseite eines Blattes.
Am übelsten in der schaukelnden Finsternis plagte ihn der Gestank. Selbst für die abgebrühte Nase eines Schweinehirten bot die Bilge, der unterste Kielraum des Schiffes, unerträgliche Ausdünstungen. Die Suppe, die hier unten schwappte, roch übler als das Gedärm einer toten Ziege. Das Schiff hatte lange im Hafen von Palos gelegen. In diesen Wochen und Monaten hatte sich das ölige Brackwasser im Schiffsrumpf kaum bewegt, war abgestanden und faulig geworden. Ein schwimmendes Holzfass wie die Gallega trug immer einen gewissen Bodensatz an Schwitzwasser im Bauch. Von oben tropfte oft Regenwasser hinzu, vielleicht lief auch mal ein Weinfass aus und schließlich taten die Ratten das Ihre dazu, indem sie fleißig ihren Unrat verrichteten
Rodrigo wünschte sich zurück in die Schweinekuhle. Wie sauber und verlässlich war es dort gewesen. Die ärmliche, kleine Welt zuhause in Palos erschien ihm mit einem Male wie ein Hort glückseliger Geborgenheit. Eine Welt, in der ein dreizehnjähriger Junge sich zurechtfinden und behaglich einrichten konnte. Er zitterte. Auf was hatte er sich bloß eingelassen?
Rodrigo stand splitternackt im stinkenden Schiffsbauch, in einer Hand sein zusammengerolltes Kleiderbündel, mit der anderen tastete er sich vorwärts. Endlich ertastete er mittschiffs den Mastfuß des Großmasts und einen Querbalken unter den Planken, wo er sich bäuchlings dazwischenquetschen konnte. So fand er einen Halt, brachte die Füße aus dem Wasser und bekam endlich Zeit, sich zu besinnen.
Hatte er den Alten wirklich umgebracht? Und wenn er den Messerstich überlebt hatte? Was wurde dann aus Miguel? Was war mit der kleinen Consuela? Er beschloss, solange wie möglich in der Bilge auszuharren. Je später man ihn entdeckte, desto größer schien ihm die Chance, dass er auf der Gallega bleiben durfte und nicht an Land zurückgebracht wurde. Hungrig und durstig schlief er auf seinem sperrigen Balkenlager ein.
Er erwachte, weil irgendwo über ihm ein Hahn krähte. Wie jedes Schiff führte auch die Gallega lebende Vorräte mit sich, darunter auch Hühner, Hähne, Gänse, Schweine. Auf dem Schiff herrschte reges, lärmendes Leben. Rodrigo lauschte den gedämpften Stimmen der Besatzung, dem Tapsen nackter Füße auf den Decksplanken, dem rhythmischen Wellenschlag, der unaufhörlich gegen die Schiffswand pochte. In diesem Moment klappte die Luke auf. Im trübe hereinschimmernden Licht tauchten die Umrisse eines Kopfes auf. Jemand schwang sich durch die Öffnung nach unten.
Rodrigo wollte nicht lange Verstecken spielen. „Ay, Señor!“, sagte er deshalb tapfer und gab sich zu erkennen.
Der Matrose kam eigentlich nur heruntergeklettert um nachzusehen, ob man schon bald das Schwitz- und Leckwasser abpumpen musste oder ob man damit noch ein paar Tage warten konnte. Er packte Rodrigo wie eine junge Katze im Genick und zog ihn durch die Luke nach oben in den Laderaum. Endlich wieder Licht und Konturen. Ehe Rodrigo sich so recht daran freuen konnte, fing er ein paar Ohrfeigen ein. Der Matrose, ein schlacksiger Kerl mit schütterem Haar, brüllte in den Schiffsbauch hinein: „Kielratte an Bord! Señor Escobedo, kommt schnell, seht Euch mal den blinden Passagier an, den ich gefunden habe.“
Es dauerte nicht lange, da näherten sich zwei Männer. Beide waren nicht gekleidet wie einfache Matrosen. Der eine, ein stämmiger Kerl mit breitem, rotweinimprägniertem Gesicht, ging voraus. Er trug eine Offiziersuniform, oder jedenfalls das, was Rodrigo dafür hielt. Der andere Mann war hager, trug feingeschnittene Beinkleider und ein gestepptes Wams, eine Aufmachung, die ihn als wichtigen Mann an Bord auswies. Er fragte schroff: „Was bist du für ein Lump?“ Seine Stimme klang herrisch und auf Anhieb unsympathisch. Rodrigo blickte in zwei kalte Augen in einem kantigen Schädel.
Rodrigo hatte sich einiges zurechtgelegt für diesen Moment. Doch nun lähmte ihn die Angst, stammelte er trotzig und unbeholfen: „Ich will mitfahren, als Schiffsjunge.“ Dann: „Ich habe mich hier versteckt, als das Schiff im Hafen lag.“
„Escobedo, das ist ein Idiot von blindem Passagier“, sagte der zweite der beiden Männer. „Wir sollten nicht lange fackeln und ihn gleich über Bord werfen. Vielleicht ist es ein Jude auf der Flucht vor der Inquisition? Bringen wir ihn nach oben.“
„Langsam Gutierrez“, sagte der mit Escobedo Angesprochene zu seinem Begleiter. „Wir sollten den Knirps erst einmal ausfragen. Kapitän Colón muss ja nicht alles sofort erfahren.“
Die beiden Herren unterzogen Rodrigo einem strengen Verhör. Der Hagere, Rodrigo de Escobedo, war, wie Rodrigo später erfuhr, königlicher Notar, ein Rechtsgelehrter, offizieller Sekretär der Flotte und oberster Aufpasser der Krone an Bord der Gallega. Eine unsympathische und zwielichtige Erscheinung. Seine Aufgabe war es, im Namen der Krone alle Vorgänge an Bord der kleinen Flotte genau zu überwachen.
Beim zweiten Mann handelte es sich um Pedro Gutierrez, einen uniformierten Zivilisten an Bord der Gallega. Wie Notar Escobedo stammte auch er aus dem Umfeld des königlichen Hofes. Seine Rolle und Aufgabe an Bord konnte niemand richtig erklären. Er galt als königlicher Angestellter ohne genau definierte Verantwortung, manche hielten ihn für einen Spion der Krone, um dem Ausländer Christóbal Colón auf die Finger zu schauen. Möglicherweise fuhr er aber auch als Spion der Heiligen Inquisition mit, der darauf zu achten hatte, dass sich keine Ketzer, Mauren oder Juden an Bord befanden.
Gutierrez schleppte einen gedrungenen und stämmigen Leib mit sich herum. Im Gegensatz zum dürren, knochigen Escobedo wirkte er wie ein Schrank. Seinem breiten Gesicht verliehen ein schmallippiger Mund und engstehende Glupschaugen einen verschlagenen Ausdruck. Auf Rodrigo wirkten beide Männer abstoßend. Der eine ein wütender, fetter Karpfen, der andere ein Totenskelett. Rodrigo präsentierte seine Geschichte. Er sei von zu Hause ausgerissen, das Abenteuer reize ihn, die Entdeckungsfahrt, das Leben auf See. Das war glaubwürdig und wurde auch nicht angezweifelt.
Der hagere Matrose, der Rodrigo gefunden und aus der Bilge gefischt hatte, hieß José Pequinos. Die zwei wichtigen Herren schickten ihn wieder auf Deck, versehen mit dem Gebot vorläufiger Verschwiegenheit. Sie durften gleichwohl sicher sein, dass er die Neuigkeit unverzüglich weitertrug: Blinder Passagier an Bord, ein dreizehnjähriger Junge aus Palos.
Da die beiden königlichen Beamten nach der Befragung Rodrigos zu der Überzeugung gelangt waren, dass sich hinter dem Knaben keine weiteren Geheimnisse verbargen, kamen sie überein, nunmehr Admiral Christóbal Colón über den Vorfall zu informieren.
Über das geschäftige Oberdeck, vorbei an gaffenden Matrosen, geleiteten Escobedo und Gutierrez den sich eingeschüchtert duckenden Rodrigo zum Achterdeck. Mit gesenktem Kopf äugte er neugierig umher. Das Oberdeck, schwarz bemalt wie die ganze übrige Gallega, war vollgestopft mit Tauen, Kisten, Segeln, Rollenzügen, Wasserpumpen und kleinen Ballastfässern. Am Großmast stapelten sich Hühnerkäfige. Die Mannschaft beobachtete die Szene mit teils hämischem, teils neugierigem Grinsen. Es waren bärtige Gesichter, braungebrannt, wettergegerbt. Manche der Seeleute kannte Rodrigo vom Sehen. Ob sie ihn erkannten, zeigten sie indes nicht. Der blinde Passagier versprach ihnen jedenfalls Abwechslung.
An den Männern vorbei riskierte Rodrigo einen Blick aufs Meer hinaus. In der Ferne tanzten auf dem glitzernden Wasser weiße Segel: die Pinta und die Niña. Sie segelten der Gallega voraus.
Plötzlich rief eine bekannte Stimme: „Seht nur, das ist Rodrigo, der Schweinehirte.“
Gelächter erscholl ringsum unter den Matrosen.
„Rodrigo, hier. Schau hierher“, rief die Stimme, und Rodrigo wandte den Kopf. In den Wanten, backbords, wenige Meter über dem Deck, hing wie ein Affe ein alter Bekannter. Pablo, der Schönling und Aufschneider! Rodrigo hatte schon manche Prügel von ihm bezogen. Pablo, der Chef der Hafenbande, Anführer der Dorfjugend, war jetzt wohl Schiffsjunge auf der Gallega.
„Hey Rodrigo Schweinehirte“, rief Pablo strahlend und winkte. Seine dunklen Augen blitzten fröhlich.
Rodrigo konnte nicht antworten. Er durfte nicht stehen bleiben, denn der herrische Escobedo schob ihn mit energischem Griff in den dunklen Niedergang zur Admiralskajüte. Das Mobiliar in diesem spartanisch eingerichteten Raum bestand aus einem Tisch, einem tresorartigen Schrank in der Wand mit den Karten und Navigationspapieren, einem Bett, das hinter Vorhängen versteckt war, die zu einem Baldachin zusammengerafft werden konnten, sowie einer Truhe. An den drei Seiten des Raumes befanden sich drei kleine Fensteröffnungen.
Der Admiral, ein großgewachsener, leicht entrückt wirkender Mann mit weißblondem Haar, das ihm bis auf die Schultern fiel, stand mitten im Raum und sah Rodrigo aus seinen wässrigen blauen Augen neugierig an. Rodrigo senkte den Kopf und starrte auf seine eigenen schmutzigen Zehenspitzen.
Escobedo berichtete. Der Admiral hörte aufmerksam zu und ließ Rodrigo dabei nicht aus den Augen. „Ärgerlich, Señores, sehr ärgerlich“, murmelte der Admiral Richtung Escobedo und Gutierrez, so, als hätten sie diesen Fall zu verantworten. „Ein unnützer Esser mehr an Bord. Können wir irgendetwas mit ihm anfangen?“
Escobedo hatte Rodrigo schon die ganze Zeit mit seinen kaltfunkelnden Augen gemustert und schien zu einem Urteil gekommen: „Er sieht zwar etwas durchgebleut aus, aber ansonsten kräftig und gesund, Euer Gnaden. Wir sollten ihn behalten.“
Als der Admiral nicht gleich antwortete, schränkte Escobedo ein: „Vorläufig mal, bis zu den kanarischen Inseln. Er könnte sich Brot und Überfahrt verdienen. An Bord gibt es genug Arbeit für einen weiteren Schiffsjungen.“
Während er das sagte, ließ Escobedo seine knochige Hand auf Rodrigos Schulter fallen und grinste ihn aus seinem Totenschädel an. Ein weiterer Offizier kam hinzu, ein kleiner, fast zwergenhafter Mann mit krausem, schwarzem Lockenhaar, einem schwarzen Schnurrbärtchen und ulkigen O-Beinen: Diego de Harana. Er war der Alguacil, der oberste Polizeioffizier der Flotte, verantwortlich für die Einhaltung der königlichen Gesetze. Die Männer tauschten sich kurz aus und wurden sich bald einig: Bei der geplanten letzten Zwischenlandung vor der großen Fahrt ins unbekannte Meer sollte Rodrigo auf den kanarischen Inseln wieder an Land gebracht werden, bis dahin dürfte er an Bord bleiben.
Ein blasierter, farbig herausgeputzter junger Kerl balancierte Wasser und Wein herein: Pedro de Tereros, der Admiralspage. Sein pickeliges Gesicht glänzte vor Hochmut. Böse Blicke trafen Rodrigo.
Der Admiral sah entspannt und zufrieden aus. Er erweckte den Eindruck, als schaue er durch die Menschen um ihn herum hindurch, so, als gingen ihn die kleinlichen Dinge seiner Umgebung nichts an. Sein ganzes Wesen strahlte nur mühsam gezähmten Tatendrang aus. Seine hagere Gestalt wirkte auf Rodrigo noch selbstbewusster und unnahbarer als damals in der Kirche San Jorge, wo Rodrigo die Ansprache des „Don Fantastico“ von der hintersten Kirchenbank aus mitverfolgt hatte. Das weißblonde Haar Colóns, fein und dünn wie Goldfäden, fiel bis auf den Kragen. Die zwei hellblauen Augen mit ihrem leichten Silberblick ruhten entrückt im gebräunten Gesicht. Unter dem blauen Rock strafften sich die Schultern Colóns. Er wirkte nicht breitschultrig, eher schlank, großgewachsen und dennoch gut gebaut. Rodrigio blickte auf einen Mann in den besten Jahren, einen stolzen Admiral, der von geheimnisvollen inneren Energien getrieben schien, von einer magischen Unrast, die ihn trotz äußerlicher Ruhe auch nervös wirken ließ.
Colón drehte sich um und legte Rodrigo väterlich die Hand auf den Kopf. Rodrigo erstarrte vor Ehrfurcht. Der Admiral lächelte, nahm abwesend einen Schluck von dem bereitgestellten Wasser: „Du kannst es nicht wissen, du Unschuldiger, auf welches Schiff du dich geschlichen hast. Vielleicht hat der Allmächtige dich geschickt, als eine Metapher!“
Rodrigo hatte keine Vorstellung, wovon der Admiral sprach. Ehrfürchtig hielt er still.
„Für dich mein Junge“, so fuhr Colón fort, „ist dies nur eine Fahrt über das Meer.“ Es schien, als spräche er mehr zu sich selbst als zu Rodrigo: „Aber dies ist mehr als eine gewöhnliche Reise. Dies ist eine Mission für das christliche, katholische Spanien. Wir finden den Seeweg nach Indien.“ Er hielte inne, als wolle er Anlauf nehmen für eine größere Ansprache. Gutierrez und Escobedo verdrehten die Augen. Scheinbar kannten sie derartige Ausbrüche bereits. Diego de Harana lächelte unverbindlich und ließ seine Kugeläuglein blitzen. Der Page Tereros blies sich wichtigtuerisch auf.
Was der Admiral nun salbungsvoll erläuterte, klang wie eine wohlsortierte Erklärung für die Nachwelt, so, als habe Colón nur auf die Gelegenheit und das Publikum zu einer solchen Ansprache gewartet: „Meine Herren, diese Fahrt wird man immer mit meinem Namen, mit dem Namen Christóbal Colón, in Verbindung bringen. Mein Ruhm und meine Ehre sind auch Ruhm und Ehre unserer allerchristlichsten, erlauchtesten und mächtigsten Fürsten, Seiner Majestät des König und Ihrer Majestät, der Königin. Sie haben diese Mission mit ihrer allerhöchsten Gnade ermöglicht.“ Colón richtete seinen Blick auf ein unbestimmtes Ziel irgendwo jenseits der Kajütenwand: „Ihr Herren, glaubt mir, ruhmreich wird unsere Fahrt enden, ebenso ruhmreich wie der Krieg gegen die Mauren, die noch in Europa herrschten, in der gewaltigen Stadt Granada, als ich mit meinen Plänen und Absichten vor die Augen der Herrscher trat.“ Er hielt erneut inne, als besinne er sich auf all die Mühsal, die er seitdem auf sich genommen hatte, seufzte kurz und fuhr dann fort: „Aufgrund der Berichte, die ich unseren Hoheiten über die Länder Indiens und über jenen dortigen Fürsten, genannt der „Große Kahn“, gegeben, erwogen die Hoheiten endlich als aufrichtige katholische Christen, als Freunde und Verbreiter des heiligen christlichen Glaubens und als Feinde der Sekte Mohameds und jedes anderen Götzendienstes, mich, Christóbal Colón, nach den Indien genannten Gegenden zu entsenden, um dort jene Fürsten, Völker und Orte aufzusuchen und nun zu prüfen, wie man sie zu unserem heiligen Glauben bekehren könnte. Das ist die Mission. Meine Mission!“
Escobedo klatschte spöttisch in die Hände und murmelte süffisant: „Bravo!“
Der Admiral schien den Spott nicht zu bemerken oder er ignorierte ihn. Erneut hielt er einen Moment inne, hieb die rechte Faust in die linke offene Hand und blickte von Escobedo zu Harana, zu Gutierrez, um dann konzentriert in seinem Monolog fortzufahren: „So wurde mir der Auftrag zuteil, mich nicht auf dem Landwege, wie bisher üblich gewesen, nach dem Fernen Osten aufzumachen, sondern in westlicher Richtung aufzubrechen, also auf einen Weg, den nach unserem Wissen bis auf den heutigen Tag noch niemand befahren hat.“
Escobedo machte ein Handzeichen Richtung Gutierrez, das wohl besagte: „Jetzt spinnt er wieder“.
Rodrigo verstand nur einen Bruchteil. Er konzentrierte sich weiterhin darauf, unbemerktr zu bleiben. Tatsächlich schenkten der Admiral und die anderen in der Kajüte dem Jungen keine Beachtung.
Colón atmete tief durch, dann faltete er die Hände wie zum Gebet und wandte sich wieder an Gutierrez und Escobedo: „Und dass ihr es wisst, ihr Herren, ihr Ungläubigen: Gold, viel Gold möge mir in diesen fernen Ländern beschieden sein. Die Elfenbeintürme des großen Khan, die Smaragde und Geschmeide, die goldenen Dächer von Zipangu ...“ Den Rest seiner Träume behielt er für sich.
Rodrigo hatte nicht allzu viel verstanden. „Der „Große Khan“, „goldene Dächer von Zipangu“, „Gold, viel Gold“, das waren die Stichworte, die bei ihm haften blieben. Insgesamt gewann er jedoch den Eindruck, es eher mit einem Verrückten als mit einem tüchtigen Kapitän zu tun zu haben.
Diego de Harana schob Rodrigo o-beinig vor sich her hinaus aufs Deck: „Du hast es gehört, Spitzbube, ein paar Tage bist du unser Gast, dann werfen wir dich wieder von Bord.“ Er kicherte zufrieden.
Rodrigo sagte nichts dazu. Dieser Offizier Harana kam ihm vor wie ein Zirkuszwerg. Das sollte ein Alguacil sein? – Immerhin, Rodrigo konnte zunächst mit der Entwicklung mehr als zufrieden sein; man peitschte ihn nicht aus, man legte ihn nicht in Ketten, man warf ihn nicht über Bord. Einer wie er dachte nur an den nächsten Tag, vielleicht noch den übernächsten. Alles war gut gelaufen.
Rodrigo schloss sich dem großspurigen Pablo an, dem einzigen Menschen an Bord, den er kannte. Auf der Gallega fuhren noch weitere Schiffsjungen mit. Der unsympathische Admiralspage Pedro de Tereros, den Rodrigo schon kennengelernt hatte, war einer davon, ein aufgeblasener Wichtigtuer, der Rodrigo bei jeder Begegnung mit feindseligen Blicken fixierte. Außerdem waren da noch ein Kajütpagen für alle übrigen Offiziere, Pedro de Salcedo, sowie der Schiffsjunge Martin de Urtubia. Er war das jüngste Besatzungsmitglied, höchstens elf Jahre alt, und er wirkte sehr eingeschüchtert. Nicht einmal mit Rodrigo mochte er sprechen, immer hielt er sich versteckt.
Zu seiner eigenen Überraschung spannte man Rodrigo nicht für die schikanösesten Arbeiten an Bord ein. Niemand fühlte sich so recht zuständig für ihn. Trotzdem genoss er keinen Müßiggang. Die Wachhabenden scheuchten und trietzten ihn: Deck schrubben, Taue entwirren, Takelage flicken. Mach dies, Kerl! Komm her, Nichtsnutz! Schneller, hopp, nicht einschlafen. Es ging Schlag auf Schlag.
Am ersten Abend brannten Rodrigo die wunden Hände vom Salzwasser und von den reibenden und zerrenden Tauen. Der Schiffsarzt verabreichte ihm eine Salbe aus Ringelblumen, die Linderung verschaffte.
Rodrigo muckte kein einziges Mal auf. In die regelmäßigen Tag- und Nachtschichten teilte man ihn nicht ein. Das hing wohl damit zusammen, dass alle davon ausgingen, dass er ohnehin nur ein paar Tage an Bord bleiben würde.
Die einfachen Matrosen arbeiteten in drei sich überschneidenden Schichten: vier Stunden Wache, acht Stunden frei. In den Dienststunden gab es bei gutem Wetter und stetigen Winden nicht allzu viel zu tun. Einige Männer arbeiteten mit Garn und Marlspieker an der Takelage – diese bedurfte ständiger Wartung und Kontrolle. Andere übergossen die von der Sonne gedörrten Decks, damit die Planken nicht in der Hitze schrumpften. Das innen und außen verpechte Schiff glich einer schwarzen Landschaft aus Teer, der in der Sonne weich und klebrig wurde. Manche taten Dienst als Navigator, Rudergänger oder Ausguck. Die Wachhabenden standen zu zweit auf vorgeschobenem Posten am Bug, zwei saßen im Mastkorb, die anderen bedienten die Segel, machten die Schotten und die Brassen zurecht und zogen alle zwei Tage die Taue an, die sich schnell lockerten. Auf dem erhöhten Heck, unter den Augen des Kapitäns, lehnte Steuermann Peralonso Niño an der Ruderpinne, um die Karavelle auf Kurs zu halten. Peralonso gehörte zum Clan der Niños. Diese waren neben den Pinzons die angesehenste Familie in Palos. Peralonso war ein noch junger, verwegen aussehender Haudegen. Er hatte noch einen älteren Bruder, den mächtigen Juan Niño, dem das zweite Schiff der Flotte gehörte, die Niña, wie Rodrigo bei Gelegenheit erfuhr.
Peralonso Niño war der erste Mann an Bord der Gallega, der Rodrigo in seiner Erscheinung wirklich imponierte. Wie der junge Steuermann aufrecht und kühn an der Ruderpinne stand, den Blick aufs Meer gerichtet, die hellbraunen Haare vom Wind zerzaust, wirkte er so wie Rodrigo sich kühne Seefahrer schon immer vorgestellt hatte. Das Hemd flatterte um Peralonsos breite Brust, und bei seinen lässigen Handgriffen am Ruder spielten starke Muskeln unter dem dünnen Stoff. Neben ihm stand ein weiterer wichtiger Mann, Juan de La Cosa, der baskische Eigner der Gallega. Er beobachtete den jungen Steuermann misstrauisch, fand aber an dessen Art, das Schiff zu steuern, offenbar nichts auszusetzen. De La Cosa war nicht mehr allzu jung, wettergegerbt und kantig, mit klugen braunen Augen. Oft standen die beiden Seefahrer zusammen, fachsimpelten über Winde und Strömungen, über das Schiff und die Mannschaft – und natürlich über die unbekannten Reiseziele.
Nach und nach lernte Rodrigo alle Besatzungsmitglieder kennen. Ganz im Gegensatz zu diesen beiden Piloten standen die geckenhaft herausgeputzten Zivilisten auf dem Schiff. Diesbezüglich schleppte die Gallega allerhand Ballast mit sich, allen voran das Gespann Escobedo und Gutierrez. Diese beiden, da sie mit dem Dienst an Bord nichts zu schaffen hatten, lümmelten an Deck herum, standen im Wege, schnüffelten den Matrosen hinterher und ernteten durch ihr Schwatzen und Spionieren überall Unwillen. Aber als königliche Beamte des Hofes hatte man ihnen Respekt entgegenzubringen, und man wusste sie mit erheblichen Befugnissen ausgestattet. So hütete die Mannschaft sich geflissentlich vor ihnen.
Weitere Zivilisten an Bord der Gallega waren Rodrigo Sanchez
de Segovia, der königliche Schatzmeister, ein leichengrauer Stubenhocker, zuständig für die Finanzen der Flotte, Louis de Torres, ein Dolmetscher, von dem man flüsterte, er sei ein konvertierter Jude, und Juan Sanchez, der kugelbäuchige Schiffsarzt.
Für Rodrigo, der all diese Besatzungsmitglieder und ihre Eigenheiten schnell zu unterscheiden lernte, folgten einige anstrengende, dennoch unbeschwerte, fast beschwingte Tage. Selten zuvor in seinem Leben hatte er sich so ungebunden gefühlt. Wie weit war Palos doch schon weg? Der Alte – hoffentlich war er im Grab. Seine Brüder Miguel und Pedro, die kleine Schwester Consuela, Mutter, – alle waren in weite Ferne gerückt. Erstmals in seinem Leben fühlte Rodrigo sich frei. Er lebte ohne Ängste in den Tag, ohne Hunger, ohne Prügel, ohne Streit, war nur vom Rhythmus der Arbeit an Bord und vom Wechsel zwischen Tag und Nacht geleitet.
José Pequinos, der dürre Matrose mit dem mürrischen Gesicht eines Maulesels, führte ihn in die Abläufe an Bord ein. Gegen halb acht am Morgen gab der Smutje mit einem Flamenco-Singsang bekannt, dass das Frühstück fertig sei. Dann machten sich jene acht oder neun auf, die drunten im pechschwarzen Laderaum ausgestreckt lagen und um acht zum Wachdienst eingeteilt waren, rappelten sich mühsam auf die Beine und zwängten sich in ihre klammen, salzstarrenden Hosen und Hemden, wenn sie nicht ohnehin in den Kleidern geschlafen hatten. Noch schlaftrunken griffen die Männer ihre Näpfe und drängten sich um die große vordere Luke, nahmen vom Schiffskoch Rührei, Bohnenbrei, Speck, Sardellen und altbackenes Brot in Empfang und begannen zu essen, eingezwängt in irgendeine Ecke des schwankenden Decks. Sobald sie fertig waren und ihre vierstündige Wache als Navigator, Rudergänger oder Ausguck angetreten hatten, konnte die übrige Besatzung frühstücken. Essen gab es reichlich, regelmäßig und abwechslungsreich, wie Rodrigo es nie zuvor bekommen hatte. Am Mittag trug der Schiffskoch noch einmal auf: Pökelfleisch, Käse, Sardinen und Heringe. Manchmal servierte er auch eine warme Kichererbsensuppe. Welch ein Unterschied zur kargen Kost zu Hause. Rodrigo hatte überdies Glück, dass er all die Tage nicht seekrank wurde.
Viel Segelarbeit gab es nicht zu verrichten. Die Winde bliesen stetig, ohne die Richtung zu wechseln. Das Meer tänzelte verspielt mit kleinen Schaumkronen um die Schiffe herum. In der Ferne, backbords, schimmerte ab und an die Küstenlinie am Horizont. Noch segelten sie auf bekannten Routen an Spanien und dem afrikanischen Kontinent entlang, mit Kurs auf die kanarischen Inseln. Steuerbords, immer einige Meilen voraus, glitten die beiden anderen Schiffe der Flotte übers Meer. Am Tage hielten sie Abstand und verständigten sich nur durch Rauchzeichen. In einer Pfanne am Heck der Schiffe brannte ein Signalfeuer, das in der Nacht über viele Meilen zu sehen war. Rauch oder Feuerschein besagten, ob die Schiffe den Kurs ändern, sich zusammenfinden oder wie gehabt weitersegeln konnten. Es gab ein ganzes System von Feuer- und Rauchsignalen, mit deren Hilfe die Flotte beisammengehalten wurde.
Solange man ihn in Ruhe ließ, dämmerte Rodrigo die langen und heißen Nachmittage an einem schattigen Platz vor sich hin und lauschte all den Geräuschen, die die Gallega begleiteten.
Am Abend spielten die Leute von der Freiwache Karten oder stimmten lautstark unanständige Lieder an. Zuerst aber sangen nach dem Abendessen alle gemeinsam auf dem Achterdeck das Salve Regina, so wie sie am Morgen den Tag mit dem Ave Maria und dem Gloria begannen.
Die Nächte verbrachte Rodrigo an Deck. Es gab keinen Schlafraum für die Matrosen. Sie legten sich dort nieder, wo sie Platz fanden, bei schönem Wetter fast immer draußen. Die am meisten umkämpfte Schlafstätte war Abend für Abend der Bereich der Schiffsluke, im Zentrum des Schiffes. Dies war die einzige ebene Fläche; denn das Deck hatte einen leichten Eselsrücken.
Pablo, drei Jahre älter als Rodrigo, schon mit erstem Flaum auf dem Kinn, trat im Kreise der Mannschaft stark und selbstbewusst auf, er hatte vor niemandem Angst. Im Gegensatz zu Rodrigo gab Pablo bereits das Bild eines großen und breitschultrigen jungen Mannes ab. Entsprechend stolzierte er über das Deck: Seht her, ich bin es, der schöne Pablo!
Völlig anders die Körpersprache bei Rodrigo. Er machte sich vorauseilend klein, fühlte sich eingeschüchtert, geduckt, fast devot schlich er herum, stets auf der Hut. Er hatte in seinem Leben schon zu viel Prügel einstecken müssen und lebte in der ständigen Angst, dass ihm weitere drohten. So herausfordernd aufzutreten wie Pablo hätte er nie gewagt. Stattdessen äugte er misstrauisch um sich, drückte sich am liebsten in einen Winkel, ging Konfrontationen aus dem Wege. Manche an Bord unterlagen daher dem Irrtum, Rodrigo sei ein wehrloser Feigling. Ein Trugschluss, denn Rodrigo legte damit nur seine bewährte Überlebenshaltung an den Tag. Im Ernstfall wusste er sich zu wehren. Eines Abends, der vierte oder fünfte Tag auf See ging zu Ende, grauschwarze Dämmerung legte sich bereits bis zum Horizont über das Meer, an Bord der Gallega und der anderen beiden nicht weit entfernten Schiffe hielt der schläfrige Rhythmus der Nachtschicht Einzug, kam Pablo zu Rodrigos Schlafplatz direkt an der Kante zur Back hingerutscht. Er stieß den Jüngeren an.
„Was gibt’s?“, flüsterte Rodrigo.
„Schläfst du?“
„Siehst du doch, nein.“
„Schau mal, was ich habe.“ Pablo nestelte umständlich einen länglichen Gegenstand unter seinem Hemd hervor. Ein Messer. Ein stilettartiger Dolch mit spitz zulaufender Klinge.
„Wo hast du das her?“
„Psst, nicht so laut! Das ist ein Messer.“
„Sehe ich. Wozu brauchst du es?“
Pablo beugte sich noch näher zu Rodrigo hin: „Weißt du nicht, wo die Fahrt hingeht? Wir fahren nach Zipangu, nach Cathay. Die Länder des großen Khan. Hast du nie von Marco Polo gehört? Der war dort. Vielleicht werden wir dort angegriffen. Vielleicht überfallen uns unterwegs Piraten. Wer weiß?“
Rodrigo hielt nichts von Spekulationen. Der große Khan kümmerte ihn nicht. Von Cathay und Zipangu hatte er noch nie etwas gehört, genauso wenig von einem Marco Polo.
„Und außerdem“, Pablos Flüstern ging in geheimnisvolles Raunen über, „außerdem braucht man so ein Messer auch hier an Bord. Du musst dich wehren können. Chachu, der Bootsmann, kann dir auch ein Messer besorgen.“
Chachu war ein großer Kerl, mit wildem Vollbart und am ganzen Leib behaart, nicht nur auf der Brust, sondern am ganzen Körper, auf Schultern, Rücken und Armen. Rodrigo wusste nicht, weshalb er von diesem hünenhaften Kerl ein Messer hätte erbitten sollen. Pablo sagte es ihm: „Hier an Bord ist man nicht sicher. Ich rate dir, halte dich an Chachu. Es gibt ein paar schmierige Typen hier, für die musst du sonst deinen Hintern hinhalten.“
„Was meinst du damit?“
„Du wirst es schon noch merken. Frag mal den kleinen Martin, warum der so zusammengekniffen rumläuft.“
Der „kleine Martin“, das war Martin de Urtubia, ein Baskenjunge. Er war der jüngste Schiffsjunge an Bord der Gallega, noch jünger als Rodrigo, und auch er blieb fast immer unsichtbar. Rodrigo sah ihn nur beim Essen. Martin war ein kleiner Kerl mit lustigem Lockenkopf. Aber was Pablo sagte, das stimmte: Der kleine Martin war ungewöhnlich still und verschreckt, er ging Kontakten und Gesprächen mit der übrigen Mannschaft aus dem Wege.
„Es ist, wie ich es dir sage: Die Kerle packen dich und vögeln dich in den Arsch. Das machen die hier so miteinander. Wenn du nicht mitmachen willst, dann besorge dir ein Messer, oder noch besser, einen Beschützer, an den die anderen sich nicht rantrauen.“
Pablo ließ Rodrigo noch eine Weile über das Gesagte nachdenken, dann hakte er nochmals ein: „Was denkst du, was gerade eben drunten im Laderaum vor sich geht. Da nehmen sie sich den Martin vor. Das weiß jeder, außer dem Admiral.“
Pablo erhob sich: „Ich hab’s dir jedenfalls gesagt. Pass auf!“
Rodrigo blieb nachdenklich zurück. Er knetete die kleine, zusammengebundene Haarlocke, die er, fest an den Stoff geknüpft, immer in der Hose bei sich trug. Die Haarlocke Isabellas. „Sie vögeln dich in den Arsch!“ Er wusste sehr wohl, von was die Rede war. Zu Hause hatte er das oft genug mit angesehen.
Ein Versuch Rodrigos, ein paar Tage später mit dem Schiffsjungen Martin ins Gespräch zu kommen, scheiterte daran, dass der Kleine verschüchtert davonhuschte. Außerdem stand plötzlich Escobedo dahinter, als hätte er darauf gelauert. Rodrigo erschrak, als er die grelle Stimme des Notars hörte. Er hatte nicht bemerkt, dass Escobedo nähergekommen war.
„Der Martin spricht nicht mit jedem“, sagte Escobedo schmalzig. Und nach einer kurzen Pause: „Schau mal da hinüber, Kleiner, das bedeutet für dich Abschied von der Santa Maria.“
Rodrigo wandte den Kopf. Eine sanfte Küstenlinie tauchte am Horizont auf.
„Das ist die Insel Lanzarote“, sagte Escobedo. „Die tote Kanareninsel. Da wächst nichts. Sei froh, dass wir dich nicht dort aussetzen. Aber wenn wir in Gran Canaria an Land gehen, wirst du abgesetzt.“ Dann legte er Rodrigo, wie schon einmal in Colóns Kajüte, mit einer herrischen und besitzergreifenden Geste seine knochige Hand auf die Schulter. Rodrigo versteifte sich und senkte irritiert den Blick.
„Ich könnte dafür sorgen, dass du an Bord bleiben kannst“, fügte er schmeichelnd hinzu. Es klang, als hätte eine Krähe geschworen, der anderen das Aas nicht wegzufressen. Escobedo kam ganz nahe mit seinem Kopf an Rodrigos Gesicht heran und flüsterte mit fauligem Atem: „Willst du an Bord bleiben, Kleiner? Willst du das schöne Leben hier genießen, unsere große Fahrt mitmachen?“
So nahe rückte Escobedo heran, dass Rodrigo den Kopf wegdrehen musste, um dem üblen Mundgeruch des königlichen Notars auszuweichen. Aber die verheißungsvollen Versprechen? Rodrigo nickte zaghaft und Escobedos Hand begann, sich von Rodrigos Schulter in seinen Nacken zu bewegen, den Hals hinauf in den Haaransatz.
Rodrigo spürte Widerwillen aufsteigen. Er wollte sich losreißen. „La Pinta, la Pinta!“, rief plötzlich einer der Seeleute und zeigte hinüber auf das Schwesterschiff. Von dort wurde ein Kanonenschuss abgefeuert. Die Pinta, das Schiff von Martin Alonso Pinzon, lag leicht steuerbord eine halbe Seemeile vor der Gallega. Die Karavelle schaukelte seltsam unruhig und machte kaum Fahrt, die Segel wurden eingeholt. Alle Augen an Bord der Gallega verfolgten das Geschehen. Aus seiner Kajüte kam Admiral Christóbal Colón gestürmt, im Schlepp den krummbeinigen Diego de Harana. Die Kapitäne hatten das Signal eines Kanonenschusses für ganz spezielle Fälle vereinbart: entweder, wenn im Westen nach der Überquerung des Ozeans Land in Sicht kommen sollte oder bei Havarie.
Der erste Steuermann Juan de La Cosa gab Befehl beizudrehen. Die Männer sprangen an ihre Plätze und holten die Segel ein. Um den Admiral scharten sich auf dem Achterkastell aufgeregt die Offiziere, Juan de La Cosa, der zweite Steuermann, Peralonso Niño, Harana, auch Gutierrez und andere. Auch Escobedo musste dazu. Er gab Rodrigo einen freundschaftlichen Klaps auf die Wange: „Überleg es dir. Wenn du weiter an Bord bleiben willst, dann komm heut Nacht in den Laderaum, mittschiffs bei den Mehlsäcken.“
Mit dieser Aufforderung ließ er den Jungen stehen und entfernte sich Richtung Achterkastell. Admiralspage Pedro de Tereros schlich wie zufällig vorbei, grinste gehässig und flüsterte im Vorübergehen: „Mach dich schön dafür, wie es die Nutten von Salamanca machen, wenn sie hohe Herren empfangen. Süß wird sie sein, die Nacht im Laderaum ...“
Rodrigo fand keine Zeit, über diese Andeutungen nachzudenken, denn um ihn herum strömte die Mannschaft auf Deck zusammen. Alle schauten neugierig hinüber zur Pinta, wo aus den Fumos, den kupfernen Becken am Heck, in kurzen Abständen Rauchsignale aufstiegen. Sie kündigten Schwierigkeiten an. Welcher Art, das blieb noch unklar. Unter den Matrosen machten verschiedene Interpretationen und Spekulationen die Runde; die Kundigen wollten zweifelsfrei das Signal „nicht manövrierfähig“ herausgelesen haben.
„Sabotage, glaubt mir!“, verkündete einer der jüngeren Matrosen, Jacomo Rico, ein besonders schwatzhafter Kerl. Er stammte aus Venedig und war außer dem Admiral der einzige Nicht-Spanier an Bord. Das machte ihn automatisch zum Außenseiter, was er durch übermäßige Geschwätzigkeit und Anbiederung nach allen Seiten auszugleichen suchte.
Später stellte sich heraus: Das Steuerruder der Pinta war aus seiner Halterung herausgesprungen, warum auch immer.
Admiral Colón hatte den Eigner der Pinta, Christóbal Quinterro in Verdacht, diese Havarie selbst herbeigeführt zu haben, um auf den Kanaren bereits die Fahrt abbrechen zu können. Es herrschte unter den Mannschaften und Offizieren nämlich durchaus die Auffassung, ein Verbleib auf den kanarischen Inseln könne für alle die beste Lösung sein. Viele sahen die Weiterfahrt über den unbekannten Atlantik inzwischen doch eher als ein Himmelfahrtskommando an, eine Spinnerei des Don Fantastico, die man besser vermeiden oder hintertreiben sollte, und sei es mit einer nachgeholfenen Panne.
Mit solchen Diskussionen und Spekulationen vertrieb sich die Mannschaft den Nachmittag und den Abend. Die kleine Flotte blieb zusammen, immer noch in Sichtweite der Insel Lanzarote, ohne weitere Fahrt zu machen.
Auf der Pinta arbeiteten die Männer hektisch, die Kommandos Pinzons und seiner Offiziere hallten über das Meer bis zu den beiden anderen Schiffen. Die Matrosen der Gallega und der Pinta schauten neugierig den Reparaturarbeiten zu. Manche beteiligten sich mit aufmunternden Zurufen übers Meer – mehr Spott und Lästern als ernsthafte Ratschläge.
Rodrigo zog sich in seinen Winkel an der Back zurück. Der drohende Schatten von Lanzarote am Horizont erinnerte ihn daran, dass für ihn die Fahrt hier zu Ende sein würde. Escobedo hatte gesagt: „Ich könnte vielleicht dafür sorgen, dass du an Bord bleiben kannst.“
Dieses vage Versprechen beschäftigte Rodrigo. Eine Verheißung, die erst nur unbestimmt pochte, dann in seinem Innern wuchs und wucherte und ihn schließlich so erfüllte, dass er entschlossen aufsprang. Was sollte schon passieren im Laderaum? Die unbestimmten Andeutungen Pablos, die süffisanten Bemerkungen des Admiralspagen, das zutrauliche Werben Escobedos, der seltsam verstockte kleine Baske Martin de Urtubia. Und wenn man sich mit ihm vergnügte, – schlimmer als die Prügel des Alten zu Hause konnte das auch nicht sein. Also, gewagt! So kletterte Rodrigo entschlossen durch die Hauptluke in den Laderaum hinunter, verfolgt von den neugierigen Blicken einiger umstehender Matrosen.
Im Zwielicht des Laderaums trat ihm ein Schatten entgegen. „Hey Kleiner!“
Die Stimme gehörte Jakob, einem der ungelernten Leichtmatrosen. Im Zwielicht unter Deck erkannte Rodrigo, dass Jakob nackt vor ihm stand.
Rodrigo blieb stehen. Dieser Jakob, ein schmaler, feingliedriger junger Mann kam mit gezierten, fast weibisch anmutenden Bewegungen hinter den aufgestapelten Säcken hervor und baute sich vor Rodrigo auf. Rodrigo musterte ihn abschätzend. Jakob war von mittlerer Statur, gut gebaut, schlank und sehnig. Er besaß einen von der harten Arbeit an Bord gut trainierten Körper. Nur sein mädchenhaft ebenmäßiges und weiches Gesicht grinste etwas unbeholfen.
Da zischelte aus dem Dunkel des hinteren Laderaums Escobedos Stimme: „Jakob, lass den Kleinen in Ruhe, der kommt wegen mir.“
Der Leichtmatrose Jakob verstellte Rodrigo jedoch den Weg zu Escobedo: „Woher weißt du, dass der Junge zu dir will? Vielleicht gefalle ich ihm ja viel besser.“
Das klappernde Lachen Escobedos erfüllte die Dunkelheit. „Misch dich nicht ein, Schwuchtel, verschwinde!“
Rodrigo nahm den Notar nur als schemenhaften Schatten im Halbdunkel wahr. Er verströmte sogar im Halbdunkel eine unheimliche, besitzergreifende Präsenz.
„Er ist noch frei“, beharrte Jakob und trat einen Schritt auf Rodrigo zu. Dieser erschrocken auf das lange, halbaufgerichtete Ding zwischen Jakobs Beinen. „Möchtest du mich anfassen?“, fragte er Rodrigo. „Hier!“ Er hielt sein Geschlechtsteil und streckte es Rodrigo hin.
Rodrigos hochsensible Überlebensinstinkte meldeten sich. Der kleine Körper geriet in höchste Alarmbereitschaft. Da umfassten ihn von hinten nackte Männerarme, jemand warf sich auf ihn und drückte ihn mit seinem Körpergewicht auf die Planken. Escobedo! Der rasselnde, faulige Atem des Notars lag dicht an Rodrigos Ohr. „Lass dich nicht mit Jakob ein. Der Einzige, der dir hier an Bord helfen kann, das bin ich. Sei nett und ich bin es auch.“ Escobedo drückte sich fest auf Rodrigo und vollführte ruckartige Bewegungen, den Jungen fest in seinem Griff eingeklammert. Rodrigo fühlte sich an die Eber im Schweinestall der Pinzons erinnert, wenn sie die Säue besprangen. Offenbar trug auch Escobedo keine Kleider. Sein hartes Ding schabte an Rodrigos Schenkel. Escobedos feuchter Mund begann an Rodrigos Ohr zu knabbern, mit der Zunge fuhr er ihm über die Backe an den Hals.
Rodrigo kämpfte, er zappelte und wehrte sich, und obwohl Escobedo über erstaunliche Körperkräfte verfügte, gelang es ihm, sich vom Boden wegzustemmen und herumzudrehen. Der schnaufende, nackte Escobedo saß noch immer auf ihm. Da gelang es Rodrigo wieselflink, sich aus dem Griff des Notars freizumachen. In schnellen Sätzen sprang er davon und kletterte aus dem Laderaum.
Escobedo blieb zornesrot am Boden sitzend zurück. Eine knochige Jammergestalt, die dünnen Beine von sich gestreckt, ein rotglühendes Etwas zwischen den Schenkeln. Er hielt sich den bei der Aktion verrenkten Arm. „Das wird er büßen!“, knurrte er. „Diese kleine dreckige Ratte. Dieser elende ...“ Er verschluckte den Rest seiner Beschimpfung und rappelte sich auf. „Ich werd ihm den Hintern aufreißen. Betteln und zittern wird der Kerl noch vor mir.“
Jakob, immer noch nackt, setzte sich neben Escobedo auf einen der Mehlsäcke. „War wohl nichts, großer Verführer. Musst dir halt weiterhin den kleinen Martin mit mir teilen.“
Am nächsten Morgen kam erneut Signal von der Pinta. Schon wieder ein Defekt an dem notdürftig mit Tauen fixierten Steuerruder. Es erwies sich als unmöglich, den Schaden auf offener See in Ordnung zu bringen, zumal das Wetter sich verschlechterte und das Schiff wegzutreiben drohte. So beschlossen die Kapitäne, mit allen drei Schiffen den Hafen von Las Palmas auf Gran Canaria anzusteuern. Dort gab es eine Werft, von der es hieß, sie sei so gut ausgestattet, dass dort Eisen geschmiedet und jeder Schaden am Schiff ausgebessert werden konnte. Die Gallega und die Niña segelten voraus. Die Pinta sollte nachkommen, so gut es ihr mit den behelfsmäßigen Reparaturen möglich war.
So trennte sich erstmals die Flotte und Rodrigo beobachtete von Bord der Gallega aus, wie die hilflos auf hohen Wellen tanzende Pinta schnell zurückblieb. Mit ihr verschwand auch der letzte dünne Strich, der am Horizont noch von Lanzarote zu sehen gewesen war.