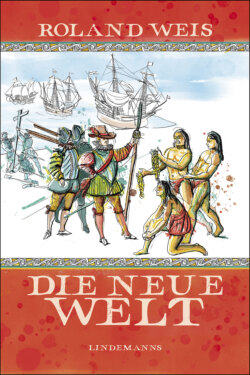Читать книгу Die neue Welt - Roland Weis - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеVI. Westfahrt
Die Insel Ferro ist das am weitesten Richtung Westen vorgelagerte Eiland der Kanarengruppe, der letzte Außenposten abendländischer Zivilisation. Ein verlorener Posten. Das Eiland besitzt die Form eines Dreiecks. Es weist mit seinen schroffen und felsigen Steilküsten jeden Seefahrer ab. Es war, als markiere dieses unfreundliche Stück Vulkanfelsen den äußersten und letzten Punkt der Welt. Diese Insel noch, dann kam nichts mehr im Westen, nur noch Meer, Wasser, der unendliche Ozean.
Kaum hatte die kleine Flotte den Hafen von La Gomera verlassen, geriet sie in eine völlige Windstille und dümpelte bewegungslos zwischen Gran Canaria und La Gomera – die Insel Ferro am westlichen Horizont gerade in Sichtweite. Die Schiffe schaukelten dicht an dicht, man konnte sich über das Wasser vom einen zum anderen unterhalten. Die Matrosen deuteten das Ausbleiben jeglicher Winde als böses Omen. Vielleicht war es doch besser, nach Spanien umzukehren.
Rodrigo stand zwischen den tratschenden Seeleuten. Er war inzwischen offiziell zum Schiffsjungen befördert worden, zum Groumette, so wie Pablo und der kleine Martin ebenfalls. Die Mannschaft hatte es achselzuckend hingenommen; man hatte sich an den etwas störrischen Neuling gewöhnt. José Pequinos, jener mürrische, schlaksige Matrose, der ihn seinerzeit zuerst im Schiffsbauch entdeckt hatte, gratulierte Rodrigo sogar, klopfte ihm auf die Schulter und wollte wissen, wie er es angestellt habe, wieder auf die Santa Maria zu kommen. Rodrigo blieb stumm, wie er es dem Admiral versprochen hatte; und Pequinos interessierte sich dann auch nicht weiter.
Der königliche Sekretär und Notar der Flotte, Rodrigo de Escobedo, und sein ständiger Begleiter, der Repostero Real Pedro Gutierrez, funkelten Rodrigo bei dessen Rückkehr hingegen böse an. In ihren Blicken lag Unheil. Die beiden königlichen Beamten waren gar nicht einverstanden mit seiner Aufnahme in die Mannschaft, untergrub doch Rodrigos bloße Anwesenheit ihre Autorität. Aber auch sie mussten sich den Befehlen des Admirals fügen.
Im Gegensatz zu den ersten zwei Wochen als blinder Passagier, in denen Rodrigo meist nur als hilfsbereiter Zuschauer abseits gestanden war, teilte ihn der schwergewichtige Bootsmann Chachu nunmehr mit allen Rechten und Pflichten in die regulären Wachschichten an Bord ein. Auf der Santa Maria zählte Rodrigo fortan als vollwertige Kraft und wurde durchaus hart rangenommen. Auch für ihn galt nun das ausgeklügelte und vielfach erprobte System der Bordschichten. Der Wachwechsel zwischen jeweils zwei Gruppen von fünfzehn Matrosen fand alle vier Stunden statt. Tag und Nacht im immer gleichen Wechsel hielt jede Gruppe vier Stunden Wache und ruhte sich dann acht Stunden aus. Die erste trat ihren Dienst um sieben Uhr früh an und sprach ein Vaterunser, ein Ave Maria und ein Gloria, um den Tag im Zustand der Gnade zu beginnen. Die anstrengendste Schicht lauerte am Ende der Nacht. Sie begann um drei Uhr. Die Matrosen nannten sie „Friedhofswache“ – kalt, still, voller unheimlicher Schatten.
Jetzt wartete auf Rodrigo plötzlich eine Reihe von täglichen Aufgaben, denen er sich nicht entziehen konnte. Als wichtigste Pflicht oblag den Schiffsjungen die Betreuung des Halbstundenglases – der Ampolleta. Dabei handelte es sich um ein zerbrechliches, mit Sand gefülltes Glas, in Venedig geblasen, von dem mehrere Ersatzstücke an Bord mitgeführt wurden. Um von oben nach unten zu rinnen, brauchte der Sand dreißig Minuten. Dann musste der Schiffsjunge die Ampolleta umdrehen. Wenn er nach vier Stunden das Halbstundenglas achtmal umgedreht hatte, stand die Wachablösung bevor, und dem Schiffsjungen oblag es, die nächste Wache auszurufen. Fleißig übte Rodrigo unter Anleitung von Pablo jenen Singsang ein, mit dem die Wache geweckt werden musste: „Auf Deck ihr Herren Seeleute von der richtigen Partie! Auf Deck zur richtigen Zeit, eure und des Herrn Piloten Wache. Es ist schon Zeit, flink auf die Beine ...“
So sehr fürchtete Rodrigo zu Beginn, einen Fehler zu machen oder das Wechseln des Halbstundenglases zu versäumen, dass er in seinem Eifer anfangs regungslos vor der Ampolleta saß, das Rinnen des Sandes verfolgte und sich nicht von der Stelle rührte. Auch beim Umdrehen der Sanduhr gab es den einstudierten Sprechgesang: „Ein Glas ist vorbei, das zweite fließt still, zerrinnen wird noch vielerlei, weil Gott es so will.“ Laut über das Deck geschmettert, schätzten die Matrosen diese Information, denn sie half ihnen abzuschätzen, wann ihre Wache vorüber war.
Rodrigo, obwohl alles andere als gottesfürchtig erzogen, berührten besonders die vielen religiösen Rituale und Zeremonien, welche die Schiffsbesatzung pflegte. Obwohl er Gebete von zu Hause in Palos nicht kannte, hatte er doch dort das Kreuzzeichen, neben der Ohrfeige, als häufigste Handbewegung kennengelernt. Vor dem lieben Gott, den er sich als mächtigen Inquisitor vorstellte, besaß er gewaltigen Respekt. Die religiösen Übungen an Bord der Santa Maria, die fast jeden halben Stundenwechsel begleiteten und welche die jüngsten Burschen auf dem Schiff auszuführen hatten, schüchterten Rodrigo ein. Ein Fehler oder eine Nachlässigkeit, so fürchtete er, und das Schiff wäre wohl dem Groll des Allmächtigen ausgeliefert. So begrüßte Rodrigo ebenso wie auch die Schiffsjungen der anderen Schichten allmorgendlich den Anbruch des Tages: „Gesegnet sei das Tageslicht, das heilige Kreuz im Angesicht, Gottvaters hehre Allwahrheit und heilige Dreifaltigkeit. Gesegnet sei der Seele Grund, bewahrt vom Herrn zu jeder Stund, gesegnet sei der neue Tag und Gott, der dieses Werk vermag.“ Anschließend sagte der Schiffsjunge das Pater Noster und das Ave Maria auf.
Jeden Abend, gleich nach Sonnenuntergang und vor der ersten Nachtwache, ließ der Kapitän alle Mann zur Abendandacht zusammenrufen. Einer der jüngeren Matrosen leitete die Zeremonie ein, nachdem er die Kompasslampe zurechtgemacht hatte. Dann rief er aus, indem er die Kompasslampe über Deck nach achtern brachte: „Amen. Und Gott gebe uns eine gute Nacht; dem Schiff, dem Herrn Kapitän, dem Schiffsführer und allen guten Reisegefährten sei gute Fahrt beschieden.“ Die jüngeren Matrosen und Schiffsjungen führten nun die Schiffsgemeinschaft bei der Abendandacht an, der „doctrina cristiana“. Gemeinsam beteten alle zusammen das Pater Noster, Ave Maria und Credo, darauf stimmten sie das Salve Regina an. Diese schöne Hymne, eines der ältesten Kirchenlieder der Benediktiner, verursachte bei Rodrigo jedes Mal Gänsehaut und das Gefühl besonderer Erhabenheit. Ein würdiger Abschluss des Tageslaufs. Jedes Mal, wenn die Klänge über das Deck hallten, während die Karavellen in die Dunkelheit hineinglitten, machte sich eine schwere, getragene Stimmung breit. Selbst den abgebrühtesten Halunken schlich sich ein silbriger Schimmer in die Augen. Ein jeder legte sein ganzes Gefühl, seine volle Inbrunst, die geheimsten Träume und Hoffnungen in diesen gemeinsamen Gesang. Auch Rodrigo versank in solchen Momenten in ungewohnte Sentimentalität. Manchmal ertappte er sich dabei, wie er an die Mutter dachte oder an seinen kleinen Bruder Miguel. Wenn sie nur wüssten, wo er sich jetzt gerade befand. Meistens aber galten seine schwärmerischen Phantasien Bildern von Isabella Pinzon, Träumen von Gouverneurin Bobadilla. Aus diesen behaglichen Tiefen holte ihn dann ein schriller, falscher Ton im Männergesang, eine grausige Disharmonie unsanft zurück. Wenngleich auch ein jeder die Melodie nach eigenem Gutdünken und Können variierte, so gab das widerhallende und oft von schrecklichen Missklängen durchzogene „Salve Regina Mater Misericordiae, Vita, Dulce do, et spes nostra salve ...“ ein bewegendes, herzzerreißendes Klangbild. Für Rodrigo täglich das schönste Erlebnis an Bord.
Die Nacht brach herein. Bootsmann Chachu löschte das Feuer im Feuerkasten und rief, gründlich und fürsorglich wie immer, zum Ausguckmann im Mastkorb: „Und du da oben, gib acht, halt’ gute Wacht“, und die Männer zogen sich an ihre Schlafplätze zurück. Die Matrosen schliefen verstreut über dem Mittelschiff, der Admiral in seiner Toldilla, dem hüttenartigen Quartier im Achterkastell, die Schiffsführer und Zivilisten in ihren Kojen unter der Admiralskajüte, enge Verschläge, in die man zum Schlafen hineinkriechen musste. Maestre Juan Sanchez, der Schiffsarzt verkroch sich hinten auf der Back, wo er sich mit seinem Medikamentenkasten zwischen Tauen, Segeln, Rollen und Blöcken mehr schlecht als recht eingerichtet hatte. Rodrigo rollte sich wie immer etwas abseits an der Backbord-Reling, dicht beim Vorderkastell, zusammen. Auf dem Rücken liegend, bestaunte er den Sternenhimmel, ein glitzerndes Meer von unendlicher Weite. Er sann darüber nach, wie weit die Sterne wohl von der Erde entfernt im Weltraum schwebten. Der Admiral beobachtet bisweilen das nächtliche Firmament mit einem rätselhaften Instrument, einem Astrolabium. Als Rodrigo bei José Pequinos nachfragte, um was für ein Gerät es sich dabei handle, winkte dieser nur verächtlich ab. „Spinnerzeugs!“ Nun gut, mit dem wortfaulen José Pequinos musste man auch nicht das Gespräch suchen. Der kauzige Matrose eignete sich wenig für Betrachtungen, die über Essen, Trinken und die tägliche Arbeit hinausgingen. Manchmal erzählte er von seiner Familie in Palos, von seiner Frau und einem Schlag Kinder. Das interessierte aber keinen. Wie die meisten Seeleute nahm José Pequinos den Sternenhimmel als gegeben und von Gott hingegossen hin. Darüber gab es nichts zu besprechen.
Rodrigo stellte das nicht zufrieden. Vielleicht das erste Mal auf dieser Fahrt gingen dem Jungen angesichts des unendlichen, funkelnden Himmelsdaches Gedanken über Sinn und Ziel dieser Fahrt durch den Kopf. Leiteten die Sterne tatsächlich die Kapitäne auf den richtigen Weg? Wie groß ist eigentlich das Meer? Was kommt hinter dem Horizont? Fragen, die das nächtliche Universum in Rodrigo weckte, während ringsum das Meer vor sich hin murmelte und die Taljen in der Takelage klapperten.
Jetzt gehörte er dazu, war er Mitglied dieser Mannschaft auf der Santa Maria, und damit war dies jetzt auch seine Reise. Rodrigo überhörte das Unheil, das sich ihm auf leisen Sohlen näherte. Eine starke Hand packte ihn von hinten, riss ihn empor, jemand hielt seine Arme fest und stopfte ihm einen stinkigen Stoffknebel in den Mund. Andere Hände packten seine Beine, man hob ihn auf. Alles Winden und Zappeln war zwecklos.
Rodrigo sah nur schattenhafte Gestalten und hörte Stimmengeflüster. Die Kerle zerrten ihn zur Ladeluke im Vorderschiff. Wer war es? Escobedo? Gutierrez? Diese beiden vermeinte er an ihren Stimmen zu erkennen. Mindestens zwei Männer hielten ihn im Griff. Sie stanken nach Teer, Salzwasser, Zwiebeln und Schweiß, so wie alle an Bord, außer vielleicht dem Kapitänspagen Pedro de Tereros, der sich mit Veilchenwasser einzusprühen pflegte. Panik stieg in Rodrigo auf. Er wandte sich wie ein Aal, bäumte seinen kleinen Körper in der starken Umklammerung auf, wollte schreien. Er war machtlos. Die Männer schleppten ihn behende über das Deck. Ein paar hastige Schritte und schon erreichten sie mittschiffs das dunkle Loch der Ladeluke. Sie hievten Rodrigo hinein. Waren denn alle übrigen Männer an Deck taub und blind geworden? Wieso sah und hörte niemand etwas? Wieso half ihm niemand? Rodrigo würgte an seinem Knebel und strampelte mit den Beinen. Ungerührt reichten ihn seine Entführer nach unten in den Laderaum und zerrten ihn dort in einen hinteren Winkel.
Es folgte eine rohe und widerliche Vergewaltigung, ein grobes Ritual, eine Machtdemonstration. Die Männerwelt und ihre Spielregeln. Demütigung und Erniedrigung.
Rodrigo ließ es mit zusammengebissenen Zähnen über sich ergehen. Er war hartgesotten. Davon starb man nicht. An Einzelheiten mochte er sich später dennoch nicht mehr erinnern. Er erstickte fast; zuerst am Knebel, der ihn würgte, dann am staubigen Packen, in den hinein sie seinen Kopf drückten, so dass ihm die Luft wegblieb. Zwischen Schmerzen, Ekel und Hilflosigkeit hatte Rodrigo nur noch einen Gedanken: Luft! Er japste wie ein an Land geschleuderter Fisch, schon lief sein Gesicht blau an.
Nur weil die Vergewaltiger ihr Geschäft in größter Hektik erledigten und so die Qual nach wenigen Minuten vorüber war, blieb Rodrigo am Leben. Ein paar Minuten länger und er wäre erstickt. Endlich konnte er zitternd nach Luft schnappen, als der Letzte von ihm abließ und niemand ihn mehr festhielt. Grunzen und Gelächter. Die Stimme von Escobedo war nicht zu verwechseln. Bei den anderen war Rodrigo sich nicht sicher. Er riss sich den Knebel vom Mund, warf sich auf den Rücken, keuchte und würgte wie ein Erstickender am Galgen. Heftig hustend zog er die Luft in die Lungen. Die Augen hielt er geschlossen. Er wollte nichts sehen, schon gar nicht seine Peiniger, deren gekünsteltes, verlegenes Gelächter er jetzt hörte. Er wollte nur eines: atmen, atmen, atmen.
Die Vergewaltiger flüsterten leise miteinander, sie berieten unschlüssig, was zu tun sei. Rodrigo lauschte, während er noch immer in heftigen Zügen mit pfeifenden Geräuschen die Luft einsog. Escobedos Stimme: „Jetzt ist er zugeritten, der Kleine, das nächste Mal wird es leichter.“
Pedro Gutierrez: „Vielleicht war das zu viel für den Anfang?“ Wieder Escobedo: „Es ist nie zuviel. Diese kleinen Teufel muss man gefügig machen und zwar ohne Samthandschuhe. Wir werden noch viel Spaß mit ihm haben.“ Er tätschelte Rodrigo. Der schlug die Augen auf und blinzelte in die Dunkelheit. Er konnte nur Schemen erkennen: vorne die hagere Totenkopfsilhouette von Escobedo, daneben der gedrungene Gutierrez, dahinter der verwischte Schatten des dritten Mannes.
Langsam legte sich Rodrigos Todespanik. Seinen Körper konnte man quälen und schinden, das war er gewohnt. Prügel, Demütigungen, Schmerzen, nichts Neues für den Dreizehnjährigen. Das kannte er von zu Hause. Der Stärkere nimmt – das Gesetz der Gewalt!
Rodrigo analysierte kühl seine Lage und auch die Gefahren, die ihm noch drohten. Konnte es sein, dass man ihn umbringen wollte? Die drei Männer schienen darüber miteinander zu diskutieren. Rodrigo nahm ihnen die Entscheidung ab. Er sprang auf und schlüpfte mit wenigen schnellen Sätzen zwischen den Verdutzten hindurch. Die drei machten keine Anstalten, ihn zurückzuhalten. Stattdessen lachte Escobedo höhnisch hinter ihm her. Rodrigo dröhnte das Gelächter noch im Ohr, als er längst aus dem Laderaum hinausgeklettert war. Finstere Rachegedanken bemächtigten sich seiner.
Am nächsten Morgen – noch immer dümpelte die Flotte in den windstillen Inselgewässern – galt Rodrigos ganzes Trachten der Beschaffung eines Messers. Nie mehr wollte er so hilflos ausgeliefert sein. Das nächste Mal würde er sich zu wehren wissen. Pablo sah ihm sofort an, was geschehen war: „Sie haben dich rangenommen, was?“ Rodrigo nickte mit störrisch zusammengepressten Lippen. Er hatte keine Lust, Einzelheiten preiszugeben. „Ich brauche ein Messer!“
Pablo zog sein eigenes Messer aus dem Gürtel und wog es spielerisch in der Hand: „Hab ich dir doch gleich gesagt. Schau her, mich fasst keiner mehr an!“ Er sprang in eine breitbeinige, geduckte Position, pendelte mit dem Oberkörper hin und her und hieb mit dem Messer gegen einen imaginären Gegner. Er bleckte die Zähne, um seinem schönen Jungmännergesicht einen kriegerischen Ausdruck zu geben. „Komm!“, rief er, „greif mich an! Versuch es! Ich bin schnell mit dem Messer. Keiner soll es wagen!“ Seine ganze Körpersprache strahlte Selbstbewusstsein, jugendliche Kraft und Unerschrockenheit aus. Er tänzelte um Rodrigo herum und zeigte sein breitestes Grinsen. Dann richtete er sich entspannt wieder auf und klopfte Rodrigo gönnerhaft auf die Schulter: „Dir wird ein Messer allerdings wenig helfen, Kleiner. Du bist einfach noch zu mickrig. Vor dir hat keiner Angst. Dir wird es ergehen wie Martin.“
In den folgenden Tagen fiel Rodrigo immer häufiger der weibische Matrose Jakob auf, der erkennbar seine Nähe suchte. Die anderen nannten ihn mit abfälligem Unterton „schöner Jakob“. Immer wieder kreuzte er wie zufällig Rodrigos Weg, blieb mit auffällig gezierten Gesten in seiner Nähe stehen, suchte Blickkontakt und Annäherung.
Anders als am eingebildeten Kapitänspagen Tereros fand Rodrigo an Jakob im Grunde nichts auszusetzen. Der Leichtmatrose gehörte zu jener Sorte ansehnlicher junger Kerle auf dem Schiff, die von harter Arbeit gut gebaut waren. Wenn er mit nacktem Oberkörper in die Takelage kletterte, die Trassen festzurrte oder nur an einem Seil einen Eimer Meerwasser an Bord hievte, faszinierte das harmonische Spiel seiner gut trainierten Muskeln. Er besaß einen hellen offenen Blick, treuherzige, blaue Augen und einen dunkelblonden Wuschelkopf.
“He, Rodrigo Groumette! Was dagegen, wenn ich mich zu dir setze?“, fragte Jakob, als er sich einmal mehr unbemerkt angeschlichen hatte.
Rodrigo hielt die Augen gesenkt und zuckte die Schultern. Sein natürliches Misstrauen setzte ihn in Alarmbereitschaft. Seine Muskeln spannten sich.
„Hast du Angst vor mir, Rodrigo Groumette?“
„Ich habe vor niemandem Angst“, sagte Rodrigo trotzig.
„Vor mir muss man auch keine Angst haben.“ Jakob lachte gekünstelt und spielte nervös mit den Fingern. Seine Stimme nahm den einfältig gurrenden Tonfall eines väterlichen Freundes an, und dies behagte Rodrigo überhaupt nicht.
Rodrigo überließ es Jakob, mühsam einen Gesprächsfaden zu knüpfen: „Ich habe gehört, was vorgestern Nacht passiert ist ... mit Escobedo, du weißt schon.“
Rodrigo blieb weiter stumm.
„Escobedo ist ein Schwein, ein fieser und hinterhältiger Kerl. Jeder in der Mannschaft fürchtet ihn. Aber der Admiral lässt ihn gewähren, weil er ein Beamter des Königs ist. Er ist der Aufpasser der Krone. Zusammen mit Gutierrez und dem Schatzmeister Sanchez de Segovia muss er hinter dem Admiral herspionieren. Wahrscheinlich im Auftrag der Königin. Sie traut Colón nämlich nicht. Niemand traut ihm. Der Admiral ist ja kein Spanier, er ist ein Genuese. Das ist dort, wo die Betrüger herkommen.“
„Warum erzählst du mir das?“, fragte Rodrigo.
„Damit du weißt, was mit Escobedo los ist. Dass du dich vor ihm in Acht nehmen musst. Dass er hier an Bord machen kann, was er will. Er ist Notar und Sekretär der Flotte. Er hat Macht und Einfluss. Alle fürchten sich vor ihm. Es hilft dir niemand. Nicht der Admiral und auch nicht Diego Harana, der Alguacil. Sie alle drücken beide Augen zu.“
„Und was soll ich tun?“
„Du brauchst jemanden, der dich beschützt“, erklärte Jakob. „Du brauchst einen Beschützer, vor dem Escobedo Respekt hat.“
Rodrigo blickte auf. Vielleicht eine Nuance zu abweisend sagte er: „Und das bist du vielleicht?“
Jakob nickte. Er zögerte eine Sekunde, dann legte er seinen Arm um Rodrigos Schultern. Rodrigo zuckte zusammen. Die Berührung gefiel ihm nicht. Aber dann ließ er den Matrosen doch gewähren.
Eine kurze, peinliche Pause entstand. Dann sagte Jakob: „Ich werde ein wachsames Auge auf dich haben. Immer wenn Escobedo auftaucht, kannst du dich verlassen, ich bin in der Nähe.“
Die freundliche und besorgte Stimme Jakobs, sein einfühlsames Wesen, seine sympathische Zuneigung, sein Selbstbewusstsein, ja auch seine körperliche Nähe, all dies flößte Rodrigo ein gewisses Vertrauen ein. Wieso sollte Jakob nicht wie ein großer Bruder zu ihm sein?
Trotzdem hatte er die Spielregeln begriffen: „Was muss ich dafür tun, dass du mich beschützt?“
„Nur ein bisschen nett zu mir sein.“ Jakob drückte sich noch enger an Rodrigo. „Nur ein bisschen nett sein!“
Kurz nach Sonnenaufgang am nächsten Morgen erbarmte sich endlich eine frische Brise aus Nordwest und schob die drei Karavellen an der Insel Ferro vorbei aufs offene Meer hinaus.
Beglückt erklomm Admiral Colón die Brücke und stellte sich zu Peralonso Niño. Der junge Steuermann zog mit dem Anflug leichter Verwunderung eine Augenbraue hoch. Mehr an zweideutiger Körpersprache hätte er sich dem Admiral gegenüber niemals gestattet. Drei Tage lang hatte sich der Admiral in seiner Kajüte versteckt, beleidigt, vor lauter Groll auf die widrigen Winde. Jetzt stand er erwartungsfroh neben seinem jungen Steuermann, der breitschultrig mit beiden Händen das Ruder gepackt hielt, als freue er sich auf bevorstehende Kämpfe mit dem Meer. Es war, als hätte der plötzliche Wind auch Peralonso Niño frische Lebensgeister eingehaucht. Von der Pinta herüber schollen laute Hurra-Rufe und schon legte sich Pinzons schnelle Karavelle mit knatternden Segeln in den Wind, um die Nase vorne zu haben.
Ein überraschendes Naturschauspiel begleitete den Aufbruch der Flotte: Am fernen Horizont in ihrem Rücken, da, wo irgendwo die Insel Teneriffa im Meer lag, rührte sich mit einem dumpfen Grollen, das aus der Tiefe des Meeres kam, der Pico de Teide, der 3.700 Meter hohe Vulkan. Ein unterseeisches Donnern dröhnte aus seinem Innern, dann quoll eine schwarze Qualmwolke über den Horizont. Der Vulkan verabschiedete die Flotte mit einem Salut aus Feuer und Rauch.
Dieser Ausbruch, so harmlos er blieb, ängstigte die Männer sehr. Viele nahmen es erneut als böses Omen. Endgültig sank den meisten das Herz, als die Insel Ferro immer weiter zurückblieb und schließlich ganz aus ihren Augen verschwand. Jetzt lag nur noch endlos das Meer vor ihnen.
Viele aus der Mannschaft brachten die Erfahrung des offenen Meeres von früheren Fahrten mit. Immer wieder segelten spanische Handelsschiffe außer Sichtweite des Festlandes. Aber im Unterschied zur jetzigen Ausfahrt nach Westen wussten sie dabei stets, wo sie sich ungefähr befanden und wie weit die nächste Küste entfernt lag. Das gab die sichere Gewissheit, dass jederzeit eine schnelle Rückkehr zum Ausgangspunkt möglich war.
Diese Mal segelten sie in wohlüberlegter Absicht hinaus ins Ungewisse, ins Unbekannte, befanden sie sich in der weiten Leere eines unergründlichen Ozeans. Ringsum umgab sie nur noch trügerisches, grüngraues Wasser. Der Blick zum Horizont offenbarte keinen Halt, kein Ende. Nur Weite. Am Himmel zogen leichte Wolken vorüber. Eilig, wie ein Schwarm aufgeblähter, weißer Schafsfelle zogen sie gen Westen. Die Vorboten eines unbekannten Windes, den sie bald kennenlernen sollten: der Passat!
Endlich Wind! Eine stetige Brise aus Nordost, kräftig genug, dass die Hemden flatterten. Freudig hüpften die Karavellen über die Wellen. Der freundliche Passat schob die Flotte mit leichter Hand voran. Die Männer schnupperten prüfend in den Wind, wie Köche, die sich am Suppendampf von der Qualität ihrer Küche überzeugten. Auch Rodrigo sog begierig die salzige Meeresluft ein. Freudig ächzte und knarzte das Schiffsgebälk, es knatterten die Segel, übermütig spritzte feine Gischt über den Bugspriet auf die Planken.
So hurtig ging es voran, dass nach wenigen Tagen plötzlich die Ersten wieder der Mut verließ.
„Wir segeln in einen Abgrund. Merkt ihr nicht, wie die Schiffe immer schneller werden. Seit drei Tagen legen wir zu. Es ist der Sog, der uns in den Abgrund zieht.“
Tagsdarauf reagierte der Admiral auf die immer sorgenvolleren Gesichter und ließ alle Mann zusammenrufen, um ihnen Mut zuzusprechen. Er spürte wohl, dass den abergläubischen Kerlen diese wunderbare Brise nicht geheuer war.
Colón begab sich auf das Achterkastell neben den Schiffseigner Juan de La Cosa, von wo aus er den Blick über die mittschiffs versammelte Mannschaft hatte. Wie immer strahlte er Selbstgewissheit und unerschütterlichen Optimismus aus. Die niedergeschlagenen Gesichter seiner Matrosen beeindruckten ihn nicht.
„Kopf hoch Männer! Seid ihr Spanier, stolze Seefahrer aus Andalusien? Habt ihr kein Vertrauen zum Allmächtigen, der uns schützt und lenkt? Kann es wahr sein, dass ein günstiger Wind einem andalusischen Seemann allen Mut raubt? Seid ihr nicht gerade deshalb mit mir ausgezogen, um diesen Wind einzufangen und euch zu den Schätzen Indiens tragen zu lassen? Ich sage euch, diese Route, auf der wir segeln, sie führt uns geradewegs ins Land des großen Khan.“
Einige murmelten beifällig. Aber nicht alle.
„Sie führt direkt in die Hölle“, murmelte fluchend einer neben Rodrigo. „Psscht!“, zischte ein anderer.
Der Admiral fuhr fort, leidenschaftliches Pathos in der Stimme: „In diesem Indien liegt Zipangu. Es ist die größte und reichste Insel der Welt, das sage ich euch, weil einer aus Venedig schon dort war, nämlich der Edelmann Marco Polo. Er hat aufgeschrieben, was es dort gibt: In Zipangu leben Menschen von sehr heller Gesichtsfarbe, schöne und gut gesittete Menschen. Gold haben sie in allem Überfluss, weil so viel gefunden wird und ihr König die Ausfuhr nicht erlaubt.“
Immerhin erstarb beim Stichwort „Gold“ das Gemurmel. Jetzt lauschten alle gespannt den Worten des Admirals: „Aber nur wenige Kaufleute sind je dorthin gekommen, und nur wenige Schiffe aus fernen Ländern laufen diese Insel an. Und so werden wir die ersten sein, die diesen ungeheuerlichen Luxus und den Goldreichtum von
Zipangu kennenlernen, wenn das wahr ist, was Marco Polo von dort erzählt. Und niemand bezweifelt das: Das Dach des Königspalastes ist mit Goldplatten gedeckt so wie bei uns die Häuser oder Kirchen mit Blei; auch die Decken der Säle und viele Gemächer sind aus dicken Platten von reinem Gold, und die Fenster haben goldene Umrahmungen.“
Colón hielt kurz inne, versicherte sich mit einem Blick über die Köpfe der Wirkung, die seine Worte erzielten. Alle warteten auf mehr. Die Männer hatten glänzende Augen. Ihre einfachen Gemüter brauchten nicht viel, um in Verzückung zu geraten. Gold und Silber, das sollte ihnen recht sein.
Der Admiral fuhr fort: „Es soll ganz unmöglich sein, sich eine Vorstellung von diesen Reichtümern zu machen. Auf der Insel gibt es viele riesige Perlen, von roter Farbe, makellos rund, viel mehr wert als unsere weißen. Und solche Reichtümer hat auch der große Khan, der auf dem Festland lebt, in der Stadt Cathay, wo alle Straßen mit Gold gepflastert sind. Dort leuchten die Dächer der Häuser von goldenen und silbernen Platten und wenn die Sonne scheint, dann funkelt die ganze Stadt, so viel Reichtum ist in diesem Cathay verstreut.“
Das waren die richtigen Verheißungen zur richtigen Zeit. Realistische Schilderungen bevorstehender Gefahren und Entdeckungen wollte niemand hören. Die Männer liebten sagenhafte Geschichten und solche Glücksversprechen machten sie besoffen. Daran wollten sie gerne glauben. Der Admiral blickte in die staunenden Gesichter der Mannschaft, und er spürte wohl, wie seine Schilderung alle gefangen nahm. Vielleicht entsprachen diese Erzählungen ja der Wahrheit. Wer sollte es wissen? In dem Maße, wie Admiral Colón selbst alles glaubte, was er sich ausmalte, überzeugte er auch seine Männer: „Der große Khan trägt Gewänder aus purer Seide und er wohnt in einem Palast, der umgeben ist von vier großen Mauern, größer als alle Paläste, die es je gab. Er erhebt sich auf einer zehn Spannen hohen Plattform, um die eine breite Mauer aus Marmor aufgeführt ist, so wie auch alle Brücken und Mauern dort aus feinstem Marmor gebaut sind.“
Stumm und ergriffen lauschten die einfachen Seeleute aus Palos den Worten. Die meisten besaßen zu Hause nichts als ein paar gefräßige Kinder. Keiner nannte irgendwelche Reichtümer sein eigen. Unvorstellbar deshalb, von welchen Schätzen der Admiral ihnen berichtete: „Die Wände der Hallen und Gemächer sind mit Drachen aus vergoldetem Schnitzwerk oder mit Kriegern, Vögeln, anderen Tieren und Schlachtbildern bedeckt. Alle Wände tragen solche Bilder oder sind von Gold. Die große Halle ist riesig und dient für gewaltige Gastmähler. Die vielen Gemächer sind außerordentlich schön. Kein Baumeister könnte einen schöneren Palast bauen. An seiner Rückseite erheben sich noch andere größere Gebäude mit den privaten Besitztümern des Kaisers, seinen Schätzen, Gold- und Silberbarren, Edelsteinen, Perlen, goldenen und silbernen Gefäßen. Dort befinden sich auch die Gemächer seiner Frauen und Konkubinen. Und hinter diesen Gebäuden stehen die kleinen Schlösser für alle seine Söhne. Ein jeder, den der Khan mit einer seiner Frauen zeugt, bekommt sein eigenes Schloss. Und ihr könnt mir glauben, Männer, er hat es darin an Fleiß nicht fehlen lassen.“
Die Matrosen lauschten trunken vor Glück. Mit weit aufgesperrten Mäulern folgten sie Colóns phantastischen Schilderungen. Zuletzt ging ein befreiendes Lachen durch die Reihen. Die Mienen hellten sich auf.
„Und um nochmals auf Zipangu sprechen zu kommen“, fuhr Colón fort, „die Insel liegt im Osten, weit draußen im Meer, fünfzehnhundert Meilen vom Land und den Küsten des Großkhan entfernt. Auf sie werden wir zuerst stoßen, wenn wir unsere Richtung beibehalten, denn was hinter Cathay und dem Festland liegt, wenn man das Reich des Großkhan auf dem Landweg erreicht, wie Marco Polo dies getan hat, das muss jetzt vor Cathay liegen, wenn man die Erde umrundet und von Westen kommt, so wie wir das tun.“
Ob von dieser Logik überhaupt jemand etwas verstand, spielte keine Rolle. Wichtig war, dass Colón die Begeisterung weckte.
„Wie lange wird das dauern, Herr?“, rief einer der Matrosen. „Wie lange müssen wir noch nach Westen segeln?“
„Ich weiß nicht, wie lange es dauern wird, weil ich nicht weiß, wie günstig die Winde sein werden und wie schnell wir vorankommen“, antwortete der Admiral. „Aber eines weiß ich gewiss: Dieser Weg führt übers Meer nach Indien zu der Insel Zipangu und zu der Stadt Cathay, wo ein jeder von uns sich die Taschen mit Gold und Edelsteinen füllen kann. Und es sind nicht mehr als 700 kastilische Meilen, bis wir auf Land treffen werden, auf die ersten Inseln des großen Khan, hinter denen dann jenes Festland liegt, welches bei Marco Polo Mangi heißt.“
„700 Meilen, Admiral, wie wollt Ihr das so genau wissen?“, rief beifallheischend Rodrigo de Escobedo. Der Notar fand eben doch ein Haar in der Suppe. „Niemand ist die Strecke bisher abgefahren, manche bezweifeln, dass es diesen Weg überhaupt gibt.“
Colón warf dem königlichen Beamten einen wütenden und verächtlichen Blick zu: „Diese Entfernung von 700 kastilischen Meilen kann man ausrechnen, wenn man die übrigen Entfernungen kennt und die Daten und Angaben der Wissenschaftler, wie sie seit der Antike feststehen. Wer von euch, ihr Männer, kennt den Griechen Ptolomäus und den Juden Esdras? Wer kennt den italienischen Gelehrten Toscanelli, ein Mann der Wissenschaften, mit dem ich selbst in brieflichem Verkehr stehe? Sie alle haben die Entfernungen ausgerechnet und den Erdumfang ermittelt, und ich habe ihre Rechnungen verglichen und überprüft und eigene Rechnungen angestellt. Und deswegen weiß ich, dass es 700 Meilen sind und keine einzige mehr! Und wenn es gewünscht wird, verehrter Señor Escobedo,“ jetzt wandte sich der Admiral mit geringschätzigem Blick direkt an den königlichen Notar, „so werde ich es Euch auch noch einmal persönlich vorrechnen, anhand meiner Karten und Instrumente. Aber ich fürchte, selbst dann würdet Ihr es nicht verstehen, weil Ihr auch sonst nicht viel Verstand habt.“
Dieser Hieb wurde von der Mannschaft mit Beifall quittiert. Die Männer liebten es, wenn unter den hohen Herren die Fetzen flogen, solange man selbst dabei nicht Zielscheibe wurde. Bei den meisten einfachen Matrosen stand Escobedo nicht sonderlich hoch im Ansehen. Man fürchtete ihn, aber sonst nichts. Mit seinem Spott gegenüber dem Notar sammelte Colón deshalb Pluspunkte bei der Mannschaft. Der Admiral spürte, dass die Stimmung umschwang und er nutzte die Gunst: „Ich sage euch auch, und daran mögt ihr ablesen, was von diesen Berechnungen zu halten ist, ich sage euch auch, dass wir keine einzige Meile weiter segeln werden, als diese genannten 700 Meilen.“
Rodrigo gehörte nach wie vor zu den Unbekümmerten, und seine Augen glänzten bei der Vorstellung von Gold und Edelsteinen, wie sie der Admiral beschrieben hatte. Jeder könne sich die Taschen damit füllen, so hatte Colón es versprochen. Das bedeutete, dass auch er, Rodrigo der Schiffsjunge, sich die Taschen füllen konnte. Der Traum vom reichen Hidalgo, der heimkehrt und die schöne Isabella Pinzon zum Traualtar führt, dieser Traum nahm Gestalt an.
Trotz der Aufregung und vieler neuer Eindrücke vergaß Rodrigo nicht, dass ihm an Bord der Santa Maria Gefahren drohten. Es wäre ihm im Leben nicht eingefallen, den jüngsten Vorfall im Laderaum einem der Offiziere oder gar dem Admiral zu melden. Aber Escobedos böse Blicke gemahnten ihn daran, wann immer er dem widerlichen Flottensekretär auf Deck über den Weg lief. Begegnungen unter Deck, in den finsteren Laderäumen, versuchte er zu vermeiden. Weniger Angst jagte ihm der gedrungene Pedro Gutierrez ein. Der Repostero real galt zwar als ein treuer Gefolgsmann Escobedos, aber die Mannschaft mochte den jovialen Zivilisten wesentlich lieber, weil er mit den Männern kameradschaftlich umging. Er spielte mit ihnen Karten, packte auch mal mit an, wenn irgendwo eine Hand gebraucht wurde. Das wäre Escobedo nie eingefallen. Für Rodrigo gab es noch eine dritte Person, auf die er achten wollte: Chachu, der schwergewichtige Bootsmann. Offensichtlich hatte Chachu einen Narren an dem Schiffsjungen gefressen. Er verfolgte Rodrigo mit einem vor Verliebtheit schier irren Blick. Völlig unvorbereitet auf eine derartige Form der Zuneigung, fühlte Rodrigo sich von Tag zu Tag unbehaglicher in seiner Haut.
Chachus plumpe Annäherungsversuche – „Hey Groumette, kommst du heute Nacht in meine Koje ...“ – riefen wiederum den schönen Jakob auf den Plan. Als der Bootsmann beim Essen Rodrigo seinen Suppennapf hinreichte – „Hier iss, Kleiner, schmeckt gut!“ – und Rodrigo das dampfende Geschenk aus Kichererbsen, Reis und Bohnen ohne zu zögern annahm und sofort den Holzlöffel eintauchte – Essen war schließlich immer gut, – da stand plötzlich Jakob neben Chachu: „Hey Bootsmann, lass Rodrigo Groumette in Ruhe!“
Chachu blickte bedächtig auf, Rodrigo erschrocken. „Ich hab mit dir nichts zu schaffen, Jakob Weiberarsch, lass mich in Ruhe“, brummte Chachu.
„Du hast sehr wohl was mit mir zu schaffen. Du hast dich an den Kleinen rangemacht!“
Chachu lachte verlegen, sein mächtiger Körper vibrierte beim Versuch, es zu unterdrücken: „Mach dich nicht lächerlich, Jakob. Ich hab ihm meine Suppe gegeben, das war alles.“
Schon bildete sich ein Kreis erster Schaulustiger. Der Disput versprach, handgreiflich zu werden. Abwechslung im eintönigen Segelalltag.
„Und was soll das heißen, du hast ihm deine Suppe gegeben? Das ist ja wohl rangemacht an den Kleinen, oder wie nennst du das?“
Rodrigo erschrak über den herrischen, besitzergreifenden Tonfall, den Jakob anschlug. Er schaute kurz irritiert von seinem Napf auf. Dann löffelte er die Suppe weiter, die Chachu ihm gereicht hatte. Jakob baute sich unterdessen drohend vor Chachu auf. Dieser erhob sich gemächlich wie ein in der Mittagsruhe gestörter Braunbär: „Jetzt hör mal zu, Jakob“, begann er versöhnlich, aber Jakob stieß ihn mit den Händen weg. Eine Weile fuchtelten beide hin und her und beschimpften sich, bis Jakob plötzlich weit ausholte und einen mächtigen Faustschlag mitten in Chachus Gesicht landete. Der mächtige Bootsmann, überrascht und schmerzhaft getroffen, taumelte ein paar Schritte zurück und hielt sich verdutzt das Kinn. Anfeuernde Rufe der Zuschauer wurden laut: „Gibs ihm, Jakob!“ – „Noch einen drauf!“ – „Schlag zurück Bootsmann, lass dir nichts gefallen!“ – „Zahls ihm heim!“ Die sich anbahnende Prügelei versprach willkommene Abwechslung.
In diesem Moment ging der Alguacil Diego de Harana dazwischen. Den kleinen, krummbeinigen Mann hätten die beiden Kontrahenten, jeder wohl einhändig, über die Reling schleudern können, aber Harana besaß Autorität. „Zwei Tage in die Bilge, wenn ihr nicht augenblicklich auseinandergeht“, drohte er mit seiner scharfen, befehlsgewohnten Stimme. Er vertrat die Polizeigewalt an Bord, nicht nur auf der Santa Maria, sondern auf der ganzen Flotte. Er galt als streng. Er hielt Distanz zur Mannschaft, verkehrte nur mit Colón, Juan de La Cosa, Peralonso Niño und mit Maestro Juan Sanchez, dem Schiffsarzt. Alle anderen sprangen hurtig aus dem Sichtfeld, wenn Harana mit kurzen, energischen Schritten über das Deck stürmte.
Die Kampfhähne trollten sich notgedrungen.
„Es gibt nichts mehr zu gaffen, auseinander!“ So verscheuchte Harana auch die Neugierigen. Vor Rodrigo blieb er kurz stehen: „Pass auf, Rodrigo Groumette, dass du nicht zuviel Verehrer bekommst an Bord. Such dir einen aus und den zeige allen. Dann gibt es keinen Ärger. Sonst tauschen wir dich mal aus, auf die Pinta oder die Niña. Verstanden?“
Rodrigo verstand überhaupt nichts. Was hier vor sich ging, verwirrte ihn eher. Er nickte aber trotzdem, um Harana zu beruhigen. Der Wink mit dem Zaunpfahl kam von Pablo, der die Szene beobachtet hatte: „Ich würde mich an deiner Stelle an Chachu halten. Der hat mehr zu sagen in der Mannschaft, der kann dir ein Messer besorgen, der ist angesehen beim Admiral und er ist beliebt. Den Jakob kann keiner leiden. Das ist ein Sodomit und ein eifersüchtiger Streithammel!“
In der nächsten Nacht begehrte Jakob erstmals Zärtlichkeiten. Er plazierte seinen Schlafplatz so neben Rodrigo, dass dieser die Wärme von Jakobs Körper spürte. Dann flüsterte Jakob ihm peinliche Liebkosungen ins Ohr. Unglaubliches Zeug. Aber der Matrose meinte es ernst. Rodrigo erstarrte, rührte sich nicht. Er spürte die suchende Hand Jakobs, wie sie unter sein Hemd und in seine Hose fuhr und ihn abtastete. Rodrigo widerstand dem Impuls, die fremde Hand wegzuschieben. Er mochte es nicht, aber es tat auch nicht weh. Er spürte die Wärme von Jakobs Lippen an seiner Wange und an seinem Hals. Sich wehren? Alles ertragen? War es überhaupt so schlimm? Jakobs Liebkosungen fühlten sich nicht unangenehm an. Trotzdem blieb Rodrigo ausgestreckt liegen, steif wie ein Brett, und ließ regungslos alles Weitere über sich ergehen.
Letztendlich versuchte Jakob, wenn auch unbeholfen, ein zärtlicher und rücksichtsvoller Liebhaber zu sein. Er streichelte Rodrigo, liebkoste ihn, näherte sich behutsam, ohne Gewalt.
Was wollte man in einer Männergesellschaft wie jener auf der Santa Maria erwarten? Vierzig Mann auf engstem Raum, wochenlang, wenn nicht gar Monate zusammengepfercht, fern der Heimat, fern von Frau und Kindern, fern der Geliebten, fern von jedem weiblichen Wesen und seien es nur die Huren in den Hafenkneipen von Palos.
Der schöne Jakob gehörte zu denen an Bord, die am wenigsten Hehl aus ihren Neigungen machten, die offen als Freier um einen Liebhaber buhlten. Die jungen und knabenhaften Schiffsjungen gehörten naturgemäß zu den leichtesten und bevorzugten Opfern. Neben halben Kindern, wie Martin de Urtubia und Rodrigo, gehörten noch etliche blutjunge Halbwüchsige zur Mannschaft, Pablo etwa oder Pedro de Salcedo, der Page, der den Kajütendienst für die Herren vom Achterdeck verrichten musste. Auch der milchbärtige Pedro de Tereros, der Diener des Admirals, zählte noch keine achtzehn Jahre. Der aufgeblasene Jüngling lockte allerdings keine Verehrer an, arrogant und hochfahrend wie er war. Nach Verlassen der kanarischen Inseln war er allerdings der Erste gewesen, der wegen des immerwährenden Windes in Tränen ausgebrochen war.
Rodrigo geriet unschuldig in den Teufelskreis der Männerfreundschaften und Eifersüchteleien. Er ließ sich darauf ein, nicht aus Neigung, sondern um zu überleben.