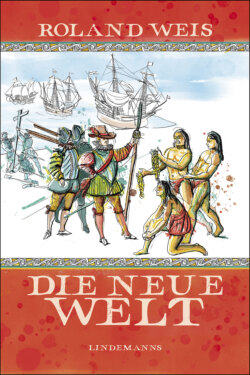Читать книгу Die neue Welt - Roland Weis - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеIX. Im Grasmeer
„Ah! De Proa“, rief Peralonso Niño, der Wachhabende, und seine Stimme kämpfte wütend gegen den Wind. „Hallo Vorschiff!“
Die Matrosen seiner Schicht kamen im Sturmschritt nach achtern gerannt, um neue Befehle entgegenzunehmen.
„Verschnürt das Bonet, hol dicht die Gordings, holt ein die Marssegelschoten“ und „an die Pumpe, bis sie ansaugt“, so scheuchte
Peralonso Niño seine Männer. Der junge Pilot verlor die Übersicht nicht, sie parierten, ihre eingeübten Handgriffe hielten die Santa Maria auf Kurs.
Die plötzliche Hektik hatte ihre Gründe: In einer willkürlichen Laune hatte es zu regnen begonnen, das erste Mal seit der Ausfahrt. Der bis dahin freundliche Himmel färbte sich bleigrau, eine grimmige Wand türmte sich plötzlich vor der kleinen Flotte auf. Die Schiffe fuhren mit unverminderter Geschwindigkeit in die dichten Schleier hinein, doch sie mussten die Besegelung leicht zurücknehmen. Eine reine Vorsichtsmaßnahme, ansonsten bedeutete der Regen kaum eine Behinderung. Im Gegenteil: Die Männer hielten ihre struppigen Gesichter in die kühle Dusche und genossen die Erfrischung. Gleichzeitig spülten die Sturzfluten allen Dreck vom Deck.
Nicht nur die Segelmannschaft durfte sich über Arbeit nicht beklagen: Domingo Vizcaino, der kantige Küfer, zuständig für die Wein- und Wasservorräte an Bord, trommelte Helfer zusammen, um Frischwasser zu fassen. Von seinem struppigen Bart tropften bereits die Rinnsale. Die Männer sammelten das Regenwasser in Fässern. Wer konnte wissen, wie bald es diese Gelegenheit wieder gab? Wasser und Wein standen als einzige Getränke an Bord zur Verfügung. Beides führte die Besatzung in großen Fässern mit. Domingo Vizcaino, ein eher verschlossener, hagerer Typ, hatte Sorge zu tragen, dass diese Fässer stets dicht und fest angelascht waren, damit sie nicht ins Rollen kamen. Nach Wochen auf hoher See stand das Wasser in ihnen allerdings brackig und sauer. „Rattenpisse“, sagten die Männer dazu und hielten sich die Nase zu, wenn sie einen Schluck nahmen. Um den üblen Geschmack zu überdecken, gaben die Seeleute den gleichen Teil Wein dazu, was den Genuss jedoch nicht wesentlich steigerte. Das frische Regenwasser war also überaus willkommen.
Die Hühnerschar, welche die Santa Maria als lebende Verpflegung mitführte, zeigte sich gar nicht einverstanden mit dem Wetterwechsel. Ein empörtes Gegacker und Flügelschlagen setzte ein. In ihren engen Käfigen hackten die Hennen mit ihren Schnäbeln gegenseitig auf sich ein. Die Schiffsjungen schwärmten aus, um die aufgeregten Hühner mitsamt Hahn zu beruhigen, indem sie Segeltuch über die Gitterkäfige zerrten.
Mittschiffs torkelte ein bleicher Jacomo Rico über die Planken, wankte zur Reling und kotzte sich die Galle aus dem Leib. Das Los des Pumpenmannes: Die Männer an der Pumpe bewältigten wie immer die unangenehmste Arbeit. Sie standen sozusagen in der Schiffsscheiße. Der Kadavergestank des Bilgenwassers, das sie hochpumpten und über Bord spülten, bildete selbst für geübte Nasen eine außerordentliche Zumutung.
Den Regen selbst, einen weichen und tropisch warmen Guss, genossen hingegen alle in vollen Zügen. Offiziere wie Mannschaften freuten sich über die fetten Tropfen, die binnen weniger Minuten sämtliche Kleidungsstücke am Leib von oben bis unten einweichten. Durchnässt wurden die Pluderhosen, der Parka, jener charakteristische mit einer Kapuze versehene Kittel, sowie der Gorro, die meist rotfarbene, wollene, gestrickte Mütze. Dabei handelte es sich um eine Kappe, die alle Matrosen trugen, egal ob es regnete oder die Sonne schien.
Schon tagsdarauf, Sonntag, 16. September, der zehnte Tag auf dem Meer, schlief der Regen auch wieder ein. Stattdessen begrüßte die Männer am Morgen ein strahlendblauer Himmel wie im Frühling über Andalusien, dazu wohltuende Wärme und nach wie vor beständiger Wind von Osten nach Westen. Aber da gab es etwas Eigentümliches. Lope Chips, der im Allgemeinen bis zum Autismus wortkarge baskische Kalfaterer, entdeckte es als Erster, als er einen Kübel Kalfaterpech über die Reling kippte: Gras auf dem Meer!
Die schwarze Kalfatermasse, eine Mischung von Walfischöl und Fichtenharz, mit der regelmäßig das Deck und die Schiffswände verpicht und abgedichtet werden mussten – es oblag den Schiffsjungen, diese Masse immer wieder neu anzurühren –, plumpste nicht etwa wie üblich in schäumende Wellen und versank, sondern sie fiel in eine grüne Matte und zog sie gurgelnd in die Tiefe. Das seltsame Kraut schwamm in Bündeln auf der Wasseroberfläche, bedeckte mal nur ein paar Handbreite, dann wieder mehrere Quadratmeter am Stück das Wasser. „Hey Groumette“, rief Lope Chips und winkte Rodrigo herbei. „Schau mal da runter!“
Rodrigo beugte sich über die Reling: „Unkraut!“, rief er erschrocken aus. „Da schwimmt jede Menge Unkraut auf dem Meer, sieht aus, wie eine riesige Spinatsuppe.“
Lope Chips rieb sich nachdenklich das stoppelbärtige Kinn.
Rodrigo blickte abwechselnd hinunter auf die vielen Bündel grünen Krauts und auf das zerknitterte und wettergegerbte Gesicht des Kalfaterers. Doch der schweigsame Baske schien genauso verblüfft. Er hatte schon viel erlebt, in seinem Seefahrerleben, aber grünes Kraut mitten im Meer?
Inzwischen bestaunte auch die übrige Mannschaft die schwimmenden Grasflächen, die steuerbords wie backbords an der Santa Maria vorüberzogen. Wie ein unter Wasser gesetztes Kleefeld schaukelten die grünen Matten in den Wellen. Immer mehr Pflanzen breiteten sich auf der Meeresoberfläche aus, und die Schiffe fuhren mitten hinein. Alle Mann versammelten sich in Gruppen an der Reling und diskutierten die ungewöhnliche Erscheinung.
„Algen“, vermutete José Pequinos.
„Seegras“, widersprach Chachu. „Es sieht aus wie Seegras.“
Der wieder genesene Jacomo Rico kam mit nacktem Oberkörper herbeigeturnt und balancierte elegant wie ein Zirkuskünstler eine am Seil gesicherte lange Stange mit Haken über das Deck.
„Hier!“, rief er. „Wir holen mal eine Ladung an Bord. Heda, achtern, aufgepasst, zieht die Köpfe ein!“
Er schwenkte seinen Staken über die Reling und hangelte zu den Wellen hinunter. Tatsächlich verfing sich schnell eine größere Menge des Krauts im Haken. Doch als Jacomo das Bündel an Bord hieven wollte, stellte sich heraus, dass die einzelnen Grasbüschel untereinander durch lange Fasern verbunden waren. So hingen größere Mengen an einem Stück zusammen, und drei Mann mussten Jacomo Rico helfen, die Stange wieder an Deck zu ziehen. Es hatte sich ein über mannsgroßer Klumpen Kraut und Blätter daran verfangen, vollgesaugt mit Wasser und so schwer, dass der übermütige Lockenkopf seinen Fang alleine gar nicht bergen konnte. Schließlich rissen die Fasern der miteinander verflochtenen Wasserwurzeln, und das ganze Grünzeug lag vor ihnen auf den Decksplanken. Das Gras schimmerte matt in einer weißlichen oder fahlen Farbe wie welkes Heu. Kleine weiße Beeren hingen an den Stengeln. Auf Deck wirkte das Grünzeug stumpf; es sah viel saftiger und viel grüner aus, wenn es im Wasser schwamm.
Chachu schob ein Bündel mit den Zehen auseinander, die anderen standen im Kreis darum herum. Schiffsarzt Sanchez gesellte sich mit interessiertem Gesichtsausdruck dazu. Er kniete sich nieder und nahm das Seegras in Augenschein: „Irgendwie sieht das Zeug aus wie unsere Gartenraute, schaut euch nur die Blätter an.“
Dann nahm er eines der kleinen Beerenkörnchen, die an den Krautbüscheln hingen, zwischen die Finger und drehte es sorgfältig prüfend.
„Beißt doch mal rein, Maestro!“, schlug Jakob vor. „Vielleicht schmecken sie ja.“
Der große Krautklumpen wurde zerfleddert. Jeder zog sich ein Stück heraus, untersuchte die Fasern und Blätter, die runden Körnchen, die denen des Wachholderstrauchs ähnelten, die Männer rochen daran, schnupperten skeptisch, bissen hinein, zerschnitten es mit ihren Messern, bis es in Fetzen lag. Im anatomischen Institut von Sevilla hätte man die Sache kaum gründlicher angehen können. Der Admiral legte Gleichmut an den Tag. Er lehnte sich über die Reling und beobachtete den Vorüberzug der Grasmatten. So weit das Auge reichte sah man überall kleinere und größere Grasinseln, an manchen Stellen wuchsen sie zu beachtlichen Teppichen von mehr als drei oder vier Schiffslängen zusammen.
Colón kletterte, nachdem er gebührende Zeit hatte verstreichen lassen, vom Achterkastell herunter und hob zu einer seiner Ansprachen an: „Männer, dankt dem Allmächtigen, der schützend und mit Wohlwollen unsere Wege lenkt. Denn dies hier ist ein gutes Zeichen nahen Landes. Solches Algengras braucht Land um zu wachsen. Also ist Selbiges nicht fern. Ich vermute, dass ein Sturm die Grasbüschel von einer Felsenküste losgerissen hat, so dass sie hier nun auf dem Meer treiben.“
Der königliche Schreiber Escobedo legte es bei jeder Gelegenheit auf Widerspruch an: „Wenn Land nicht weit ist, warum segeln wir dann nicht hin, Adelante?“, rief er von der anderen Seite des Schiffes her. Dort stand der knochige Notar selbstgefällig mit seinem Kumpan Pedro Gutierrez an der Reling und hörte Colón mit schiefem Grinsen zu.
Der Admiral entgegnete höflich, mit jenem Unterton von nachsichtiger Geduld, welche man begriffsstutzigen Kindern entgegenbringt: „Es ist nicht jenes Land, welches wir suchen, Señor Escobedo. Wir wollen nach Zipangu, habt Ihr das vergessen? Was sollen wir auf irgendwelchen unbewohnten Inseln mitten im entlegenen Ozean?“
Gutierrez schob seinen Wanst in den Vordergrund und mischte sich ein, ganz die Stimmung der Mannschaft treffend: „Herr, wir haben zehn Tage kein Land mehr gesehen. Wieso sollen wir nicht nach jenen Inseln suchen, von denen dieses Kraut sich losgerissen hat? Wir könnten unsere Vorräte auffrischen und das Trinkwasser erneuern. Und wir könnten mal wieder festen Grund unter den Füßen spüren.“
Colón wandte sich an Gutierrez: „So redet nur eine Landratte daher. Unsere Vorräte bedürfen keiner Auffrischung, ebenso wenig unser Trinkwasser. Erst gestern hat es geregnet. Wir vergeuden nur kostbare Zeit, wenn wir hier nach unbedeutenden Inseln suchen.“
Der dicke Repostero Real ließ nicht locker: „Und wenn es das Festland ist, das wir suchen? Was, wenn Zipangu schon in der Nähe ist, mit dem großen Khan und all seinen Schätzen und Reichtümern?“
„Das ist so gänzlich ausgeschlossen, Señor Gutierrez, dass ihr euch solche Träume aus dem Kopf schlagen könnt“, erwiderte Colón, jetzt bereits leicht ungehalten. Er wandte sich wieder an die ganze Mannschaft, die sich inzwischen zu einem Halbkreis um ihn versammelte und aufmerksam zuhörte. Der Admiral ließ eine seiner kategorischen Behauptungen folgen: „Ich habe genaue Berechnungen und auch geheime Karten, wonach sich in diesen Breiten eine Menge unbewohnter, kleiner Inseln befinden. Von ihnen kommt dieses Beerenkraut. Aber sie sind unbedeutend und liegen verstreut. Vielleicht werden wir sie auf unserem Rückweg ansteuern. Dann werden wir sehen, ob sie eventuell geeignet sind als Stützpunkt für die Schiffe und Flotten unserer Majestät, König Ferdinand, so sie künftig zwischen Spanien und den indischen Landen verkehren. Aber jetzt, wo wir erst den Seeweg nach Indien zu finden trachten, verlieren wir keine Zeit mit der Suche nach diesen Inseln, so verlockend das auch mancher ängstlicheren Natur in der momentanen Lage erscheinen mag. Darum lasst uns weitersegeln nach Indien.“
Woher Colón die Dreistigkeit nahm, solchen Unfug zu erzählen, blieb sein Geheimnis. Jedenfalls wirkte die Medizin. Es erhob sich kein Widerspruch mehr. Aber in den meisten Gesichtern spiegelte sich Skepsis.
In dieser Nacht beschäftigte Rodrigo die Vorstellung von unbekannten und möglicherweise unbewohnten Inseln unmittelbar in ihrer Nähe, wie sie auf des Admirals geheimen Karten angeblich eingezeichnet waren.
„Meister de La Cosa“, plagte er deshalb unmittelbar nach Beginn der Frühwache den Piloten, „was denkt Ihr, was es mit den Inseln auf sich hat, die hier im Meer verstreut liegen?“
Der Kapitän schnaufte und drehte sich widerwillig zu Rodrigo hin. Er hatte in den Sternenhimmel geträumt, vielleicht von einer Geliebten im fernen Galicien. Rodrigos Fragerei war ihm lästig: „Was weiß ich, welche Inseln es sind. Es wären ja keine geheimen Karten mehr, wenn jedermann davon wüsste. Es gibt viele Eilande im atlantischen Ozean, von denen man nicht viel mehr kennt als sagenhafte Berichte. Vielleicht ist es Antilia, die Insel mit den sieben goldenen Städten, oder Brasil, nach der der englische Kapitän Tloyde vor zwölf Jahren schon gesucht hat, oder es ist die Insel des heiligen Sankt Brendan?“
„Erzählt Ihr mir davon?“
„Vom heiligen Sankt Brendan?“
„Von seiner Insel?“
Juan de La Cosa seufzte. Er wollte seine Ruhe haben, doch das Interesse des Jungen schmeichelte ihm und er ließ sich erweichen. Obwohl Juan La Cosa gelegentlich etwas Geheimnisvolles anhaftete, eine Art Schleier, hinter dem sich möglicherweise eine ganz andere Person verbarg, gefiel es dem baskischen Schiffseigner, als Instanz in Sachen Seefahrt und Seemannsgeschichten angesprochen zu werden. Die jungen Leichtmatrosen und Schiffsjungen hätten alle seine Söhne sein können. Von der Besatzung der Santa Maria zählten nur der alte Schatzmeister Sanchez de Segovia, der Admiral und zwei oder drei ältere Matrosen mehr Lebensjahre als der rund 40-jährige de La Cosa. Er schloss die Augen um nachzudenken. Rodrigo wartete. Am Horizont tauchte der erste Schimmer des neuen Tages auf. Die Santa Maria pflügte mit beruhigendem Rauschen durch die Wellen. Endlich begann Juan de La Cosa zu sprechen. Er erzählte die Sage von den Fahrten des heiligen St. Brendan, so wie sie seit Generationen von den Seefahrern an der ganzen Atlantikküste überliefert wurde: „Brendan war ein Mönch aus Irland. Er lebte im 6. Jahrhundert als in welchem ringsum in Europa die Heiden und Barbaren hausten, und nur die irischen Mönche unseren heiligen katholischen Glauben aufrechterhielten. Diese Mönche hörten von einem Mitbruder, dass es im fernen Ozean eine Insel gäbe, mit sagenhaften Reichtümern, auf der man weder Speise, Trank noch Kleidung brauche, niemals schlafen müsse und trotzdem ewig lebe. Es ist die Paradiesinsel!“ La Cosa senkte verschwörerisch die Stimme, machte eine Kunstpause und flüsterte zu Rodrigo hinunter: „Ein Fluss fließt quer hindurch. Wer von seinem Wasser trinkt, dem winkt die Unsterblichkeit.“
Rodrigos Augen glänzten: „Vielleicht finden wir diese Insel?“
„Warte ab, was weiter passierte“, dämpfte de La Cosa, und sein Tonfall nahm an Wichtigtuerei zu: „Als der heilige Brendan diese Erzählung hörte, rüstete er ein Boot aus und sammelte seine tapfersten Mitbrüder. Sie segelten nach Westen. Sieben Jahre lang segelten sie über unbekannte Weltmeere. Sie entdeckten viele Inseln. Eine davon war gar der Rücken eines riesigen Walfisches. Aber die Paradiesinsel fanden sie nicht. Als sie schon am Ende der Welt waren, segelten sie noch einmal über einen Monat nach Westen, bis sie in der vierzigsten Nacht plötzlich in eine dichte Nebelbank gerieten. Sie fuhren mitten hinein. Da umgab sie ein strahlendes Licht – und das Schiff lag an einer Küste.“
„An der Paradiesinsel?“, fragte Rodrigo aufgeregt.
Juan de La Cosa plusterte sich auf: „Ja, es war die Paradiesinsel. Die Insel des ewigen Lebens. Als sie das Schiff verlassen hatten, sahen sie weites Land voller Obstbäume, wie im Herbst. Als sie das Land durchwanderten, fehlte ihnen nur die Nacht. Es war immer taghell und sie erhielten soviel Obst und Früchte, wie sie wollten, und sie tranken aus Quellen. Sie durchstreiften tagelang das Land und konnten sein Ende nicht finden, bis sie an einen großen Fluss kamen, der sich mitten durch die Insel zog. Dort stand plötzlich ein Junge am Ufer, der sie einzeln bei ihren Namen rief und ihnen sagte, diesen Fluss könnt ihr nicht überschreiten. Dann wandte er sich an den heiligen Brendan und sagte zu ihm ‚Dies ist das Land, das du sieben Jahre lang gesucht hast. Kehre jetzt in das Land deiner Geburt zurück und nimm von den Früchten und Edelsteinen dieses Landes mit, soviel dein Schiff fassen kann’.“
Der Kapitän legte eine Kunstpause ein um sich zu vergewissern, dass Rodrigo noch aufmerksam zuhörte, dann fuhr er fort: „Und sie beluden ihr Schiff mit unendlichen Reichtümern. Doch bevor sie absegelten, sagte der Junge noch: ‚Nach vielen Jahrhunderten wird dieses Land euren Nachfolgern offenbart werden, wenn eine Christenverfolgung unvermutet kommen wird. Der Fluss, den ihr seht, teilt diese Insel. So wie sie euch reich an Edelsteinen und Früchten erscheint, so bleibt sie alle Zeiten ohne jeden Schatten in der Nacht. Ihr Licht ist nämlich Christus’.“
Rodrigo schlug das Kreuzzeichen: „Und dann segelten sie zurück?“
„Dann segelten sie zurück. Und seither hat niemals jemand wieder diese Insel gefunden.“ La Cosa richtet sich auf und machte eine theatralische Geste gegen den Himmel.
„Vielleicht finden ja wir diese Insel, mit all ihren Edelsteinen?“
Juan de La Cosa lachte sein rauchiges Lachen. „Vielleicht! Vielleicht auch nicht. Immerhin segelte der Mönch vierzig Tage, wir sind erst elf unterwegs.“
Rodrigo grübelte über die sagenhafte Erzählung nach, so dass er fast vergessen hätte, die Ampolleta zu wenden.
„Erzählt ihr mir auch die Geschichte von Antilia, der Insel mit den sieben goldenen Städten?“, fragte er nach einer Pause.
Der Pilot winkte ab: „Ein andermal. Jetzt pass auf, die Wache ist gleich um. Weck die anderen auf, es dämmert schon, bald beginnt der Tag.“
So drehte Rodrigo zum siebten und letzten Mal in dieser Wache die Ampolleta um und sang mit seiner krächzenden Knabenstimme in die Morgenstimmung hinein: „Gut ist, was vergeht, besser noch was kommt, sieben vorbei und acht verweht, mehr verweht wenn’s Gott so frommt, bei Zählen und Schwinden wird gute Fahrt sich finden.“
Jakob kam hinzu und zupfte Rodrigo am Ärmel des Parkas: „Hör auf mit dem Gekrächze, schau dir das Meer an!“
Noch lag der Horizont unter dem Dunst der morgendlichen Dämmerung, aber im diffusen Licht erkannte Rodrigo, was Jakob meinte: ringsum alles grün! Bis hinüber zur Pinta und Niña, die sich als vage Schemen am Horizont abzeichneten. Die Schiffe waren vollkommen umgeben von einer dichten Matte grün-braunen Seegrases, ein einziger riesiger Teppich. Das Meer schien verschwunden. Es war, als segelten sie über eine Wiese. Nie zuvor war einer der Männer so weit nach Westen gesegelt, und deshalb kannte auch keiner dieses Phänomen: Die Flotte befand sich im Sargasomeer, wie es später getauft wurde, einem riesenhaften Grasmeer mitten im Atlantik, von dem die christliche Seefahrt bis zu diesem Tage noch keine Kenntnis hatte.
Niemand von der Frühwache legte sich zum Schlafen nieder. Alle wollten sehen, wie die Piloten und der Admiral auf diesen grünen Schrecken reagieren würden.
Rodrigo lehnte sich über die Reling und beobachtete das Gras da, wo es vom Schiffsbauch der Santa Maria durchpflügt wurde. Es teilte sich anstandslos, die Wellen schlugen gegen die Schiffswände, die drei Schiffe machten unvermindert Fahrt, und es war, als behinderte die alles bedeckende Matte das Vorwärtskommen in keiner Weise.
„Wir werden stecken bleiben!“, kommentierte Jakob trocken nach einer Weile. „Dieses Kraut wird immer dicker und dichter; wir werden festwachsen auf diesem verdammten Meer.“
Nicht allen aber erschien das Gras so bedrohlich wie dem schönen Jakob. Im Gegenteil. Weil das Meer durch den Tang ein ganz trübes Aussehen annahm, bekamen viele den Eindruck, man befände sich in einem sumpfigen Moorgebiet. Sie vermuteten daher verstärkt, dass die Flotte wirklich in die Nähe von Land gelangt sei. Auf der Niña wurde gesungen. Die Männerstimmen hallten fröhlich über das Meer.
Die ewigen Nörgler aber blieben unversöhnlich: „Mir macht ihr nichts vor, ich glaube nicht, dass es hier wirklich Inseln gibt“, stichelte süffisant Notar Rodrigo Escobedo, der sich auf dem Achterdeck lümmelnd seinem Müßiggang hingab. „Bisher hat jedenfalls noch keiner Land gesehen, ihr müsst es uns schon zeigen, Admiral.“
Colón blitzte Escobedo zornig an: „Eure Reden gefallen mir nicht, Señor! Hat Euch vielleicht der portugiesische König geschickt, um diese Entdeckungsfahrt zu stören und zu verhindern? Wollt Ihr vielleicht die spanischen Majestäten um den Erfolg bringen?“
Escobedos Geiergesicht lief wie gewohnt rötlich an. Dass Colón ihn als portugiesischen Spion verdächtigte, empfand der Notar als eine Ehrabschneidung. „Gott ist mein Zeuge, Colón, ein falsches Wort von Euch, ein falscher Befehl, und ich werde dafür sorgen, dass Ihr in den Kerkern von Sevilla endet“, zischte er.
Colón lächelte überlegen. Die schmalen Lippen kräuselten sich dabei und zogen sich in den Mundwinkeln leicht nach unten, so dass ein Hauch milden Spotts auf seinem Antlitz lag. Allein dies trieb Escobedo zur Raserei, wie sein hektisch zuckendes Gesicht verriet. Ungerührt setzte Colón hinzu: „Der Allmächtige ist schon mit mir und unseren katholischen Majestäten im Bunde. Ihr müßt Euch einen anderen Kronzeugen suchen, Señor Escobedo.“
„Wir sprechen uns noch, Admiral, verlasst Euch darauf!“, drohte Escobedo. „Ihr nehmt Euch zu viel heraus im Namen des Königs und der Königin. Noch bin ich der Beamte des Hofes und Ihr seid nichts weiter als ein genuesischer Seefahrer. Noch habt Ihr den versprochenen Seeweg nach Indien nicht gefunden und keinen großen Khan, keine Schätze, kein Zipangu, kein Cathay. Abgerechnet wird erst, wenn Ihr mit leeren Händen heimkehrt nach Spanien, Colón. Und dann Gnade Euch Gott!“
Zu solch hasserfüllter Boshaftigkeit hatte Escobedo sich bisher noch nie hinreissen lassen. Gutierrez musste ihn an der Schulter fassen und zurückhalten, damit der königliche Notar nicht noch unüberlegtere Drohungen aussprach. Der Admiral lächelte sein gewohnt überirdisches Lächeln, fixierte seinen hochroten Widersacher und schüttelte gnädig den Kopf, als wollte er sagen: Welch ein Verrückter!
Zu den Nörglern gehörte neben Escobedo und seinen Anhängern auch Jakob. Er pflegte zwar keinen Groll gegen den Admiral, dafür peinigte ihn aber eine abergläubische Angst vor den Naturgewalten. Jakob plagte den diesbezüglich völlig unbekümmerten Rodrigo mit Schreckensvisionen: „Morgen wird uns das Seegras so dicht umranken, dass wir uns den Weg mit Äxten freihauen müssen, du wirst sehen.“
Rodrigo spuckte Olivenkerne ins Wasser und grinste: „Mir machst du keine Angst, Jakob. Ich vertraue dem Admiral und Kapitän de La Cosa.“ Das beschrieb seine tiefste Überzeugung.
„Du vertraust ihnen nicht nur, du vergötterst sie“, brach es aus Jakob hervor. „Es sind aber nur zwei Kerle, die uns Hirngespinnste vorgaukeln.“ Aus seinen Worten sprachen Neid und Eifersucht: „Der Admiral hat gesagt, die Sterne bewegen sich, also bewegen sie sich; der Kapitän hat gesagt, die Insel Antilia ist in der Nähe, also ist sie in der Nähe; der Admiral sieht einen Frosch und alle jubeln.“ Jakob ereiferte sich weiter: „Admiral hier, Admiral da, Kapitän hier, Kapitän da. Was die zwei sagen, das ist Evangelium, und alle lassen sich einwickeln, du zuallererst.“
Rodrigo zuckte die Schultern: „Bisher haben sie jedenfalls recht gehabt“, bemerkte er lakonisch. Jakob gefiel diese beiläufige Gelassenheit nicht: „Ist dir eigentlich vollkommen egal, was auf diesem Schiff passiert? Ist es dir egal, wenn wir in Abgründe segeln, wenn wir in diesem Grassumpf verschlungen werden oder wenn uns Stürme auf den Meeresgrund schmettern und wir elend umkommen? Denk doch mal nach Kleiner, wir sind am Ende der Welt. Hier war noch niemand vor uns, auch nicht der Admiral. Und deshalb kann er auch gar nicht wissen, was uns erwartet.“
Das schreckte Rodrigo nicht. Er sah, dass die Schiffe ruhig segelten, dass der Himmel in freundlichem Blau strahlte, dass des Nachts die Sterne leuchteten. Wovor sollte er sich also fürchten?
Weiterhin wucherte ringsum viel grünes Kraut auf der Meeresoberfläche. An den nächsten Tagen gesellte sich noch eine Flaute hinzu. Die See gönnte sich eine Ruhepause und lag so ruhig und glatt vor ihnen, dass ein jeder sich an die Windstille vor den Kanaren erinnerte. Dabei blies sogar noch ein schwaches Lüftchen; ein Bruder Leichtfuß, völlig unberechenbar, kam mal von backbord, mal von steuerbord, sprang hierhin und dorthin, blieb dann wieder für Stunden völlig fern, so dass von Vorwärtskommen keine Rede sein konnte.
Gegen Mittag des nächsten Tages lagen die Schiffe fast regungslos im Meer, nur wenige Längen voneinander getrennt. Die See zeigte sich nicht mehr ganz so stark vom Beerentang bedeckt wie an den Tagen zuvor, sodass Pablo angesichts des erfrischend intensiv violettblauen Wassers auf die Idee kam: „Lasst uns ins Wasser springen und baden!“
„In das Kraut hinein?“
„Hast du etwa Angst?“
Die falsche Frage. Rodrigo durfte man nicht fragen, ob er Angst hatte, schon gar nicht durfte Pablo diese Frage stellen. Rodrigo streifte sein Hemd ab. „Ich springe!“
„Das würde ich nicht tun“, mischte sich Jacomo Rico ein. „Vielleicht gibt es hier Haie.“
„Was weißt du schon von Haien?“, fragte Pablo großspurig, der ganz gewiss selbst noch nie in seinem Leben einen solchen Raubfisch gesehen hatte.
„Ich habe Haifische schon erlebt“, beschwor der großmäulige Lockenkopf. Pablo baute sich herausfordernd vor Jacomo auf, die Fäuste in die Seiten gestemmt: „Dann erzähl uns mal, was es auf sich hat, mit diesen Haifischen!“
Neben Pablo und Rodrigo interessierten sich noch andere brennend für das Thema, vor allem die Jüngeren. So stand auch Pedro de Tereros in der Nähe, der bleiche Diener des Admirals, Martin, Jakob und zwei, drei andere, alle begierig, mehr über den berüchtigten Räuber der Meere zu erfahren.
„Wir haben mal einen gefangen“, prahlte Jacomo Rico. „Es war bei einer Fahrt nach Madeira. Wir zogen ihn mit einem eisernen Haken aufs Oberdeck und er maß mehr als sechs Fuß in der Länge. Er lebte noch, und ich sage euch, wir mussten vor ihm ebenso auf der Hut sein wie vor einem gefährlichen, bissigen Hund. Seine Haut ist fast so grob und rau wie eine Feile und er hatte einen großen, flachen Kopf, ähnlich dem eines Wolfes, das könnt ihr euch aussuchen.“
„Du erzählst Schauermärchen“, zweifelte Pablo.
„Doch, er hat recht“, mischte sich Jakob ein. „Die Haie sind gefährliche Monster. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was für spitze und scharfe Zähne sie haben. Beißen sie einen ins Bein, so reißen sie das betreffende Glied einfach ab. Am liebsten ziehen sie den ganzen Menschen in die Tiefe. Sie richten nichts als Unheil an, gefangen oder im Wasser. – Und ihr Fleisch schmeckt übrigens fade und ist zäh, das könnt ihr glauben.“
Alle machten große Augen. Begierig sogen die Jungen diese Schilderungen auf.
„Was habt ihr mit eurem gefangenen Haifisch gemacht?“, wollte Rodrigo wissen.
„Wir haben ihn mit Stangen gestochen und gequält, wie einen wütenden Köter“, erzählte Jacomo Rico mit sichtbarer Begeisterung. „Wir schlugen ihn mit eisernen Keulen halbtot und schnitten ihm die Flossen ab. Dann warfen wir ihn zurück ins Wasser, nachdem wir ihm noch einen Fassreifen an den Schwanz gebunden hatten. Ehe er versank, kämpfte er noch lange an der Wasseroberfläche und wehrte sich verzweifelt. Wir hatten immerhin einen Zeitvertreib, aber mit den Viechern ist beileibe nicht zu spaßen.“
Alle, die zugehört hatten, saßen gebannt auf ihren Plätzen. „Wir sollten auch versuchen, einen zu fangen“, schlug Pablo vor und sprang auf. „Als Köder werfen wir den Martin ins Wasser!“
„Nein!“, schrie Martin de Urtubia und wollte die Flucht ergreifen. Doch Pablo packte ihn am Arm und drückte ihn in Richtung Reling. Jacomo Rico sprang ebenfalls gleich herbei, und sie zerrten zu zweit an dem schreienden Schiffsjungen. Da zögerte auch Rodrigo nicht lange. Bevor jemand auf den Gedanken verfiel, ihn anstelle von Martin ins Wasser zu werfen, wollte er lieber auf der Seite der Täter als das Opfer sein. Mit vereinten Kräften hoben sie Martin in die Höhe und warfen ihn über die Reling ins Wasser, obwohl der Junge verzweifelt schrie, strampelte und überall versuchte, sich festzuhalten. Sie starrten hinunter und beobachteten, wie er im Wasser aufschlug, untertauchte und wieder an die Oberfläche kam. Hoffentlich konnte er schwimmen. Niemand hatte danach gefragt.
„Da wird der Admiral böse sein, wenn er davon erfährt“, sagte einer. Alle drehten sich um. Der aufgeblasene Schiffspage Pedro de Tereros hatte gesprochen. Als ihn plötzlich alle so anstarrten, erbleichte er, sackte in sich zusammen und äugte verängstigt von einem zum anderen.
„Du meinst, so ein kleiner Happen wie Martin reicht nicht aus als Haifischmahlzeit?“, fragte Pablo grinsend.
Tereros mochte ein oder zwei Jahre älter als Pablo sein, vielleicht 17 oder 18 Jahre alt. Aber er reichte dem Jüngeren kaum bis ans Kinn, und an Schnelligkeit, Kraft und Geschicklichkeit konnte er es erst recht nicht mit dem Tischlersohn aus Palos aufnehmen. Der Kajütpage wollte flugs kehrtmachen und sich davonschleichen, aber Pablo erwischte ihn noch an der Kapuze, und schon ging es dem unbeliebten Höfling wie zuvor dem Schiffsjungen. Tereros zappelnder Leib wurde von vielen Händen gepackt und unter begeistertem Gejohle über Bord ins Wasser hinuntergeworfen, wo Martin de Urtubia bereits prustend und um sich schlagend zappelte.
„Und wenn sie nun wirklich von Haifischen gebissen werden?“, fragte Jakob.
„Dann haben wir zwei Idioten weniger!“, bemerkte Pablo kaltschnäuzig, während die anderen doch erschreckt verstummten. Als Pablo sah, dass alle von ihm einen Hinweis erwarteten, wie es nun weitergehen sollte, ob man vielleicht die zwei Unglücklichen, die unten im Wasser strampelten und schrieen, nicht schleunigst wieder herausziehen sollte, da entschied sich Pablo für eine ganz andere Reaktion, die allerdings für ihn typisch war. Er schlüpfte aus seinen Kleidern, kletterte auf die Reling, hielt sich an den Wanten und machte Anstalten, ins Wasser zu springen. „Ha, was ist, habt ihr Angst? Geht einer mit? Das Wasser ist warm, lasst uns baden.“ Er zögerte noch kurz, dann ließ er die Wanten los und rief: „Heda, ihr da unten, aufgepasst, hier kommt Pablo, der Haifischfresser!“ So stieß er sich ab und stürzte kopfüber ins Meer.
Eine Mutprobe! Rodrigo ließ sich nicht lange bitten. Bisher hatte er sich noch nie von Pablo übertreffen lassen. Also war er der Nächste, der ins Meer sprang. Und als die anderen sahen, wie alle ausgelassen und gefahrlos im Wasser planschten, folgten auch noch einige andere, so dass bald rund um die Santa Maria fröhlich gebadet wurde. Keiner dachte mehr an die Haifische, und es tauchten auch keine auf.
Trotz dieses ausgelassenen Tages: Immer häufiger hörte man böse, heftige Worte durch die Luft fliegen, auch Verwünschungen, die Colón unmöglich überhören konnte und die ihm ins Herz schneiden mussten. Escobedo war nur der Lauteste und Unverschämteste. Er schürte gezielt Respektlosigkeiten gegen den Admiral. So trat er zu Juan de La Cosa aufs Achterkastell und wies den nachdenklich gewordenen Seemann auf die glatte Meeresoberfläche hin: „Sagt, Maestre de La Cosa, sieht so ein Meer aus, auf dem es für uns auch wieder eine Rückkehr gibt? Die Winde sind schwach und unbeständig, und wenn sie wehen, dann nur von Osten nach Westen. Seit unserer Ausfahrt haben wir noch keinen einzigen Tag mit West-Ost-Wind gehabt, noch keine Stunde, nicht einmal eine Minute. Ich fürchte fast, hier weht der Wind immer von Osten nach Westen und deshalb wird eine Rückfahrt für uns wohl unmöglich werden. Oder was meint Ihr?“
Juan de La Cosa legte die Stirn in Falten: „Ich habe noch nicht darüber nachgedacht, Señor Escobedo. Aber jetzt, wo Ihr mich darauf aufmerksam macht ...“
„Ich möchte wissen, wie lange wir uns noch den Spinnereien des Genuesen ausliefern sollen“, stichelte Escobedo. „Er ist ein Fremdling, ein Träumer, ein Narr. Denkt daran, er ist kein Spanier. Aber dies sind spanische Schiffe, dies ist eine spanische Expedition und wir sind Diener der spanischen Krone.“
Escobedo ließ einen nachdenklichen Kapitän zurück. Er begab sich aufs Vorschiff, wo er ein ähnliches Gespräch mit Sanchez de Segovia führte, dem sauertöpfischen königlichen Schatzmeister. Ein Wunder, dass dieser sich überhaupt einmal auf Deck blicken ließ. Die meiste Zeit verbrachte er in seiner Kammer im Achterdeck. Diesen bereits ergrauten, hageren Beamten, unscheinbar und stumm wie ein Fisch, hatte man bisher im täglichen Leben an Bord kaum wahrgenommen. Er lebte unter Deck wie eine Kellerassel und mied die Sonne und die frische Luft. Erst in den letzten Tagen zeigte er sich häufiger in Gesellschaft Escobedos. Es hatte den Anschein, dass er sich von diesem umgarnen und beeinflussen ließ.
Das Gerücht vom Wind, der nur von Ost nach West und niemals von West nach Ost weht, erst einmal in Umlauf gebracht, verbreitete sich innerhalb einer Wache über die ganze Santa Maria und war kaum geeignet, die Stimmung zu heben. Die fröhlichen Mienen verschwanden wieder. Im Vorschiff und unter Deck hörten die Unterhaltungen nicht auf. Es schlich sich wieder die Angst vor dem Unbekannten ein. War man vielleicht doch zu weit vorgedrungen, in einen Ozean, der schreckliche Geheimnisse barg und eine Umkehr unmöglich machte?
An den Tagen gab es noch Ablenkung, Gespräche, Unterhaltung, etwas Arbeit. Aber dann kamen die Nächte, eine um die andere, in langer Reihe. Ein dunkles Leichentuch lag über ihnen. Verloren trieben die drei Schiffe in dunkler Ödnis. Niemand tröstete sie auf dieser Totenfahrt, weder die Sterne am Firmament noch die Glühpünktchen von den tanzenden Positionslampen der zwei anderen Schiffe irgendwo voraus; die schwankenden Bordlichter und das Ächzen des geschüttelten Balkenwerks waren die einzigen Begleiter. In solchen Nächten kam der Zweifel und trieb auch den Tapfersten Angst und Schrecken in die Knochen. Würde die Sonne wieder aufgehen?
Aber sie ging jeden Morgen von Neuem auf. Und dann geschah ein kleines Wunder. Als die Klagen über den immergleichen Wind am lautesten wurden, erhob sich am 22. September von Südosten her ein leichter Gegenwind. Gleichzeitig sichteten sie an diesem Tag auch bedeutend weniger Grasflächen als bisher.
Christóbal Colón gab vom Achterdeck aus dem Rudergänger Kurs West-Nord-West vor; einen besseren konnte man wegen der widrigen Brise nicht steuern. Aber niemanden kümmerte diese Umständlichkeit. Es erleichterte alle, dass es solchen Gegenwind überhaupt gab.
Was die Bewegungen der Winde und des Meeres anging, so schien Christóbal Colón mit höheren Mächten im Bunde zu sein. Als am nächsten Tag der Wind erneut nachließ, ging das Murren der Mannschaft von Neuem los. Einige Matrosen klagten, der Wind werde nie stark genug sein, sie nach Spanien zurückzubringen. Die See sei seit der Ausfahrt viel zu ruhig geblieben. Und was geschah? Nur wenige Stunden später kam schwere See auf, und zwar so, wie die Männer sie noch nie erlebt hatten, vollkommen ohne Wind. Das Meer schwoll an und krümmte sich wie ein gewaltiger Rücken zum Buckel auf. Der Anblick des Ozeans, der sich zum Berg, zur Düne, zur Riesenwelle aufbäumte, schlug die Mannschaften in ihren Bann. Keiner hatte Ähnliches je erlebt. Bis zum Rande des Horizonts hob und senkte sich das Meer, ohne eine Spur von Schaum, ohne eine einzige Brandung, sogar ohne das Zeichen jener weißen Löckchen mit den bleiernen Ringen, von denen die See bei Sturm sonst wimmelt. Hier gab es keinen Sturm, keinen Wind. Es gab diese gespenstischen, dichten Wellen, die vorwärts rollten und ihre Erhebungen und Senkungen unverändert nach sich zogen. Wenn sie ankamen, liefen sie träge wie Kamele, wuchsen hoch wie Hügel und wälzten sich mit gemessener, unerbittlicher Langsamkeit von der Spitze ihrer Kämme in den Schoß ihrer Täler. Es waren Ausläufer von Stürmen, die in der Ferne, vielleicht Hunderte von Meilen weiter nördlich, getobt hatten. Aber das wussten die Männer nicht. Die drei Karavellen der Flotte ritten auf diesen Wellen, sie schwebten auf den Erhebungen des Ozeans, um mit seinen Mulden wieder abzusinken. Dieses so aufgeschwollene Meer ohne jeden Wind löste zuerst Bestürzung aus, bald aber nur noch Staunen und Verwunderung. Selbst der Admiral, den bis dahin nichts erschüttert hatte, bemerkte vor der Abendandacht: „Ein derartiges Wunder hat sich nur noch zur Zeit der Juden zugetragen, als sich die Ägypter zur Verfolgung des Moses aufgemacht hatten, der Israel aus der Sklaverei befreite.“
Ein Wunder also! Und wenn schon, dann sogleich eines von biblischen Ausmaßen. In diesem Punkt gebrach es Admiral Christóbal Colón nicht an Selbstbewusstsein.