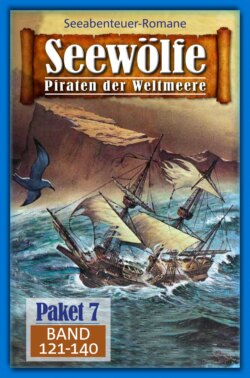Читать книгу Seewölfe Paket 7 - Roy Palmer, Fred McMason - Страница 6
2.
ОглавлениеDans scharfe Augen hatten sich auch diesmal nicht trügen lassen. Er hatte die Gestalten auf dem Achterdeck der Galeone auch ohne ein Spektiv beobachten können, und weder er noch Hasard und die anderen vier hatten sich vom Fleck gerührt, bevor die Männer nicht vom Schanzkleid verschwunden waren.
Jetzt glitt der Seewolf über den schmalen Sandstreifen und erreichte das Flachwasser. Er schlich hinein und duckte sich so tief wie möglich.
Carberry, Ferris Tucker, Smoky, Blacky und Dan folgten seinem Beispiel. Sie alle waren nur mit kurzen Hosen bekleidet, die Messer steckten in den Gurten. Es war die einzige Möglichkeit, zur Galeone hinüberzutauchen, nur auf diesem Weg erreichten sie ungesehen das Schiff. Ein Boot wäre unweigerlich von dem feindlichen Ausguck entdeckt worden, und sei es noch so klein.
Im Dickicht verweilte ein regloser, ernst dreinblickender Sun Lo.
„Ich wünsche euch viel Erfolg“, flüsterte er. „Der Allgeist verleihe euch die Macht, es ohne Blutvergießen zu vollbringen.“
Der Seewolf und seine fünf Männer waren ganz ins Seewasser eingetaucht und begannen zu schwimmen. Ihre Köpfe waren undeutliche, zerlaufende Male in den schwärzlichen Fluten. Wenig später waren sie nicht einmal mehr als Schemen zu erkennen – die Männer waren getaucht und bewegten sich unter Wasser auf die Galeone zu.
Sun Lo drehte sich um und verließ seinen Posten.
Nein, niemals würde er gegen Philip Hasard Killigrews Anweisung handeln. Dazu war er nicht fähig. Der Seewolf hatte ihm auferlegt, zur „Isabella VIII.“ zurückzukehren. Und das tat Sun Lo nun auch.
Nur in einem Punkt verhielt er sich anders, als der Seewolf es von ihm annahm. Er mußte lächeln, als er daran dachte.
„Meine Schüler warten auf mich“, sagte er in seiner weichen, melodiösen Sprache. „Es gibt in dieser Nacht noch eine Menge zu tun für uns.“
Hasard und seine Männer nahmen in diesem Moment ihre Köpfe wieder aus dem Wasser und achteten darauf, sowenig Geräusche wie möglich zu verursachen. Sie schöpften Luft, es gurgelte nur ein bißchen im Wasser, dann waren sie wieder unter der Oberfläche verschwunden.
Als sie zum zweitenmal aufstiegen und ihre Lungen vollpumpten, befanden sie sich unter dem Heck der Galeone. Wuchtig ragte der breite Spiegel über ihnen auf. Die Galerie und der darüber befindliche Teil des Schiffes waren reichlich mit Schnitzwerk verziert. Die Spanier und Portugiesen hatten einen unerschütterlichen Hang dazu, ihre Schiffe so auszustatten.
Im Mondlicht konnte der Seewolf die Schriftzüge am Heck erkennen. „Sao Paolo“ hieß die Galeone. Sie hatte ein mächtiges Steuerruder aus schönstem Pinienholz, das zum Hochklettern einlud.
Hasard grinste. Er wies auf das riesig wirkende Ruderblatt, glitt darauf zu und traf Anstalten, sich daran emporzuziehen.
Carberry hatte unausgesetzt nach oben geschaut und warnte seinen Kapitän in diesem Moment durch einen Wink. Er selbst ließ sich unter Wasser sinken. Dan, Blacky, Smoky und Ferris taten das gleiche. Hasard fand gerade noch die Zeit, sich in dem Winkel in Sicherheit zu bringen, den das Ruderblatt mit dem Heck des Schiffes bildete. Hier verharrte er mit angehaltenem Atem.
Oben – unsichtbar für den Seewolf – war eine Gestalt erschienen, und zwar ganz achtern auf dem erhöhten Teil des Hecks. Es handelte sich um eine der Deckswachen, die der portugiesische Profos auf Goncalves’ Geheiß hin eingeteilt hatte.
Dieser Mann warf einen knappen, prüfenden Blick aufs Wasser hinunter, bemerkte die kleinen Wellenringe jedoch nicht, die die fünf Männer der „Isabella“ hinterlassen hatten. Auch Hasard entdeckte er nicht, denn der befand sich unterhalb der Heckgalerie für ihn im toten Blickfeld.
Folglich zog sich der Wachtposten wieder zurück. Er setzte seinen Rundgang fort, ohne im geringsten beunruhigt zu sein.
Hasard sah die Freunde neben sich auftauchen. Durch eine Gebärde gab er ihnen zu verstehen, sie sollten sich still verhalten. Er legte sich behutsam auf den Rücken und schob sich auf dem Wasser mit dem Kopf zuvorderst am Ruder der Galeone entlang.
Auf diese Weise erlangte er den Ausblick auf die gesamte Heckpartie. Er überzeugte sich, daß die Deckswache ihnen tatsächlich nicht mehr zum Verhängnis werden konnte, und verharrte fast eine Minute lang in seiner Lage.
Dann klomm er endlich am Ruder empor. Ohne jegliche Hilfsmittel wie Enterhaken oder Taue erreichte er die Hennegatsöffnung, stellte die Füße hinein und stemmte sich hoch. Er streckte die Hände nach oben und konnte die Verzierungen der Heckgalerie berühren.
Ferris enterte hinter ihm das Steuerruder der „Sao Paolo“. Hasard wartete sein Erscheinen noch ab, dann bückte er sich ein wenig, stieß sich schwungvoll ab und klammerte sich an der Galerie fest.
Es gelang ihm, sich hochzuhieven und über die Balustrade zu klettern. Leise wie eine Raubkatze setzte er auf und blickte wie gebannt auf die Bleiglasfenster des Achterschiffes. Dahinter glomm der rötliche, dämmrige Schein von Öllampen. Der Seewolf registrierte die Bewegung von Gestalten.
Hasard kauerte wie festgenagelt da.
Bei dem Raum konnte es sich nur um die Kapitänskammer handeln. Demzufolge waren die Männer, die sich gerade darin aufhielten, entweder der portugiesische Capitán mit ein oder zwei Besatzungsmitgliedern oder ein paar Offiziere.
Wenn sie jetzt auf die Galerie hinaustraten, sah es für den Seewolf und seine Begleiter übel aus.
Waren die Portugiesen schnell, dann konnten sie Hasard mit Leichtigkeit überwältigen und die fünf anderen vom Ruder wegschießen. Ferris, Blacky, Smoky, Ed und Dan befanden sich im Moment auf dem Präsentierteller.
Hasard wagte kaum zu atmen.
Ferris’ Rotschopf erschien hinter der Handleiste der Balustrade, es folgten Kopf, Oberkörper, Bauchpartie – und die Beine. Ferris sank neben Hasard auf alle viere und verhielt sich genauso mucksmäuschenstill.
Wenig später waren auch der Profos und die drei anderen eingetroffen. Hasard pirschte sich an das eine Bleiglasfenster des Hecks heran, schob sich langsam hoch und schaute in die Kapitänskammer. Ihm war jetzt, da er die Männer hinter sich wußte, bedeutend wohler zumute.
Etwas verschwommen erkannte er die Gestalten der Portugiesen im Schein der Öllampe. Der Vorteil war, daß er im Dunkeln stand, sie ihn also nicht sehen konnten. Er hingegen verfolgte ziemlich genau, was sie taten, und konnte sie jetzt auch sprechen hören.
Sie hatten sich über Land- oder Seekarten gebeugt, die sie auf dem Pult des Capitáns ausgebreitet hatten.
„… wäre es das beste, bis zur Flußmündung zu segeln und dort zu beginnen“, sagte der eine gerade.
„Si, Senhor“, antwortete sein Gegenüber, ein augenscheinlich junger und schlanker, beinah schlaksiger Mann. „Hoch am Wind liegend können wir uns vielleicht sogar ein Stück den Fluß aufwärts arbeiten.“
„Falls die Wassertiefe es zuläßt“, wandte der dritte ein.
„Immer Bedenken, was, Bootsmann?“ sagte der Schlanke zu dem Mann.
„Die kriegt man im Laufe der Jahre.“
„Es bleibt dabei“, sagte nun der erste Sprecher – der Kapitän der „Sao Paolo“. „Gleich im Morgengrauen laufen wir die Flußmündung an. Sie wird unser Ausgangspunkt und unsere Orientierungshilfe sein. Ich denke, von dort aus können wir ausgezeichnet operieren.“
Übergangslos wandte er sich vom Pult ab und schritt auf die Tür zu, die auf die Heckgalerie führte.
Hasard zog sich sofort von dem Fenster zurück. Er hatte genug gehört. Seine Befürchtungen waren keineswegs übertrieben gewesen. Die Portugiesen waren drauf und dran, eine Falle zuschnappen zu lassen, aus der es kein Entweichen mehr gab. Nur die Dunkelheit hatte ihre Aktion unterbrochen. Die Nacht war der traute Verbündete der Seewölfe.
Hasard hockte sich so hinter die Tür, daß sie zu ihm hin aufschwingen und ihn verdecken mußte. Er sah zu seinen Männern. Eine Absprache war nicht nötig, nicht einmal ein Winken oder Zeichengeben. Ihr gemeinsames Handeln war in vielen Einsätzen erprobt, jede Bewegung, jede Positionsnahme gleichsam zur Routine eingeschliffen, wenngleich jedes Unternehmen seine ureigenen Abläufe hatte und von ihnen verlangte, daß sie sich blitzschnell darauf einzustellen wußten.
Eben das war es. Sie waren schnell. Ungemein schnell.
Dan und Blacky nahmen die jweils äußerste Ecke der Galerie an Back- und Steuerbord ein. Carberry, Smoky und Ferris Tucker kauerten sprungbereit vor der Balustrade und schienen in diesen Sekunden in sich zusammenzukriechen, um so gut wie möglich mit der Finsternis zu verwachsen.
„Genießen wir einen Moment die frische Luft“, sagte der Capitán. „Bootsmann, bring die Karaffe mit, wir wollen auf eine erfolgreiche Sache anstoßen. Ein Glas Rotwein, das ist jetzt genau das richtige.“
Ja, dachte der Seewolf, ich finde auch, das ist ein großartiger Einfall.
Die Tür öffnete sich. Sie prallte fast gegen ihn. Kaltblütig und voll Berechnung hockte er da. Als die Gestalt des portugiesischen Kapitäns die Deckung der Tür verließ und neben ihm erschien, schoß Hasard hoch.
Ungefähr zur selben Zeit schritt Lucio do Velho auf einem kleinen, unbedeutenden Eiland rund hundert Meilen nördlich von Formosa auf einem Plateau vor seinen Untergebenen auf und ab. Er hatte die Hände hinter dem Rücken ineinandergelegt und gab sich den Anschein eines Mannes, der in tiefschürfende Erwägungen verstrickt war. Dies war eine seiner beliebtesten Posen, wie die Mimik überhaupt sein ein und alles war.
Drei Männer waren sein Publikum.
Drei – dabei hatte seine Mannschaft aus fast vier Dutzend erfahrenen Seeleuten und Soldaten bestanden.
Die Insel war felsig und unwirtlich. Ihre Entdecker hatten ihr seinerzeit nicht einmal einen Namen gegeben, und auch do Velho hielt es für absolut unwichtig, sie jetzt nachträglich zu taufen.
Auf dem Eiland gab es keine Eingeborenen, keine Tiere und kaum Pflanzen. Ein Fleckchen Erde, vielleicht zwölf, dreizehn Quadratmeilen groß, schroff, karstig, ohne natürliche Attraktionen. Das Plateau stellte den höchsten Punkt dar, es lag vielleicht vierzig Fuß über dem Meeresspiegel, möglicherweise auch ein bißchen mehr.
In der Nähe gab es ein kleines Wasserloch, die einzige Quelle der Insel. Das Trinkwasser war genießbar. Während der letzten, unendlich erscheinenden Stunden hatten die vier Männer sich wiederholt vor das Loch gelegt und das Naß in sich hineingeschlürft.
Dieses Wasser – es war zum Leben zuwenig und zum Sterben zuviel.
Do Velho bemühte sich trotzdem, seiner Miene einen Anstrich der Zuversicht zu geben. Er blieb stehen, wandte sich abrupt den drei Männern zu und sagte: „Und ich erkläre euch, wir schaffen es trotzdem. Wir halten durch. Wir sind zäh und lassen uns nicht unterkriegen.“
Carlos, ein untersetzter Mann mit großflächigem Gesicht, schaute auf. „Wir haben keinen Proviant, Capitán, vergeßt das nicht. Es gibt nichts zu essen auf der Insel, nicht einmal Wurzeln, die man ausgraben kann.“
„Und wenn es jagdbares Wild gäbe, könnten wir es nicht erlegen“, warf Ignazio ein. Seine Stirn war gefurcht, seine Augenbrauen fast drohend zusammengezogen. Er stammte aus Porto, ein muskulöser Mann, groß, breitschultrig, mit einem einfältigen Gemüt. „Wir haben eine Pistole“, fuhr er fort. „Und die ist nicht mehr brauchbar, obwohl wir das Pulver getrocknet haben, nachdem wir an Land geschwommen sind. Das Seewasser hat das Schloß ruiniert.“
„Egal“, erwiderte do Velho wegwerfend. „Wir sind darauf nicht angewiesen. Wißt ihr, wie lange ein Mensch durchhalten kann, wenn er genügend Trinkwasser hat? Bis zu zwei Wochen.“
Der vierte Mann meldete sich nun zu Wort. Sein hageres Gesicht drückte offene Wut aus. Bislang hatte er sich mühsam bezähmt, aber jetzt konnte er nicht mehr an sich halten. Sein Name war Vicente, er war einer der Stückmeister an Bord des nun zerstörten, versenkten Schiffes gewesen.
„Capitán“, stieß er hervor. „Eine Woche, habt Ihr doch wohl sagen wollen. Aber welche Bedeutung hat das für uns? Schon morgen können wir uns vor Schwäche nicht mehr auf den Beinen halten. Übermorgen kriechen wir wie todwunde Tiere auf allen vieren. Am fünften Tag schleppen wir uns mit letzter Kraft ans Wasserloch, am sechsten und siebten dämmern wir dem Tod entgegen, am achten werden wir vielleicht endlich von diesem – diesem grausamen Schicksal erlöst.“
Er sprang auf. „Wir können nicht einmal das Pulver zünden und Feuer entfachen! Nur dasitzen können wir, abwarten, bis der Tod sich zu uns auf die Insel schleicht, sich neben uns hockt und auf den ersten lauert, den er entführen kann. Oder? Oder was gedenkt Ihr zu tun, Capitán?“
Do Velho lächelte ihn an. „Du hast eine blumige Art, dich auszudrücken, Vicente. Eine Schule hättest du besuchen sollen. Vielleicht wärest du fürs Theater besser geeignet gewesen als für die Seefahrt. Vielleicht hättest du auch einen guten Priester abgegeben. Ja, das wäre möglich.“
Diese Worte warfen den hageren Mann endgültig aus der Fassung. Zornbebend stand er da. „Hier gibt es noch jemanden, der seine Aufgabe verfehlt hat. So verrückt daherzureden, das kann doch nicht dein Ernst sein, do Velho. Oder doch – es ist dein Ernst. Du hast uns von Anfang an verschaukelt, es ist deine Schuld, daß unsere Kameraden über die Klinge gesprungen sind. Du bist …“
„Hör auf“, versuchte Carlos ihm das Wort abzuschneiden. „Das hat doch auch keinen Zweck.“
„… ein Versager!“ schrie Vicente. „Jawohl, ein Versager!“
Lucio do Velho stand mit leicht abgewinkelten Beinen und stemmte jetzt beide Fäuste in die Hüften. „Wer hat dir die Erlaubnis gegeben, mich zu duzen?“ sagte er nicht besonders laut. „Da muß ein Mißverständnis vorliegen. Vicente, ich fordere dich auf …“
„Ja!“ brüllte der hagere Mann. „Ein Mißverständnis! Und was für eins! Studiert hat er, unser Senhor Capitán, und ein gebildeter Mann ist er. Kluge, raffinierte Leute müssen her, um die Kolonien unseres Weltreichs zu schützen und Kerle wie den Seewolf zu hetzen. Die alte Garde von dummen Hunden reicht da nicht mehr aus. Aber er ist auf den Arsch gefallen, unser schlauer, studierter Capitán, und jetzt steht er da und weiß nicht weiter.“
Do Velhos Gesicht war eine bleiche Maske unter dem Mondlicht geworden. „Schluß jetzt. Das geht zu weit. Nimm zurück, was du eben gesagt hast, Bastard. Es ist deine einzige Chance.“ Seine Stimme klang völlig verändert.
„Vicente!“ rief Ignazio. „Tu, was der Capitán sagt.“ Er war ebenfalls aufgestanden und trat auf den Kameraden zu.
Vicente zückte seinen Säbel und sprang ein Stück auf dem Plateau zurück. „Bleib mir vom Leib! Ich steche dich nieder, wenn du mir zu nahe kommst!“
„Du bist ja wahnsinnig!“ schrie Carlos. Etwas wankend erhob er sich.
Vicente richtete den Säbel auf Lucio do Velho. „Capitán, auch ich gewähre dir eine letzte Chance. Ich wiederhole meine Frage. Was gedenkst du zu unserer Rettung zu tun?“
Do Velho verengte die Augen zu Schlitzen. Kalt taxierte er den Abstand zwischen sich und dem Aufgebrachten und seine Möglichkeiten. So gesehen, konnte Vicente jeden Augenblick vorstürmen, an Carlos und Ignazio vorbei, und ihm, do Velho, den Säbel in die Brust stechen, ehe er überhaupt die Hand am Degengriff hatte.
„Ich werde es dir sagen“, erklärte do Velho deshalb.
„Na los!“ rief Vicente. „Aber ich will keine Durchhalteparolen oder nichtssagende Phrasen hören.“
Do Velho wies mit der Linken zur Bucht im Südwesten. „Unsere Galeone liegt auf dem Grund der Bucht, aber die Maststangen ragen aus dem Wasser, das heißt, die Wassertiefe ist nicht allzu groß. Einer von uns oder zwei könnten hinabtauchen und in den Schiffsräumen nach Proviant forschen.“
Vicente lachte höhnisch. „Sehr gut. Hast du vergessen, daß wir das schon getan haben? Ein guter Taucher kommt mit seinem Luftvorrat an die Kombüse oder an die Speisekammer heran, aber wenn er drin ist – spätestens dann – säuft er jämmerlich ab. Außerdem sind die Schotten dicht. Bei dem Wasserdruck sind sie nicht zu öffnen. Ich bin dreimal hinuntergetaucht, du elender Hurensohn, aber ich habe aufgeben müssen.“
„Ich, äh, war nicht dabei“, erwiderte do Velho. „Ich habe zu der Zeit die Insel erkundet.“
„Ja. Gedrückt hast du dich.“
Do Velho ließ die Arme baumeln. „Du wirst bereuen, was du gesagt hast. Ungestraft beschimpft und bedroht man keinen Kapitän oder Offizier.“
„Weitere Vorschläge!“ fuhr Vicente ihn an.
Der Mann aus Porto wollte sich an Vicente heranschleichen, aber Carlos hielt ihn zurück. Ignazio war ein diensteifriger Typ und der sturen Borddisziplin bedingungslos unterworfen. Für ihn zählte nur, was der Capitán sagte und tat. Er dachte nicht daran, daß Vicente der eindeutig Überlegene war und er Lucio do Velho innerhalb der nächsten Sekunden wahrscheinlich abservieren würde. Es lohnte sich also nicht, sich mit Vicente anzulegen.
Do Velho entging es nicht, wie Carlos den Mann aus Porto bremste. Do Velho schaute zu Carlos, aber der wich seinem Blick aus.
„Hör zu“, erklärte der Capitán jetzt. „Ich bin bereit, ein neues Experiment zu beginnen. Allein. Ich tauche. Wenn ich uns nichts Eßbares besorgen kann, werde ich zumindest eins der Beiboote aus den Zurrings lösen und an die Oberfläche befördern. Ich tue es noch heute nacht, wenn du willst, Vicente.“
Vicente grinste höhnisch. „Was für hervorragende Vorschläge! Aber völlig unbrauchbar. Ich habe auch das probiert, die Boote haben sich jedoch verkeilt und sind teils beschädigt, teils unter Kanonentrümmern begraben.“
„Wenigstens eins muß zu verwenden sein“, beharrte do Velho auf seiner Meinung. „Wir müßten nur alle vier tauchen.“
„Das könnte dir so passen.“
„Es ist ein ehrliches Angebot, Vicente.“
„Nein!“ brüllte der erregte Mann. „Du willst uns nur erledigen, unter Wasser! Sonst hättest du doch längst versucht, an ein Boot heranzukommen! Aber du weißt, das es sinnlos ist!“
Do Velho sprach eindringlich, fast bittend. „Überlege doch. Wir haben auf eins unserer Schiffe gewartet. Ich habe es gar nicht für nötig befunden, viel zu unternehmen. Früher oder später muß jemand erscheinen, der uns hier wegholt.“
„Ach? Unser Verband etwa?“
„Ja …“
„Der Verband ist vom Seewolf zum Teufel gejagt worden“, sagte Vicente wild. „Vorletzte Nacht. Oder hast du auch das Donnern der Kanonen schon wieder vergessen?“
„Keineswegs. Nur ist auch ein Killigrew nicht in der Lage, sich vier Schiffe vom Hals zu schaffen. Und vier sind es gewesen, die von Formosa herübergesegelt sind, wie wir es schon vorher vereinbart hatten: die ‚Bartolomeu Diaz‘, die ‚Vasco da Gama‘, die ‚Sao Paolo‘ und die ‚Bahia Blanca‘. Im Morgengrauen haben sie die ‚Isabella‘ gestellt und vernichtet.“
„So? Warum sind sie dann anschließend nicht herübergesegelt, um uns aufzulesen?“
Do Velho antwortete: „Der Comandante da Odemira weiß nicht, wo wir stecken. Er hat die abfackelnden Masten der ‚Sao Fernao‘ nicht mehr sehen können. Das ist unser Pech. Jetzt müssen wir das Ende der langwierigen Suche abwarten. Aber wir können nicht nur mit dem Hauptverband rechnen, sondern auch mit der ‚Santa Luzia‘, unserem sechsten Schiff, das vor vier Tagen nach Nordosten abgelaufen ist, um die Nansei-Shoto-Inseln auf Feindbewegungen hin zu untersuchen.“
„Wir können also ganz sorglos sein?“ fragte Vicente lauernd.
„Ja, unbedingt.“
„Du bist ein Lügner“, zischte der Stückmeister. „Ich hab’s immer gewußt. Wir müssen hier verrecken, aber ich will dich zuerst sterben sehen, bevor es uns erwischt. Ich töte dich, du Hurensohn.“
Er wollte einen Ausfall zu do Velho hin unternehmen, doch dieser griff sich plötzlich an die Brust und sank zusammen.
„Dios“, stöhnte er immer wieder. „Mein Gott, was ist nur – Himmel, warum helft ihr mir nicht?“
„Das Herz“, murmelte Ignazio.
„Nein!“ stieß Carlos hervor. „Er ist ein großartiger Simulant, aber uns legt er nicht mehr herein. Ich übernehme die Sache.“ Bevor Vicente eingreifen konnte, hatte er sein Messer gezückt und stürzte sich auf den Kapitän.
Do Velho war auf die linke Körperseite gesackt und krümmte sich. Carlos hatte ihn erreicht – da zuckte er wie eine große, kräftige Schlange, schwang wieder hoch und knallte dem Mann beide Fäuste gegen den Kopf.
Carlos verlor sein Messer. Vicente stieß einen wilden Schrei aus und rückte mit erhobenem Säbel vor, aber Lucio do Velho, der Gerissene, versetzte Carlos einen Stoß und beförderte ihn auf den Stückmeister der „Sao Fernao“ zu.
Carlos prallte gegen Vicente. Vicente wimmelte den untersetzten Mann ab und trat an ihm vorbei. Diese kurze Verzögerung hatte do Velho gereicht. Er hatte seinen Degen gezückt und stellte sich dem Untergebenen, der sein Todfeind geworden war.
Carlos hatte Mühe, sich vom Plateau aufzurappeln.
Ignazio, der Mann aus Porto, stand wie vom Donner gerührt und schien nicht zu begreifen.
Vicente drosch mit dem Säbel auf den Kapitän ein. Er wollte ihm den Schädel spalten, eine blutige Kerbe in die Schulter hauen, die Klinge im Herzen des Widersachers versenken, aber nichts davon klappte. Geschickt wehrte do Velho jede Attacke ab. Er baute eine Verteidigung auf, studierte Vicentes Kampftaktik, fand seine Fehler heraus – und duckte sich in einem Augenblick, den er für den geeigneten hielt.
Vicente dachte, der Kapitän wolle einem Streich ausweichen.
Er hatte sich getäuscht.
Do Velho stand flach über den Boden gekauert, sein Kopf, Arm, Oberkörper waren eine Einheit, die plötzlich nach vorn schoß. Die Degenklinge traf Vicente. Vicente zog den Säbel erfolglos über do Velhos Kopf hinweg. Er hatte sich zu spät auf die neue Situation und auf das Verhalten des Gegners eingestellt.
Vicente spürte ein Stechen im Unterleib, als Lucio do Velho seine Waffe bereits wieder an sich gerissen hatte. Wallende Nebel senkten sich über den Stückmeister Vicente. Er verlor die Kontrolle über sich, die Schmerzen packten ihn, rüttelten an seinem Leib und zwangen ihn zu Boden.
Carlos stand und wollte sich erneut auf den Kapitän stürzen, aber in diesem Moment handelte Ignazio. Plötzlich hatte Carlos ein Messer zwischen den Schulterblättern stekken. Er röchelte, taumelte und schaute ungläubig drein. Zwei, drei stolpernde Schritte tat er noch auf Lucio do Velho zu, dann fiel auch er.
Auf dem Bauch blieb er liegen. Sein Gesicht war nach unten gewandt.
Vicente lag gekrümmt und hatte seinen Säbel aus der Hand verloren. Das Leben war ein Atemhauch, der aus seinem Körper entfloh und vom Wind davongetragen wurde.
Ignazio stand mit baumelnden Armen und starrte seinen Kapitän an.
„Ausgezeichnet“, sagte do Velho kühl. „Ich werde dafür sorgen, daß du eine Belobigung erhältst, mein Freund. Du hast dich vorbildlich verhalten.“
Er sah an dem Mann aus Porto vorbei und schien etwas entdeckt zu haben. Plötzlich steckte er den Degen weg und lief über das Plateau.
„Da!“ rief er. „Ich hab’s ja gesagt! Da kommt ein Schiff!“
Ignazio wandte den Kopf. Im ersten Augenblick hielt er das, was do Velho von sich gegeben hatte, für ein Hirngespinst. Dann entdeckte auch er das Licht in der Ferne.
„Aus Nordosten nähert sich das Schiff“, murmelte Ignazio. „Wenn das die ‚Santa Luzia‘ ist und die Mannschaft unser Rufen hört, sind wir wirklich gerettet.“
Lucio do Velho lief bis zum Nordufer der Insel, verharrte auf dem Kap und blickte dem Segler entgegen. Er hielt auf das Eiland zu. Do Velho gestand vor sich selbst, daß er mit einem solchen Ereignis auch nicht mehr gerechnet hatte.