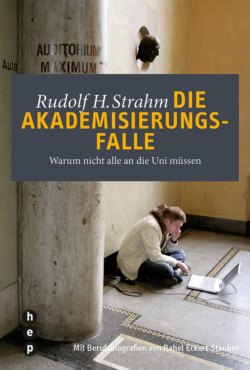Читать книгу Die Akademisierungsfalle - Rudolf H. Strahm - Страница 12
Berufslehre hat historische Wurzeln im deutschsprachigen Raum
ОглавлениеDie duale Berufslehre in den deutschsprachigen Ländern und ihrer Umgebung hat wirtschaftshistorische Wurzeln. Bereits die Zünfte im 16. bis ins 19. Jahrhundert kannten die «Meisterlehre». Der junge Mann ging zu einem Meister in die Lehre, lebte beim Meister und sass bei der Meisterin zu Tisch. Er erhielt einen «Lehrbrief» und nach drei oder vier Lehrjahren ging er auf Wanderschaft als Geselle. Nach manchen Zunftregeln durfte er während Jahren nicht in seine Heimatstadt zurückkehren. Frühestens nach fünf Wanderjahren als Geselle konnte er mit den erworbenen «Gesellenbriefen» (Arbeitsbestätigungen) dann Meister werden, ein eigenes Geschäft eröffnen, in die Zunft eintreten und heiraten. Die ganze gewerblich-industrielle Berufsbildungstradition war fast ausschliesslich auf Männer ausgerichtet.
Im deutschsprachigen Europa waren die Wandergesellen auch – modern ausgedrückt – wichtige Transporteure und «Diffusionsagenten» der neusten Technologien und Prozesstechniken innerhalb des Kontinents. Verbürgt ist solches etwa für die Steinmetzen, Uhrmacher, Buchdrucker, Schmiede, Waffenmacher, Lederveredler, aber auch für Handelsagenten und Einkaufsreisende. Wandergesellen waren übrigens auch wichtige Agenten aufklärerischer und reformatorischer Ideen.
Aus dieser zünftischen Berufsbildungskultur hat sich in den deutschsprachigen Ländern im 19. Jahrhundert (etwa ab den 1860/70er-Jahren) ein gewerbliches Berufsbildungswesen herausgebildet. Erst im 20. Jahrhundert ist es gesetzlich verankert worden: In Deutschland in der Weimarer Republik und dann wieder ab 19488, in der Schweiz mit dem ersten eidgenössischen Berufsbildungsgesetz von 19339. Vorher gab es allerdings in der Deutschschweiz schon kantonale Gewerbegesetze, die die Berufslehre regelten und schützten.
In Deutschland hat sich die traditionelle Berufslehrekultur bis heute in der deutschen Handwerksordnung erhalten. In 41 geschützten gewerblichen «Meisterberufen», die rund 95 Prozent der gewerblichen Ausbildungsverhältnisse abdecken, hat sich der «Meisterbrief» erhalten, der zur Betriebsgründung und – so die Rechtfertigung – zur Qualitätssicherung in der Berufsbildungstätigkeit verlangt wird. Es wird derzeit eine Diskussion geführt, ob sich das hohe deutsche Berufsbildungsniveau nach der Revision der EU-weiten Anerkennung von Berufsqualifikationen im Zeichen der Personenfreizügigkeit noch aufrechterhalten lässt.10
Diese kurze geschichtliche Betrachtung ist wichtig, um zu verstehen, dass die duale Berufsbildung einen gesellschaftlichen Träger braucht. Sie muss in der Wirtschaftswelt verankert sein. Die Lehrbetriebe und Berufsverbände müssen sich engagieren und sich auch aus Eigeninteresse als mitverantwortlich betrachten.
Die Stärke des schweizerischen Berufsbildungsgesetzes liegt darin, dass es landesweit die Lehrgänge einheitlich für jeden Beruf definiert und die formalen Berufsabschlüsse «Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis EFZ» (mit drei oder vier Lehrjahren) und «Eidgenössisches Berufsattest EBA» (mit zwei Lehrjahren) schützt. Jeder KMU-Inhaber oder Personalverantwortliche in den Firmen im ganzen Land weiss, was die rund 230 EFZ-Berufstitel und die rund 50 EBA-Abschlüsse wert sind, was man von den Berufsleuten an Wissen und Kompetenzen erwarten kann11.
Ganz besondere Bedeutung hat die Beteiligung der Wirtschaftsverbände (der sog. Organisationen der Arbeitswelt OdA) an der Definition der Ausbildungsanforderungen. Die Curricula und Lernkompetenzen werden für jeden der 230 Berufe vom Bund unter Mitwirkung der OdA definiert und – was bezüglich des technologischen Wandels wichtig ist – alle fünf Jahre überprüft und an die neuen technologischen Anforderungen angepasst. Dieses System gewährt eine hohe Arbeitsmarktfähigkeit (sog. Employability) der Berufe nach dem Lehrabschluss. Insgesamt führt dieses arbeitsmarktnahe System zur sprichwörtlich tiefen Jugendarbeitslosigkeit und zu tiefen Erwerbslosenquoten für Erwachsene generell. (In Kapitel 3 stellen wir mehr Einzelheiten des Berufsbildungssystems vor und beschreiben die Übergänge von Bildungsstufe zu Bildungsstufe.)