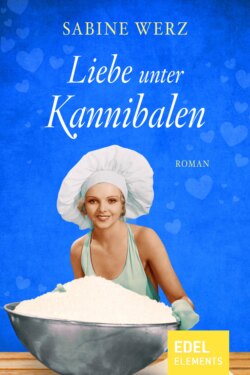Читать книгу Liebe unter Kannibalen - Sabine Werz - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.
ОглавлениеCantucci sitzt im ehemaligen »Fässchen« gegenüber von der Zuckerfabrik. Das »Fässchen« heißt inzwischen »Sugar Cane« und sieht aus wie ein zu groß geratenes Aquarium. Man sitzt hinter blau getönten Scheiben, eine grüne Neonpalme hängt über einer Holztheke, die mit zerspelztem Zuckerrohr verkleidet ist. Darüber rühren Flügelventilatoren die ohnehin klimatisierte Luft. Sehr cool, sehr trendy und kurz vor klinisch, findet Cantucci.
Dafür darf man nachmittags – zur Happy Hour – die Schalen der Erdnüsse, die aus Sektkübeln auf die Tische geschüttet werden, auf den Boden werfen. So viel Dreck muss sein, man lebt schließlich nicht mehr in den voll verchromten Achtzigern.
Genau das Richtige für die Büroboheme aus hektischen Werbern und nervösen Brokern, die sich im rechten Trakt der alten Zuckerfabrik langsam breit machen.
Die kommen ab neun, trinken klebrige Cocktails zur Cohiba und erzählen vom letzten Kubatrip. Kuba ist zurzeit schwer in Mode, und jeder, der da war, bemüht sich zu versichern, dass er das echte, authentische Kuba entdeckt hat – als gäbe es ein falsches. Das für Idioten.
Morgens, auf dem Weg ins Büro, süßt man sich im »Sugar Cane« den Café macchiato mit grobem Zucker, der bei Feuchtigkeit schnell Klümpchen bildet und von erdigem Braun ist. Das täuscht Natürlichkeit vor, ist aber oft nur ein Zeichen für Verunreinigungen oder einen Melassezusatz, so viel weiß Cantucci noch über die Tücken der Raffination. Schließlich ist er neben einer Zuckerfabrik groß geworden. Seine Familie war stolz darauf, sich nur den weißesten Feinzucker zu gönnen. Proletenehre.
Im Hintergrund läuft die Musik aus »Buena Vista social club« und spendet ein bisschen Wärme. Passt gar nicht hierher.
Die Bedienung, zwei biegsame Blondinen, eifern mit der Kühlleistung der Klimaanlage um die Wette. Erfolgreich. Cantucci wirft ihnen bereits den dritten auffordernden Blick zu. Eine Blondine bequemt sich, ihn aus dem Augenwinkel als Gast zu registrieren. Sie schlendert zu seinem Tisch, den Kopf immer noch der Kollegin zugewandt, mit der sie ein ausführliches Gespräch über »so einen notgeilen Naschkeks« führt.
»Musste dir mal vorstellen, singt mir um Mitternacht noch auf Knien Cole Porter vor, um mich ins Bett zu kriegen, und am Morgen isser einfach weg. Nicht mal ‘n Zettel. Sagste dazu? Dabei ist dieser Pavianarsch angeblich Werbetexter. Nur nich in eigener Sache.«
Sie wendet sich mit strafendem Blick Cantucci zu. »Bitte, was ...«, sie zögert kurz, ihre Pupillen werden weit, ihre Stimme bekommt einen gurrenden Klang: »Was kann ich Ihnen bringen? Die Frühstückskarte? Wir servieren Frühstück bis ein Uhr. American Breakfast, Cuban Eggs, Empanadas oder vielleicht Castros Spezial? Das ist eine Havanna und ein Espresso.« Sie hat den Ärger aus ihrem Gesicht gewischt und gegen ein hinreißendes Lächeln ausgetauscht. Völlig falsch.
Cantucci kennt das. Es liegt an seinen Augen, das haben ihm genug Frauen gesagt, dass sie seine sehr blauen Augen zu seinen dunklen Haaren unwiderstehlich finden. Cantucci langweilt das, genau wie das Lächeln der Bedienung, das ihr Zahnfleisch entblößt.
»Einen Kaffee.«
Der Kellnerin ist das zu wenig. »Café macchiato, Espresso, Café au lait, Caribic Coffee, das ist mit einem Schuss weißen Rum ...«
»Einfach Kaffee.«
»Kommt sofort. Bin gleich wieder da.« Sie strebt im Schlängelgang zur Theke zurück, führt ihre Biegsamkeit vor. Cantucci schaut nicht hin.
Das alte »Fässchen« war ihm lieber. Hatte einen unverwechselbaren Geruch. Die Männer würzten ihren kerligen Schweiß mit Pitralon, und die wenigen Frauen, die sich hertrauten, rochen nach Rexona und Polyesterblusen. Proletenduft eben. Über plarrende Lautsprecherboxen, Marke Universum, versicherte Udo Jürgens: »Griechischer Wein ist wie das Blut der Erde.« Bei »Komm schenk mir ein« grölten die Kerle mit, die Frauen bekamen ihr viertes Glas Pampasgras mit Grapefruitgeschmack, und ihre Augen wurden feucht, weil die Kerle im Grunde genommen doch Herz hatten.
In dieser Kneipe hat er alles gelernt, was man in Kneipen können muss, Groß-das-Maul-aufreißen, Fußballwetten, Autogespräche, Streiten, Knobeln, Trinken, Frauen anbaggern. Hier ist er erwachsen geworden. Bisschen zu früh für seinen Geschmack. Aber das wird man eben, wenn der Vater ein begnadeter Thekenheld ist.
Am Tresen war Cantucci senior zu Hause, ist er nie drüber hinausgekommen. Anders als sein Sohn. Hatte auch sein Gutes, die Welt von ganz unten her kennen zu lernen, findet der. Er wusste immer, wo’s langgeht – nach oben.
Die Bedienung vom »Sugar Cane« pflügt durchs Lokal und balanciert dabei ein Bambustablett mit Kaffeegedeck. Umständlich serviert sie und grinst, als habe sie dafür schnell noch einen Aufbaukurs absolviert.
»Wir haben auch anderen Zucker, wenn Sie möchten?«
»Danke«, entgegnet Cantucci. Gelangweilt wendet er sich seinem Kaffee zu. Die Blondine streicht widerwillig die Segel.
Solche Frauen machen es ihm und sich zu einfach, denkt Cantucci. Eine Zeit lang hat ihn das regelrecht angeekelt, und er hat Blondinen, wie diese Bedienung, im Stillen nur noch »Hühnerpopos« genannt. Jetzt sind sie ihm einfach egal, davon hat er in seinen wilden Zwanzigern genug gehabt. Genau wie von seiner Rolle als echter Kerl.
Gott sei Dank hat er früh andere Dinge dazugelernt.
Er freut sich darauf, nach so vielen Jahren wieder in der Stadt zu sein. Ein interessanter Job liegt vor ihm, und alte Bekannte kann er auch treffen. Gerade wartet er auf Anton Kellmanns. Und natürlich, Cantucci schaut auf die Uhr, lässt ihn Anton Kellmanns warten.
Nicht dass ihm an Kellmanns besonders viel liegt, aber der Architekt will wissen, was Cantucci hier macht. War ganz aufgeregt am Telefon, als Cantucci kurz die Zuckerfabrik erwähnt hat. Scheint Kellmanns Lebensthema zu sein, ist immer noch damit zugange, wenn auch nicht mehr im Bürgerzentrum »Zuckerhut«, sonst müsste er wissen, was Cantucci vorhat.
Cantucci ist Historiker. Keiner von den staubtrockenen Aktenhockern und verhärmten Quellenfreaks. Er verdient gutes Geld mit komplizierten, historischen Recherchen für Firmen und Anwälte. Hat gerade eine knifflige Sache hinter sich.
Eine Vereinigung jüdischer Emigranten in den USA hatte ihn beauftragt, nach alten Patenten und Lebensversicherungsurkunden zu forschen, die angeblich im Zuge der Kriegs- und Nachkriegswirren verschollen waren. Nicht ganz so verschollen. Cantucci hat sich durch Archive zwischen Washington und Wladiwostok navigiert. Er hat gebohrt, gebettelt, geschmeichelt, getrickst und bestochen. Sein größtes Talent – Hartnäckigkeit – hat sich ausgezahlt.
Jetzt steht ihm der Sinn nach einer leichteren Aufgabe wie dem Job in der ehemaligen Zuckerfabrik. Einer Aufgabe, die nebenbei mit seiner eigenen Vergangenheit zu tun haben wird.
Immer ältere Bilder tauchen auf. Kinderszenen. Der Fabrikhof, Glasauge Kaschubek, die fauchenden Kalköfen, sein blau bemaltes altes Postfahrrad, die Kanufahrten auf dem Fluss, die Ölgangsinsel, Robinson-Spiele. Sommerbilder, alles Sommerbilder. So war es nicht. Nicht nur.
Cantucci fährt mit der Hand in die Innentasche seiner Jacke. Seine Finger berühren knisterndes Papier. Er zieht einen oft gelesenen, lilafarbenen Brief hervor. Früher hat der mal nach Patschuli gerochen, aber sogar der Geruch von Patschuli verfliegt nach so langer Zeit. Der Brief ist fünffach geknifft, und ein ziemlich kindischer Totenkopf ist darauf gemalt, als handelte es sich um eine Geheimbotschaft. Typisch Alexandra. Immer melodramatisch und ein bisschen makaber.
Dabei war sie fast zwanzig, als sie das hier geschrieben hat. Cantucci schüttelt den Kopf, entfaltet den Brief und lächelt traurig. Der Brief beginnt mit ihrem Lieblingsgedicht:
Die Sterne rosten
Langsam oxidiert sie der Frost
Es regnet dort und überall
Der Wind wirft mit zerbrochenen Vögeln um sich
Und schreit —
Erkaltet wie ein Krater auf dem Mond
Ist mein Herz
Ich friere langsam in das All hinüber
Das stammt von Yvan Goll, wenn er sich nicht täuscht. Alexandra war ganz versessen auf surrealistischen Todeskitsch. Eine Mode damals, genau wie Dalís zerfließende Uhren oder seine Schubladen-Giraffen, die bald in jeder Pommesbude über dem Flipper hingen. Leider war das alles für Alexandra mehr als eine Mode. Als er den Brief zum ersten Mal gelesen hat, konnte er nicht wissen, dass es ihr letzter sein würde. Mit fünfzehn kann man nicht wissen, dass einer wie Alexandra auf dieser Welt nicht zu helfen war. Anfang der Siebziger haben viele die Doors gehört und in ihren einstigen Kinderzimmern die Wände und die Schleiflackmöbel schwarz gestrichen.
Alexandra war dabei eine der Ersten, wie bei allem, was Eltern ärgert und mit dem Geruch von Gefahr behaftet war. Ein Star auf ihre Art. Jedenfalls hier in der Vorstadt. Erst recht nach ihrem Ausflug in die Welt, nach London und dann immer wieder nach Amsterdam. Hatte am Ende Narrenfreiheit – vor allem bei den Eltern. Die haben sich nicht mehr zu helfen gewusst.
Cantuccis Augen überfliegen den letzten Satz des Briefes, es folgt ein Postskriptum, dann ein PPS, und noch ein PPPS, Teenie-Stil. Forever young – Alexandra hat das buchstabengetreu nachgelebt. Wenigstens der Inhalt des PPPS zeigt, dass sie kein Teenie mehr war, als sie das geschrieben hat: »Pass auf Charlie auf. Dich mag sie.«
Auf Charlie aufpassen. Leichter gesagt als getan. Cantucci greift zur Tasse. Er hat es mal versucht und ist gründlich gescheitert. An sich selbst. Oder doch an Charlie? Charlie, die Klette. So hat er sie als kleines Mädchen genannt. Mit achtzehn war sie noch immer recht anhänglich, beinahe noch ein Kind. Anders als er.
Aber das ist zwanzig Jahre her. Inzwischen ist sie eine erwachsene Frau und seit kurzem Erbin. Kein leichtes Erbe aus historischer Sicht. Und außerdem ein Erbe, das Charlie gar nicht haben sollte, sondern Alexandra. Könnte eine komplizierte Geschichte werden, hängt ganz von Charlie ab.