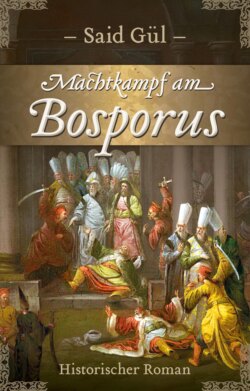Читать книгу Machtkampf am Bosporus - Said Gül - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 5
ОглавлениеEin Jahr später hatten Ibrahims Vorschlag und die Bemühungen der Menschen im Viertel bereits reiche Früchte getragen. Die Stiftung war wieder aufgeblüht. Allein David, der reichste Geschäftsmann des Viertels, hatte beispielsweise so viel gespendet, dass von dem Geld ein Jahr lang täglich dreißig Bedürftige gespeist werden konnten. Auch die Staatskasse durfte sich freuen. Denn die Stiftungen entrichteten einen prozentualen Tribut auf ihre Einnahmen, der dann für außergewöhnliche Aufwendungen und Notzeiten angespart wurde. Anders als bei anderen Tributzahlungen an die Hohe Pforte wurden diese Gelder aber nicht von Steuereintreibern des Sultans eingesammelt. Die Aufgabe fiel den Leitern der Stiftungen zu, die dabei von Imamen beaufsichtigt wurden.
Jeden Freitag priesen die Obst- und Gemüseverkäufer auf dem Marktplatz ihre Waren an. Gebäck- und Sorbetverkäufer drehten auf der Suche nach Kunden ihre Runden, manche Viertelbewohner verkauften zudem hausgemachte Leckereien. An diesem herrlichen Herbstmorgen zählten auch Ibrahim und sein Sohn zu den Besuchern der Stände, und während sie sich von der Menge treiben ließen, kamen immer wieder Menschen auf Ibrahim zu, die das Bedürfnis hatten, ihm für seine Verdienste um die Stiftung zu danken.
Das erfüllte Said einerseits mit großem Stolz auf seinen Vater, andererseits erinnerte es ihn aber auch daran, dass er selbst noch nie einen Fuß in das Stiftungsgebäude gesetzt hatte; und das, obwohl er doch tagtäglich außer freitags gleich nebenan zur Schule ging, die ja ebenfalls zu der Stiftung gehörte. Das Gebäude war für Kinder tabu. Schon oft hatte Said seinen Vater um eine Führung gebeten, diesmal erbarmte er sich.
„Gut, aber gedulde dich, bis Betim aus der Kirchenschule kommt. Dann nehmen wir ihn und auch Mersed mit.“
Said stöhnte innerlich auf, als plötzlich schon wieder jemand hinter ihnen herrief.
„Müderris, Müderris!“
Ibrahim drehte sich um und sah Sami auf sie zukommen. Aus Ehrerbietung nannte Sami ihn nie beim Namen, sondern bevorzugte seinen Titel.
„Hallo Sami, mein Freund“, erwiderte Ibrahim seinen Gruß.
„Tausend Dank, Müderris, wie Ihr unserer am Boden liegenden Stiftung neues Leben eingehaucht habt, ist großartig. Das wollte ich Euch schon lange einmal gesagt haben.“
„Nicht der Rede wert, Sami. Ich habe ja nur den Anstoß gegeben. Allein hätte ich das niemals schaffen können.“
„Nein, nein, nur keine falsche Bescheidenheit, Müderris. Alle Bedürftigen, die jetzt endlich wieder satt werden, und alle Kranken, für deren Pflege nun endlich mehr Geld bereitsteht, sind Euch zu großem Dank verpflichtet. Und ganz sicher werden Eure Bemühungen auch das Wohlgefallen Gottes finden.“
Sami würde seinen Vater wohl längere Zeit in Beschlag nehmen. Deshalb entschuldigte sich Said und fragte Eleftheria, ob sie sich nicht auch mit ihnen das Stiftungsgebäude anschauen wollte.
„Deine Mutter wird bestimmt nichts dagegen haben, wenn sie weiß, dass du bei uns bist und wohin du gehst.“
Nachdem Eleftheria die Erlaubnis bekommen hatte - mit der einzigen Auflage, nicht zu spät nach Hause zu kommen -, trotteten sie zum Marktplatz, um nach Saids Vater und ihren Freunden Ausschau zu halten.
Als sie Betim in Begleitung von Hagop erspähten, rannten sie auf sie zu und erzählten ihnen von der Führung. Doch während sich Hagop sofort von ihrer Begeisterung anstecken ließ, entfuhr Betim lediglich ein leises, unwilliges Grunzen.
„Was ist denn los mit dir, Betim?“, wollte Said wissen.
„Ach. Das viele Lernen geht mir auf die Nerven. Der Unterricht wird einfach von Tag zu Tag langweiliger.“
„Das viele Lernen? So schlimm ist es doch wirklich nicht, Betim“, protestierte Hagop. „Du bist nur denkfaul, das ist alles.“
„Betim doch nicht“, verteidigte Eleftheria ihn unverhofft.
„Doch, doch. Er zeigt nie auf, antwortet nicht auf die Fragen des Lehrers, hat keine Lust zu gar nichts.“
Anstatt weiter in der Wunde zu bohren, schlug Said vor, seinen Vater zu suchen. Er kannte Betim und wusste, dass auch er darauf brannte, einmal einen Blick in das Stiftungsgebäude zu werfen. Diese Gelegenheit würde er sich trotz seiner schlechten Laune nicht entgehen lassen.
Als sie Ibrahim schließlich in Samis Kaffeehaus fanden, staunte dieser nicht schlecht. Statt drei Kindern standen plötzlich fünf vor ihm; auch Mersed war inzwischen zu ihnen gestoßen.
In dem großen Innenhof der Stiftung kamen ihnen zwei Frauen entgegen. Die eine der beiden schien etwas schwach auf den Beinen zu sein; wahrscheinlich eine Patientin, die sich bei der anderen untergehakt hatte. Erst beim zweiten Hinschauen erkannte Said, dass diese zweite Frau seine Mutter war. Zwar wusste er, dass sie schon seit einem Jahr als Freiwillige im Krankenhaus aushalf, doch war ihm gar nicht erst der Gedanke gekommen, sie jetzt hier zu treffen. Er lief zu ihr, umarmte sie und begrüßte auch die Patientin. Ibrahim hingegen zog es vor, sie nicht weiter zu stören, und winkte ihnen nur kurz zu.
„Was habt ihr denn alle hier zu suchen?“, fragte Afife Said, und er erklärte es ihr. Doch als er merkte, dass die anderen schon ohne ihn weitergegangen waren, verabschiedete er sich schnell von ihr und lief ihnen zur Eingangstür des Gebäudes hinterher.
„So, und jetzt merkt euch eines“, schärfte Ibrahim den Kindern gerade ein. „Hinter dieser Tür müsst ihr euch absolut ruhig verhalten. Im Bibliotheksbereich dürft ihr nur flüstern, und im Krankentrakt ist sogar völliges Schweigen geboten, weil wir die Kranken ja nicht stören wollen. Reden dürft ihr nur später im Hamam. Dort könnt ihr dann testen, wie eure Stimmen vom Kuppeldach und den Kacheln des Bades verzerrt werden.
Hinter der Eingangstür tat sich ein langer Korridor auf, dessen Wände mit Koranversen zu den Themen Krankheit, Sauberkeit und Bildung verziert waren. Drei davon las Ibrahim ihnen vor:
„Er, der mich geschaffen hat und mich rechtleitet, der mir zu essen und zu trinken gibt und mich, wenn ich krank bin, heilt.“ – „Gott liebt die Bußfertigen und die, die sich reinigen.“ – „Fragt nach, wenn ihr etwas nicht wisst.“
Diese Verse fungierten als eine Art Wegweiser. Letzterer beispielsweise wies den Besuchern den Weg zur Bibliothek, die sich in einem Raum rechts von dem Korridor befand. Dieser maß vierzig Fuß im Quadrat und war in Zwanzig Fuß Höhe mit einer halben Kuppel überdacht. Aus den kleinen Fenstern schien die Sonne in den Raum und in der Dämmerung half den Lesern nur noch der Kerzenschein.
An den unverzierten Wänden standen sechs etwa zehn Fuß hohe Glasschränke und weitere Wandnischen, in denen die Bücher aufbewahrt wurden. Sie waren nicht aufgereiht, sondern übereinandergestapelt. Viele der Bücher waren Geschenke von wohlhabenden Spendern, und fast alle waren in Leder gebunden, was ihnen ein edles Aussehen verlieh. Von religiösen bis zu wissenschaftlichen Werken bot die Bücherei eine reiche Auswahl.
„Einige dieser Bücher sind schon vor mehr als tausend oder sogar zweitausend Jahren verfasst worden“, versicherte Ibrahim den staunenden Kindern. Die meisten waren nur Kopien. Doch es gab auch einige wenige Originale im Aufgebot. Anders dagegen in Hochschulbibliotheken, wie die der Medrese, an der Ibrahim unterrichtete. Dort fand man deutlich mehr Originalbände als hier in der Stiftungsbibliothek.
„Wirklich? Vor zweitausend Jahren? Die möchte ich sehen!“, rief Betim.
„Dann komm mit. Folgt mir!“
Vor einer Regalreihe mit alten Büchern stoppte Ibrahim und nannte ihnen drei Namen:
„Sokrates, Platon, Euklid - das waren alte griechische Philosophen. Sokrates hat unter anderem über das Gute im Menschen und über die Selbsterkenntnis geschrieben. Vielleicht habt ihr schon einmal von ihm gehört. Euklid war ein Mathematikgenie. Schon vor zweitausend Jahren wusste er mehr über Arithmetik und Geometrie als manche Gelehrte heute.
Platon dagegen verdanken wir die Überlegung, dass der Staat optimale Voraussetzungen zu schaffen hat, damit Gerechtigkeit im Land herrscht.“
„Bücher wie diese müssen doch unglaublich wertvoll sein.“
„Ja, sie kosten ein Vermögen. Aber zum Glück kann man sie ja hier lesen.“
„Mir ist es egal, wie alt ein Buch ist. Hauptsache, es bringt mir etwas bei“, gab Eleftheria zu bedenken, und Ibrahim pflichtete ihr bei.
Währenddessen studierte Said noch weitere Einbände und fragte seinen Vater nach einigen Autorennamen. Weder von Rhazes noch von Al-Kindi, Avicenna, Al-Khwarizmi oder Ulugh Bey hatte er je gehört.
„Von wem ist nochmal das Buch, das Großvater gerade liest?“
„Von Al-Biruni, mein Sohn, und er hat es auch von hier ausgeliehen.“
Die Bücher konnten nur in der Bücherei gelesen werden. Nur einige wenige Personen, die einen guten sozialen Ruf besaßen, durften einige Bücher mit nach Hause nehmen. So wie Halil Agha.
Nachdem sie genug gesehen hatten, gingen sie weiter zum Krankentrakt. Gleich am Eingang zog ihnen ein strenger Geruch in die Nase; angeblich von der Medizin, die den Patienten verabreicht wurde. Wie hielt seine Mutter das nur aus?, fragte sich Said. Aus den Krankenzimmern, in denen jeweils drei Betten standen, drangen laute Klagen und tiefe Seufzer zu ihnen auf den Flur hinaus, und so beschränkten sie sich darauf, kurz hineinzuschauen.
„Wofür braucht man denn in einem Krankenhaus Musikinstrumente?“, fragte Mersed Ibrahim, als er ihnen einen Raum zeigte, der ihnen fast den Eindruck vermittelte, im Vorzimmer eines Konzertsaals gelandet zu sein. Der Raum strotzte nur so vor Instrumenten. Manche davon hingen an der Wand, andere waren an kleine Schemel und Hocker gelehnt.
„Diese Instrumente sollen den Kranken bei der Genesung helfen. Schon seit Jahrhunderten behandelt man geistesgestörte und schwermütige Menschen mit Klängen und Harmonien. Wusstet ihr das?“
„Wirklich?“, staunte Eleftheria.
„Ja, aber nicht mit irgendwelchen beliebigen Klängen. Ney, Oud, Tanbur und Kanun sind wie dazu geschaffen, eine Atmosphäre zu erzeugen, in der die Kranken sich wohlfühlen und neue Kraft schöpfen können. Auch das Plätschern des Brunnens im Hof und das Gezwitscher der Vögel tragen ihren Teil dazu bei.“
Said dachte an das Ritual der Tanzenden Derwische im Konvent zurück. Wenn die Musik die Macht hatte, die Derwische derart in Ekstase zu versetzen, war es kein Wunder, dass sie auch Kranke heilen konnte.
Nach kurzer Überlegung strich Ibrahim das Hamam aus dem Programm. Denn auch wenn Eleftheria erst sechs Jahre alt war, würde man ihr den Zutritt ins Männerbad nicht gestatten. Er versprach den Jungen, den Besuch ein anderes Mal nachzuholen, und geleitete sie stattdessen ins Obergeschoss des dreistöckigen Komplexes. Von hier oben aus verwalteten er selbst, Garbis und Salih Hodscha alle Bereiche der Stiftung. Von der Armenküche, bis hin zu der Schule und die Bücherei.
„Hier also residiert mein Vater“, prahlte Hagop mit einem Grinsen auf dem Gesicht, und Said und Mersed ergänzten wie aus einem Munde:
„Und mein Vater!“
„Und mein Onkel!“
Die Kinder lachten.
„Residenz kann man das wohl kaum nennen, Hagop. Erstens bekommen wir hier kein Geld für unsere Arbeit, und zweitens wollen wir das Residieren doch lieber den Sultanen und Königen überlassen. Und außerdem: Kannst du dir vorstellen, dass ein Sultan den halben Tag einer geregelten Lohnarbeit nachgeht, um dann nachmittags seinen Thron zu besteigen oder in die Schlacht zu ziehen?“
Diesmal lachten sie noch lauter.
Trotzdem blieb Ibrahim nicht verborgen, dass gerade dieser Raum sie aufgrund seiner vornehmen Ausstattung mit großer Ehrfurcht erfüllte. Jedenfalls ließen sie es sich nicht nehmen, alles genau zu inspizieren und Ibrahim allerlei Fragen zu stellen, die er ihnen mit Engelsgeduld beantwortete.
Anschließend geleitete er sie aus dem Gebäude und zurück auf die Straße. Die Führung war beendet. Ibrahim eilte zum Abendgebet in der Moschee, und die Kinder gingen nach Hause.
Im Hof saß Afife auf einem Schemel vor einem Holztablett, als sie zurückkamen. In der Hand eine Walze, mit der sie Teigklumpen zu dünnen Börek-Blättern ausrollte, die sie anschließend mit einem Gemisch aus Schafskäse und Spinat füllte.
„Na, habt ihr eure Neugier gestillt?“, fragte sie die Jungen.
„Ja, nur das Hamam haben wir nicht gesehen“, erwiderte Said und wollte gerade ansetzen, ihr genauer zu berichten, als Betim ihm das Wort abschnitt.
„Ich würde gern einen Brief an meine Großmutter schreiben.“
Das hatte er sich zwar schon oft vorgenommen, aber immer wieder aufgeschoben, obwohl er genau wusste, wie sehr sie und sein Vater sich nach einer Nachricht von ihm verzehren mussten.
„Natürlich, Betim. Said, zeig ihm, wo das Schreibzeug liegt.“
Said holte ihm ein Blatt Papier, einen Schreibpinsel und ein Tintenfass. Dann schrieb Betim in seiner Muttersprache:
Liebe Großmutter, lieber Vater, meine lieben Geschwister. Seit einem Jahr lebe ich nun schon bei meiner türkischen Familie in Istanbul. Und fast genauso lang besuche ich schon die Schule, was mir viel Spaß macht. Vater Krikor und mein Lehrer, Pater Varujan, loben meine Leistungen. Auch habe ich schon so einiges über die Sitten und Gebräuche der Menschen hier gelernt. Ibrahim, unser Hausherr, und seine Familie behandeln mich gut. Und auch das Viertel, in dem wir leben, gefällt mir.
Es grüßt Euch
Euer Betim
Dies war jedoch nur die halbe Wahrheit. Denn in Wirklichkeit ließen Betims schulische Leistungen zunehmend zu wünschen übrig, und auch sein Verhältnis zu seiner Ziehfamilie war nicht mehr ganz ungetrübt. Mersed und er waren enge Freunde geworden, aber mit Said hatte er sich eigentlich nur am Anfang gut verstanden; zu unterschiedlich waren ihre Interessen gelagert. Ibrahim und Afife waren freundlich zu ihm, aber er wusste, dass ihnen seine Gleichgültigkeit und sein Desinteresse missfielen. Natürlich erwähnte Betim das in dem Brief mit keiner Silbe.
Am nächsten Morgen verließen Said und Betim nach dem Frühstück zusammen das Haus. Weil Betim den weiteren Schulweg und daher weniger Zeit hatte, bot Said ihm an, seinen Brief bei Sami abzugeben. Denn Sami war nicht nur Kaffeehausbetreiber, sondern in gewissem Sinne auch Barbier und Postbote. In einer Ecke seiner Stube stutzte er seinen Kunden die struppigen Bärte, in einer anderen sammelte er Briefe, die man ihm übergab, um sie später an die sogenannten Posttataren weiterzureichen.
Diese organisierten den Versand von Schriftstücken über ein dichtes Netz von Gasthöfen und Karawansereien im ganzen Osmanischen Reich, auch abseits der größeren Städte. Sie kamen nicht täglich in das Viertel, aber Betim hatte Glück, da sie schon am nächsten Tag erwartet wurden.
***
„Erkennt Ihr mich denn nicht wieder?“, fragte der Offizier Halil Agha, nachdem dieser ihm die Haustür geöffnet hatte.
„Ahmed, bist du es wirklich?“
„Ja, so klein ist die Welt.“
„Erzähl mir, was führt dich zu uns, Ahmed?“
„Als Ihr unsere Janitscharenkompanie verlassen habt, war ich Kommandeur vom Rang eines Za?arc?baş?. Aber schon bald darauf wurde ich zum Kethüda befördert. Ich bin also zum Präfekt und Stellvertreter des Aghas von unserem Korps aufgestiegen. Zu meinen Aufgaben gehörte es daher, die in den Provinzen angeworbenen Knaben in ihren Ziehfamilien zu besuchen und zu prüfen, ob sie sich gut entwickelten.
„Und du bist gekommen, um nach Betim zu schauen, nicht wahr?“
„Ihr habt es erraten. Aber wahrscheinlich ist er in der Schule, oder?“
„Ja, er kommt erst am Nachmittag zurück. Soll er sich bei dir melden?“
„Nein, nein, nicht nötig. Es genügt mir zu wissen, dass er bei Euch lebt. Ich vertraue Euch voll und ganz. Schließlich wart Ihr jahrelang unser Agha.“
„Danke, Ahmed. Und die Awaris-Steuer, die wir für ihn zahlen müssen, fließt dir mit den Tributzahlungen aus der Stiftung zu. Mach dir darüber keine Gedanken.“
„Wie gesagt, Halil Agha, ich vertraue Euch voll und ganz. Bis bald“, sagte der Präfekt und schlug Halil Aghas Einladung ins Haus zu einem Kaffee höflich, aber bestimmt aus.
Nur reiche und erhabene Menschen erklärten sich bereit als Ziehfamilie für die rekrutierten Knaben. Denn ihre Kosten, die mit ihm stiegen, wurden nicht vom Staat abgedeckt. Es war genau andersherum: Eine Art Freiwilligenarbeit, die sie sogar zu versteuern hatten. Damit erbrachten die Menschen dem Staat, ihrem Schutzpatron, als Gegenleistung dafür, dass sie unter seiner Obhut lebten, solche Dienste.