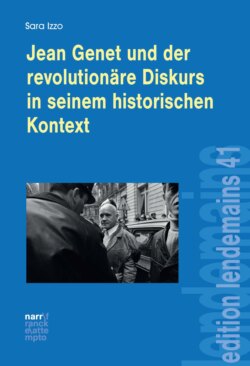Читать книгу Jean Genet und der revolutionäre Diskurs in seinem historischen Kontext - Sara Izzo - Страница 22
2.2.2.3 Jean Genet und die poetische Strategie der ‚corruption du langage‘
ОглавлениеIn seinem Interview mit Michèle Manceaux am 10. Mai 1970, das der Popularisierung der Black Panthers und des kurz zuvor in Paris für sie gegründeten Aktionskomitees dienen sollte, synthetisiert Genet die Hauptaspekte seines politischen Engagements. Auf die Frage, was ihn mit der Bewegung der Black Panthers verbindet, antwortet Genet:
Si je suis sincère, je dois dire que ce qui m’a touché d’abord, ce n’est pas leur souci de recréer le monde. Bien sûr, ça viendra et je n’y suis pas insensible, mais ce qui m’a fait me sentir proche d’eux immédiatement, c’est la haine qu’ils portent au monde blanc, c’est leur souci de détruire une société, de la casser. Souci qui était le mien très jeune mais je ne pouvais pas changer le monde tout seul. Je ne pouvais que le pervertir, le corrompre un peu. Ce que j’ai tenté de faire par une corruption du langage, c’est-à-dire à l’intérieur de cette langue française qui a l’air d’être si noble, qui l’est peut-être d’ailleurs, on ne sait jamais.1
Er unterscheidet hier zwischen jener pessimistischen und negativen Phase des Hasses und des Wunsches nach der Zerstörung der Gesellschaft und jener konsekutiven, positiven und zukunftsorientierten Phase der Schaffung einer neuen Welt, welche im Zusammenspiel implizit das Konzept der Revolution wiedergeben. Das bindende Element zwischen ihm und den Black Panthers wird dabei durch erstere Phase der Negativität repräsentiert, die Genet mit seinem eigenen frühen literarischen Werk in Verbindung setzt. Das negative Ziel der Zerstörung der Gesellschaft tritt in seinem poetischen Projekt der Perversion und Korruption von Sprache zutage.
Diesen Mechanismus der Perversion und Korruption von Sprache kommentiert Foucault in einem Gespräch mit japanischen Moderatoren über die vermeintlich subversive Kraft von Literatur im Dezember 1970. Einer seiner Gesprächspartner zitiert aus dem Gedächtnis eine öffentliche Stellungnahme Jean Genets, die sinngemäß Ähnlichkeiten mit der gegenüber Michèle Manceaux geäußerten Vision einer Korruption der Sprache aufweist. Statt der Perversion und Korruption der Sprache ist hier die Rede von einer Fäulnis und Zersetzung der Sprache, „pourrir le français“2. Foucault bietet zwei Interpretationsmöglichkeiten für diese Formulierung an. Im ersten Fall bezieht er den Mechanismus auf den literarischen Einsatz eines sozial bedingten Idiolektes, des Argots: „S’il s’agit d’introduire dans la langue française, dans le langage littéraire des tournures qui n’ont pas encore acquis droit de cité, alors il [Genet, S.I.] ne fait que poursuivre le même travail que Céline, pour prendre un exemple du passé.“3 Wie auch Eribon betont, distanziert sich Foucault von einer solchen literarischen Vision und spricht ihr jegliches revolutionäres Ausmaß ab,4 bietet jedoch eine zweite Deutung an:
Mais si la formule ‚pourrir le français‘ signifie que le système de notre langage – à savoir comment les mots fonctionnent dans la société, comment les textes sont évalués et accueillis et comment ils sont dotés d’une efficacité politique – doit être repensé et réformé alors, bien sûr, le ‚pourrissement du langage‘ peut avoir une valeur révolutionnaire.5
Genets politische Strategie der inneren Zersetzung von Sprache hat für Foucault insofern eine revolutionäre Wertigkeit, als ein systemisches Umdenken der gesellschaftlichen und politischen Funktion von Sprache und Texten angestrebt wird, wie er selbst es in anderer Form im Gegen-Diskurs experimentiert. Wie Genet bewertet auch Foucault tiefgreifende gesellschaftliche Veränderungen als Prämisse für einen grundlegenden sprachlichen Wandel, der sich letztlich als Wirkung und Konsequenz eines zunächst auf politischer Ebene besiegelten Umbruchs manifestiert:
Mais […] la situation globale du langage et des différentes modalités que je viens d’évoquer ne peut être réformée que par une révolution sociale. En d’autres termes, ce n’est pas par un pourrissement interne du langage que la réorganisation globale, la redistribution globale des modalités et des valeurs du langage peuvent être opérées. Mais c’est par une reforme en dehors du langage.6
Foucault und Genet sind sich somit beide der dezidierten Wirkungschancen einer rein auf sprachlicher Ebene realisierten Umwertung des Systems bewusst und betonen die Notwendigkeit außersprachlicher Umbrüche. Dabei unterscheidet jedoch Genet stärker zwischen poetischer Negation7 und politischer Affirmation. Auch wenn erst eine gesellschaftliche Revolution einen umfassenden sprachlichen Wandel bewirken kann, spiegelt sich doch für Genet das revolutionäre Potential einzelner Bewegungen in deren poetischer Vision wider, die als gesellschaftliche Kommunikationsform zum Ausdruck kommt. So bezeichnet er die Black Panthers als poetische Bevölkerungsgruppe mit einem natürlichen Sinn für Poesie:
They [the Black Panthers, S.I.] are a poetic people. Black people in America seem to have a natural poetic sense, and the discoveries they’ve made about how to struggle politically lean curiously on a poetic sentiment about the world. Maybe I’m wrong, but I think those things are linked, politics and poetry. I think political reflection is integral to poetic comprehension and vice versa. It’s something about the world black people live in; their political perspicacity comes out of looking at their world poetically.8
Einen Schlüsseltext in diesem Zusammenhang konstituiert sein Vorwort zu den Gefängnisbriefen George Jacksons, welches Genet wenige Monate nach seinem Interview mit Michèle Manceaux im Juli 1970 redigierte und das bereits unter dem Aspekt seiner Rolle als préfacier beleuchtet wurde. Als literaturkritischer Kommentar konzipiert, legt es einen Schwerpunkt auf die sprachlich-stilistische Gestaltung der Briefsammlung, welche Genet gattungsspezifisch als „sorte d’essai et de poème confondus“9 einordnet und damit auf sein eigenes Ideal einer Mischung der traditionellen stilistischen und poetologischen Differenzierung von politischer Rhetorik und Poesie rekurriert. Genet präzisiert hier in Bezug auf Jacksons Briefe den Mechanismus einer Korrumpierung jener Sprache, die er als Sprache des Feindes bezeichnet: „Ici encore, le prisonnier doit se servir du langage même, des mots, de la syntaxe de son ennemi alors qu’il sent le besoin d’une langue séparée qui n’appartiendrait qu’à sa nation.“10 In Ermangelung einer eigenen Sprache, die nicht von der „juridiction de grammairien“11 reguliert wird, sind Akzeptanz und Korrumpierung der normativen Sprache für Genet die einzige Lösung: „Il [le Noir, S.I.] n’a donc qu’une ressource: accepter cette langue mais la corrompre si habilement que les Blancs s’y laisseront prendre.“12 Genet konstatiert selbst, dass die Lösung in dieser Form des inneren Widerstandes dem revolutionären Projekt entgegenzulaufen scheint: „Et c’est un travail qui semble être contredit par celui du révolutionnaire.“13 Das revolutionäre Ziel hat jedoch für Genet einen poetischen Ursprung, der im Moment des Hasses und der Ablehnung der ‚weißen‘ Gesellschaft mit ihrem moralischen Wertesystem und sprachlichen Regelwerk verankert ist und aus dem erst die langsame Substitution des sprachlichen Begriffssystems resultieren könne:
L’entreprise révolutionnaire du Noir américain, semble-t-il, ne peut naître que dans le ressentiment et la haine, c’est-à-dire en refusant avec dégoût, avec rage, mais radicalement, les valeurs vénérées par les Blancs, cependant que cette entreprise ne peut se continuer qu’à partir d’un langage commun, d’abord refusé, enfin accepté où les mots ne serviront plus les notions enseignées par les Blancs, mais des notions nouvelles.14
Der Mechanismus der Korrumpierung der Sprache beschreibt folglich das Phänomen einer Umwertung des bereits existierenden und allgemeingültigen Sprachsystems, welches von innen heraus zerbrochen wird. Solange die Revolution des Sprachsystems nicht vollzogen ist, muss die Positionierung vermittels der einheitlichen und feindlich besetzten Sprache darüber hinaus in Form einer „démarche oblique“15 erfolgen. Diese Metapher des schrägen Gangs, mit welchem sich George Jacksons im Gefängnis verfasstes Buch dem Leser nähert, beschreibt die Suspension eines Vokabulars des Hasses sowie den daraus resultierenden, verzerrten Darstellungsmodus. Vermieden wird so die Verwendung der „mots interdits, maudits, […] ensanglantés, […] crachés avec la bave, déchargés avec le sperme, […] calomniés, réprouvés, […] non écrits […], dangereux, cadenassés, […] qui n’appartiennent pas au vocabulaire“16. Die Virulenz und Vehemenz jener Worte, welche die Realität im Gefängnis aus einer frontal gegen den Leser gerichteten Perspektive wiedergeben könnten, werden durch die Verwendung eines zugelassenen Vokabulars eingedämmt, welches die kommunikativen Grundlagen für den Leser sicherstellt: „C’est donc derrière une grille, seule acceptée par eux, que ses lecteurs, s’ils l’osent, devineront l’infamie d’une situation qu’un vocabulaire honnête ne sait restituer, mais derrière les mots admis, discernez les autres!“17 Genets sprachreflexive Vision zeugt von einer Janusköpfigkeit der Sprache, die sich stets sowohl an Adressaten richtet, welche die Erfahrungen des Autors teilen, und solche, die jenseits dieses Erfahrungshorizontes situiert bleiben. Letzteren kann sich der Autor niemals frontal und direkt zuwenden, sondern nur schräg bzw. diagonal, wie auch Tahar Ben Jelloun, den Genet in den frühen 1970er Jahren kennenlernte, in seinen Erinnerungen als eigentümliches literarisches Merkmal Genets herausstellt:
J’ai appris avec lui [Genet, S.I.], comme avec Roland Barthes dont je suivais le cours, qu’il fallait observer la société de manière oblique, jamais frontale, directe, ni parallèle. Ce que Barthes appelle ‚le détour‘, Genet l’appelle plutôt ‚diagonale‘, une diagonale qui traverse le monde.18
Tahar Ben Jelloun vergleicht hier Genets Vorstellung einer schrägen, diagonalen Herangehensweise an die Gesellschaft mit Barthes’ Konzept des Umweges, des „détour“, und macht von einer ähnlichen Deskription Gebrauch wie Genet selbst in seinem letzten Interview mit Nigel Williams zur Visualisierung seiner eigenen kunstästhetischen Demarche: „[…] ma démarche à la société est oblique. Elle n’est pas directe. Elle n’est pas non plus parallèle, puisqu’elle le traverse, elle traverse le monde, elle le voit. Elle est oblique. Je l’ai vu en diagonale, le monde, et je le vois encore en diagonale.“19 In Anlehnung an dieses Verständnis kann die Kommunikation der Black Panthers mit der dominierenden Gesellschaftsschicht nur über einen Diskurs „mutilé, élagué de ses ornements trop tumultueux“20 funktionieren, der jedoch die Spuren des „passage orgiaque et haineux“21 in sich trägt. Es handelt sich um einen Diskurs durch die Gitterstäbe des Gefängnisses hindurch, den Genet aber – über Foucaults Konzept des Gegen-Diskurses hinaus – nicht nur als Freisetzung des eingeschlossenen Wortes thematisiert, sondern dessen poetische Funktionsweise er reflektiert. Implizit kontrastiert Genet dabei zwei Formen der Kommunikation, nämlich die emotional-affektive Verbalisierung des Hasses und die rational fundierte Sprache des Grammatikers, welche das syntaktische Gerüst liefert. In einem Interview mit Hubert Fichte 1975 beschreibt Genet rückblickend sehr exakt diese Antithese:
Il semble qu’il y ait au moins deux sortes de communication: une communication rationnelle, réfléchie. […] Et puis, il y a alors une communication qui est moins certaine, pourtant évidente, je vais vous demander si vous êtes d’accord, le vers de Baudelaire: ‚Cheveux bleus, pavillon de ténèbres tendues‘, est-ce que vous trouvez que c’est beau?
[…] Et nous communiquons. Bon, il y a donc au moins deux sortes de communication, un mode qui est reconnaissable, contrôlable et puis un mode incontrôlable. L’action des Panthers relevait de la communication incontrôlable. […] C’était une révolution qui était de l’ordre affectif et émotionnel; alors, ça n’a pas de rapport … ça a peut-être des rapports mais très discrets avec des révolutions qui sont tentées ailleurs par d’autres voies.22
Die Kommunikationsform der Black Panthers, welche hier als irrational und unkontrolliert charakterisiert wird, vergleicht Genet mit dem poetischen Prinzip von Kommunikation, wie das Zitat Baudelaires suggeriert. Damit steht Genets Konzept der gesellschaftspolitischen Kommunikation diametral derjenigen Sartres gegenüber, demzufolge die Poesie als selbstreferentielle Form der Kommunikation keine Reziprozität zum Gegenüber herstellen könne und per se ein Desengagement vermittle.23 Moreno begründet ihre Ansicht, dass Genets politische Texte bewusst nichts aussagten, auf Basis ebendieser Axiomatik Sartres:
L’‚engagement‘ de Genet serait alors d’ordre poétique et politique. Contrairement à l’engagement sartrien, pour lequel la fin du langage est de communiquer, sauf dans la poésie, l’écrivain laisse sa prose être contaminée par la poésie. Il refuse ainsi de voir le langage comme un instrument qui permettrait de provoquer l’indignation, l’enthousiasme, ou bien de s’expliquer clairement. Il écrit pour ne rien dire même dans ses textes explicitement politiques.24
Diese These ist kritikwürdig, da Moreno hier weder die Existenz und Ausdrucksform von Genets pragmatischen Texten berücksichtigt, noch sein spezifisches Konzept eines poetisch-politischen Engagements entschlüsselt. Während Sartre die Möglichkeit einer Öffnung zum Adressaten hin in der Poesie leugnet, basiert Genets Vorstellung von Kommunikation auf dem Phänomen der Polysemie. Dieses liegt in der Unzulänglichkeit der normativen Sprache, der Sprache des Feindes, begründet, die zwar als Kommunikationsmittel verwendet werden muss, aber ihre Bedeutung adressatenorientiert entfaltet und damit von einer inhärenten Mehrdeutigkeit bzw. Unkontrollierbarkeit geprägt wird. Die umstrittene Studie Éric Martys thematisiert die Bedeutung der Mehrdeutigkeit am Beispiel der Homonymie in Genets politischen Texten, welche als semantische Transgression bezeichnet wird.25 Genets Verwendung von Homonymen greife die politische Ordnung selbst an, insofern bei Genet die referentielle Sprachebene betroffen sei:
La remise en cause de la langue a donc ici pour point d’appui le Réel, soit ce qui obscurcit et disperse, ou encore ce qui abolit tout lien, le lien du signifiant (du symbolique), celui de la possibilité du discernement (de l’autre), et le lien du signifié (de l’imaginaire), celui de la possibilité de l’identité du (même).26
Marty verweist in diesem Kontext auf das seit Aristoteles bestehende Gebot der Eindeutigkeit politischer Reden, welches von Genet unterlaufen werde. Im dritten Buch seiner Rhetorik kontrastiert Aristoteles den poetischen und den rhetorischen Stil, welcher sich durch Klarheit und Angemessenheit in der Wortwahl auszeichnet und jegliche Irrtumsmöglichkeiten ausschließt.27 Bei Genet verweben sich diese traditionell differenzierten Stile bewusst, wie sich auch in der gattungsspezifischen Bezeichnung der Gefängnisbriefe als Mischform aus Essay und Liebesgedicht andeutet.28 Marty stützt seine These der Homonymie mittels des wenig überzeugend exemplifizierten Faschismus-Begriffs, den Genet sowohl zur Stigmatisierung der weißen Gesellschaft in den USA verwende, als auch als revolutionäre Strategie, so dass ‚Faschismus‘ einerseits die Repression durch die normative Gesellschaft beschreibe und andererseits den radikalisierten Befreiungskampf der unterdrückten afroamerikanischen Bevölkerung.29 Der Begriff des Faschismus als zeithistorisch bedingtes Schlagwort „demeure prise dans l’époque“30, wie Hadrien Laroche zu Recht konstatiert, wird jedoch von Genet auch in seinem etymologischen Bedeutungsursprung eines Faszinosums gebraucht, wodurch überhaupt erst dessen Polysemie erkennbar wird. Deutlicher wird Genets Sprachkritik anhand eines lexikalischen Phänomens, dessen kulturspezifisch bedingte Mehrdeutigkeit Genet im Kontext der Black Panthers wiederholt zitiert, nämlich das des Baumes, der je nach Perspektive als Symbol des Lebens oder des Todes figuriert: „Si un arbre pour nous, c’est une fête du feuillage, des oiseaux et des fruits, pour un Noir de l’Alabama c’est d’abord la potence où des générations de Noirs ont été lynchées.“31 Auch in seinem Vorwort zu George Jacksons Gefängnisbriefen wird dieses Motiv in einem sehr dichten Satz als Zeichen des Hasses evoziert:
Mais j’ai trop longtemps vécu en prison pour n’avoir pas reconnu, dès qu’on m’en eût traduit à San Francisco les premières pages, l’odeur et le grain très particuliers de ce qui fut écrit dans un cachot, derrière des murs, des gardes, empoisonné par la haine, car, ce que je ne savais pas encore avec une telle intensité, c’est la haine de l’Américain blanc pour le Noir au point que je me demande si tout homme blanc de ce pays, quand il plante un arbre, ne voit pas à ses branches des Nègres pendus.32
Als abstrakte Potenz verweist der Begriff des Baumes je nach Sprecher auf eine andere außersprachliche Wirklichkeit und ist damit auch Träger unterschiedlicher symbolischer Systeme, die jedoch stets in Dependenz zum dominanten Sprachsystem bzw. zur Sprache des Feindes stehen. In seinem Interview mit Antoine Bourseiller 1981 entschlüsselt Genet den Ursprung dieses Motivs, bei dem es sich um die Begründung David Hilliards von den Black Panthers handelt, warum er Genet nicht in die im Wald gelegene Stony-Brook Universität bei New York begleite: „Non, il y a encore trop d’arbres.“33 Genet kategorisiert seine Antwort als „réponse que seul un Noir américain pouvait faire“34 und decodiert die Bedeutung des Baumes ähnlich wie in den anderen beiden Textbeispielen als Zeichen der amerikanischen Lynchjustiz, das jedoch allein für die afroamerikanische Bevölkerung eine Gefahrenquelle designiert, während die Aussage für die weiße Bevölkerung ohne eine nähere Erläuterung unverständlich bleiben muss. In diesem Beispiel spiegelt sich die poetische Vision der Welt wider, welche Genet den Black Panthers attestiert. Denn die Poesie entfaltet sich für Genet aus der Situation der gesellschaftlichen Ausgeschlossenheit, die in der Eingeschlossenheit im Gefängnis versinnbildlicht ist. Aus dieser poetischen Vision wird überhaupt erst ein revolutionäres Potential freigesetzt.