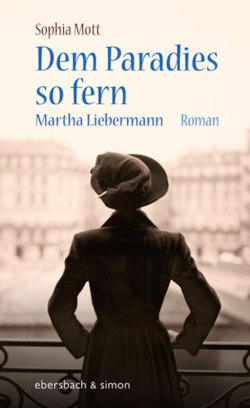Читать книгу Dem Paradies so fern. Martha Liebermann - Sophia Mott - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Was vom Leben bleibt, sind Bilder und Geschichten
Оглавление»Was vom Leben bleibt, sind Bilder und Geschichten«, hatte Kultusminister Becker bei der Eröffnung von Max großer Ausstellung in der Akademie Goethe zitiert und Max hatte es natürlich nicht lassen können, ihn zu korrigieren: »Det kenn ick nich. Det is nich von Joethe.« Über seinen Lieblingsdichter brauchte ihm keiner was zu erzählen. Martha aber fügte für sich hinzu: ›Es bleiben auch die Kinder.‹ Wie leicht vergessen die, die große Worte machen, was eigentlich fortdauert. Aber natürlich verlassen einen die Kinder eines Tages und manchmal auch die Geschichten und vielleicht sogar die Bilder. Mit jedem Verlust verliert man gelebtes Leben. Nur was erinnert werden kann, ist gewesen. Und manches wird erinnert, was niemals gewesen ist.
Da sind die Orte des Spiels und der scheinbar endlosen kindlichen Freiheit gewesen. Sie beschränkten sich in Wahrheit auf eine Wiese, ein bisschen Gebüsch, hinter dem man sich versteckte, und einem Teich mit Enten, der Martha groß wie das Meer oder wenigstens wie der Wannsee vorkam.
Schätze verwahrte sie in der Schürzentasche, ihrem heiligen Gral, der entweiht wurde, jedes Mal, wenn er in die Wäsche kam. Wenigstens legte das Kindermädchen Murmeln, Steinchen, Blättchen, verschrumpelte Kastanien und leere Schneckenhäuschen auf Marthas Nachttisch, bevor sie das Kleidungsstück zur Wäsche gab. Dort lagen die Zeugen eines Lebens, von dem die Erwachsenen nichts verstanden, entblößt, im Licht des Tages oder der Lampe ihrer Magie beraubt, bis sie am nächsten Morgen in eine neue Schürzentasche wanderten und diese zu einem heimeligen, heimlichen Ort belebten. Um den herum rankten sich Abenteuer, so aufregend, dass sie sie noch in den Schlaf verfolgten.
Eine erste Freundin. Nie erfuhr Martha einen Nachnamen, Adresse oder aus welcher Familie das Mädchen stammte. Ihre Verbindung bestand einzig darin, dass auch Bertha regelmäßig mit ihrem Kindermädchen in den Monbijoupark kam und dass Marthas Mädchen die gleiche Vorliebe für eine bestimmte Bank hatte.
Eines Tages hockte sie neben ihr am Boden, schnippte eine fensterglasklare Murmel in Marthas Richtung und sagte: »Willst du meine Freundin sein?!« Es war beinahe keine Frage, die sie stellte, sondern eine Forderung, und Martha antwortete unsicher: »Wenn du meinst.« »Wollen wir Ball spielen?« »Wenn du meinst.« »Lass uns an den Teich gehen.« »Wenn du meinst.« »Gib mir mal den Stock.« »Wenn du meinst.« Bertha platzte der Kragen, sie streckte Martha die Zunge heraus und äffte sie nach: »Wenn du meinst, wenn du meinst, wenn du meinst!«
Das Kindermädchen setzte dem aufkeimenden Streit ein Ende, indem es Martha an der Hand fasste und wegzog. Es wurde Zeit, nach Hause zu gehen. Noch als sie bereits auf dem Monbijouplatz angelangt waren, drehte sich Martha an der Hand des Mädchens um und blickte zurück, dorthin, wo schon lange nichts anderes mehr zu sehen war als die Torhäuser, die Parkmauern und darüber das grüne Gewölk der Gartenanlage.
Am nächsten Tag war Bertha wieder da. Wieder hockte sie am Boden, zog mit einem Stock Linien in den Sand, die die Begrenzungen einer imaginären Wohnung darstellten. »Da ist der Salon. Da das Esszimmer, da ist die Küche. Ich bin die Mutter, du bist das Kind.« Martha wollte nicht das Kind sein. Kind sein bedeutete in diesem Spiel wie im wahren Leben, gehorchen zu müssen, und die strenge Erzieherin Bertha ließ zahllose Anweisungen auf Martha niederprasseln. »Jetzt will ich die Mutter sein!«, sagte sie.
»Nein, ich habe keine Lust mehr.« Bertha wischte mit einem Ast die Linien fort, der Salon verschwand im märkischen Staub. Sie zog ihre durchsichtige Murmel aus der Tasche und schnippte sie weit fort, bis vor die Füße eines Spaziergängers. »Hast du keine Murmeln?« Doch, auch Martha hatte welche. Ihr größter Schatz war eine dunkelblaue, in der hellere Einschlüsse eine Spirale bildeten. Sie zog sie hervor. Berthas Begehren war deutlich in ihren Augen zu lesen. »Gib sie mir.« »Nein.« »Nur für kurz.« »Nein.« »Ich gebe dir dafür die durchsichtige.« Ein zögernder Austausch. Bertha ließ sofort die blaue Murmel in ihrer Schürzentasche verschwinden. »Ich will aber meine Murmel wiederhaben. »Getauscht ist getauscht.« »Nur für kurz hast du gesagt.« Martha zerrte an Berthas Schürze. Bertha kreischte. Die Kindermädchen erhoben sich seufzend. Die Streitenden wurden getrennt. Martha weinte.
Aber auch zu Hause kehrte das Leid wieder, kurz vor dem Schlafengehen. »Warum weint das Kind?« Die Mutter entlockte ihr den Kummer. Das Mädchen wurde angewiesen, die Murmel zurückzufordern. Als ob damit alles erledigt gewesen wäre! Es war ihre eigene Hilflosigkeit, die Martha verstörte, einem fremden Willen ausgeliefert zu sein, und natürlich die Murmel, die war es auch. Die durchsichtige lag auf ihrem Nachtschränkchen. Ein Pfand.
Am nächsten Tag gab es eine frische Schürze und Martha packte die Murmel hinein. An der Hand des Mädchens hüpfte sie zum Monbijoupark. Bertha kam lange nicht. Martha langweilte sich. Und dann stand Bertha plötzlich doch hinter ihr und drückte ihr einen Kuss auf die Wange. »Hast du meine durchsichtige Murmel noch?« Martha wischte das Feuchte auf ihrer Backe weg und zog die Murmel heraus. Sie hatte gut auf sie achtgegeben. Bertha hielt die blaue hoch. Sie hatten beide achtgegeben. Sie konnten einander vertrauen.
Das Kindermädchen forderte den Austausch der Murmeln. Jede solle ihre eigene wieder nehmen. Das war gar nicht mehr wichtig. Aber der Anweisung musste Folge geleistet werden. Es war klar, dass die Welt der Erwachsenen sich jetzt in ihre Freundschaft mischte, das Gleichgewicht zerstörte. Martha hatte gepetzt.
Später saßen sie am Rand des Ententeiches. Bertha hob plötzlich den Arm und schleuderte ihre Murmel so weit sie konnte in den kleinen See. Martha zögerte. Dann holte auch sie aus. Ihre blaue Murmel versank mit einem weichen, schmatzenden Laut.
Die Freundschaft mit Bertha endete so beiläufig wie sie begonnen hatte. Martha erinnerte sich später nicht daran, irgendein Leid empfunden zu haben. Ihre Familie zog in die Französische Straße, wer auf sich hielt, rückte in Richtung Tiergarten vor, der Zug nach dem Westen hatte sie erfasst, immer weiter weg von den Wurzeln, die nicht allein im Osten Berlins, sondern noch weiter in Hinterpommern in einem kleinen Kaff namens Märkisch Friedland lagen.
Das Mädchen ging jetzt mit ihr und den Geschwistern sehr viel lieber zum Tiergarten. Über die Hauptwege rollten Equipagen, es konnte sein, man sah den Regentenkönig mit seinem Gefolge bei einer Ausfahrt, Reiter trabten auf ihren Pferden vorbei, führten die schönen Gäule vor, warfen sich in die Brust und blickten von oben herab auf das Volk. Es war viel Militär unterwegs, auch in kleinen Gruppen zu Fuß, mit umgeschnallten Säbeln, die an die glänzenden Stiefel schlugen, und alle blickten sich um, ob sie gesehen wurden oder ob sie jemanden sahen, die jungen Offiziere ein hübsches Mädchen, ein Kindermädchen wie Marthas, dem man heute ein paar Blicke und morgen ein paar Worte zuwarf, übermorgen ging man zum Tanz ins »Alte Türmchen« am Kreuzberg und am folgenden Wochenende fuhr man mit ihr vielleicht irgendwo ins Umland in eine Pension.
Martha und ihre Geschwister wurden sich selbst überlassen. Die Kinder spielten auf den Nebenwegen, die schnurgerade und unheimlich verschattet durch den lichten Wald führten. Dass man so weit blicken konnte und doch nicht sah, was dort am Ende, wo ein wenig Licht einen winzigen Punkt setzte, war, machte das Geheimnis. Es war eine Mutprobe, hineinzulaufen, so weit, wie man sich traute, dorthin, wo es angeblich wilde Tiere gab, die unversehens aus dem Gebüsch hervorspringen konnten, Wildschweine, Hirsche, Füchse.
»Da dieser Schatten, ist da nicht was? Wer traut sich mit mir zu kommen? Es bewegt sich. Ich habe ein tiefes Brummen gehört.« – Jetzt raschelte es im Gebüsch und alle liefen sie schreiend zurück zur Promenade, nur um bald wieder aufzubrechen zu einer nächsten Expedition.
An den Wegen entlang verliefen schmale, verschlammte Rinnsale. Ihr Gefälle war gering, nie wurden sie ausgegraben und gereinigt, Abwässer vom Schifffahrtskanal wurden hineingedrückt, so fing die Brühe an zu stinken. Im Dämmerlicht der Baumschatten sah man aus den Gräben Faulgase in bunten Blasen aufsteigen, die zerplatzten wie ein kleines Feuerwerk.
»Das sind Elfenrülpser«, sagte Marthas Bruder Benno und schickte gleich selbst einen hinterher. Die Kinder sprangen über die übel riechenden Rinnen, Benno sprang zu kurz, rutschte auf der anderen Seite des Grabens ab und fiel in den Dreck. Er stank so fürchterlich, dass er auf dem hastig angetretenen Heimweg ein paar Schritte hinter ihnen laufen musste. Als sie in die Französische Straße einbogen, hefteten sich ein paar Nachbarskinder an ihre Fersen und schrien: »Kieckt ma da, der dreckije Judenbengel!«
Das Kindermädchen wurde vom »Fräulein« abgelöst. Ihm wurde nicht mehr die ganz unkritische und heiße Liebe zuteil, die noch dem Mädchen gegolten hatte. Fräuleins waren Lehrerinnen, Respektspersonen, man sollte ihnen gehorchen, aber sie waren in der Erwachsenenwelt selbst wenig geachtet. Das Empfinden, das man solch einer Existenz entgegenbrachte, hatte einen Beigeschmack von Herablassung, auch wenn das Fräulein an allen familiären Ereignissen teilnahm, als gehörte es tatsächlich dazu. Erinnerungen an diese Frauen waren ins Anekdotenhafte verzerrt, wie jene an das Fräulein Brasig, ein große, grobknochige Person mit tiefer Stimme und einem dunklen Flaum auf der Oberlippe. Marthas Mutter nannte sie heimlich »Herr Brasig«, und der Vater sagte manchmal scherzhaft, wenn sie vom Essen aufstanden: »Brasig, kommen Sie, lassen Sie uns im Herrenzimmer eine gute Zigarre rauchen.« Die Brasig ließ sich alles mit einem sauren Lächeln gefallen. Einmal sprang sie in die Bresche, als Marthas Schwester Else nicht imstande gewesen war, den Belsazar am Mittagstisch lückenlos und fließend aufzusagen, wie es der Vater gewünscht hatte. Beim Vortrag der Ballade fand die Brasig zu plötzlicher Größe und offenbarte schauspielerisches Talent, welches man ihr nie und nimmer zugetraut hätte, indem sie mit unvergesslicher Geste, einem entschlossenen Schnitt der Handkante unter ihrer blassen, bereits leicht faltigen Kehle, das letzte Verspaar vortrug: »Belsazar ward aber in selbiger Nacht von seinen Knechten umgebracht.« Noch Jahre später zitierten die Familienmitglieder unter großem Gelächter jene Worte, begleitet von wildem Augenrollen und der Bewegung der flachen Hand an der Kehle.
Vollkommen überrascht war Martha, dass gerade dieses Fräulein sie eines Tages verließ, um zu heiraten. Sie bekam zum Abschied von Marthas Vater eine Art Aussteuer und eine kleine Mitgift. Dass einer die Brasig liebte, unbegreiflich.