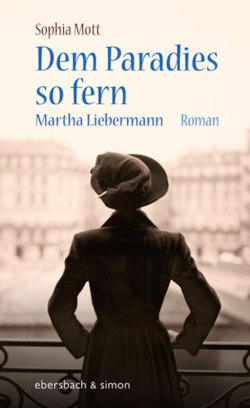Читать книгу Dem Paradies so fern. Martha Liebermann - Sophia Mott - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
18. Oktober 1941
ОглавлениеUexküll und Bernstorff treten hinaus auf die Alsenstraße. In einem Hauseingang gegenüber weicht eine schemenhafte Gestalt zurück. Bernstorff packt Uexküll am Arm. »Uexküll, ich muss mit Ihnen reden. Ich liebe Ihre Frau!«, sagt er sehr laut.
Uexküll weiß nicht recht, was er antworten soll. »Was denken Sie denn, was ich jetzt tun werde«, fragt er schließlich. »Soll ich Sie zum Duell fordern?«
»Wir müssen reden. Gehen wir ein paar Schritte.«
Bernstorff schiebt Uex in Richtung Tiergarten. An der Straßenecke sieht er sich noch einmal um und kichert.
»Sehen Sie, es hat funktioniert. Unser Aufpasser fand den Streit zweier Herren um eine Dame nicht wert, die Verfolgung aufzunehmen.«
Es ist schon beinahe dunkel, als Uexküll und Bernstorff durch die Siegesallee gehen. Am Tag gleißend in weißem Marmor, stehen die Hohenzollern und ihre Vorfahren jetzt finster in ihren Heckennischen. Der Erste in der Reihe preußischer Herrscher, die die Prachtstraße säumen, ist Albrecht der Bär, er streckt ihnen das Kreuz entgegen, seine linke Hand am Schwert, die Augen zusammengekniffen.
Bernstorff hält inne und sagt: »Was meinen Sie, Uex, ist das Kreuz Schuld an der menschlichen Katastrophe? Kriecht aus der alten Feindschaft zwischen denen, die den Messias gemordet haben, und denen, die die Nachfahren seiner Anhänger sind, tatsächlich die neue Schuld?«
Es sei Albrecht dem Bären in diesem besonderen Falle kein Vorwurf zu machen, antwortet Uex trocken. Im Übrigen seien die Kriege Albrechts in erster Linie expansionistisch gewesen und weniger idealistisch. Was die aktuelle Lage betreffe, sehe er wieder einmal nicht den Gegensatz zwischen Christen und Juden, sondern den zwischen den Zeitgenossen mit einem Glauben und denen, die einem Kult anhängen, der kein Gewissen kenne.
Sie nehmen ihren Weg schweigend wieder auf. In den Gebüschen hinter den Denkmälern raschelt es, vielleicht Vögel, die sie aufgeschreckt haben, oder Ratten.
»In der Nacht«, sagt Uexküll, »ist hinter den Altvorderen das ideale Versteck für Strauchdiebe.«
Bernstorff lacht und klopft mit seinem Stock in einem raschen Staccato vor sich auf den Kies.
»Bis jetzt ist Frau Liebermann in ihrer Wohnung wohl ziemlich unbehelligt geblieben?«, fragt er.
»Beinahe ein Wunder«, bestätigt Uexküll. Natürlich habe sie, wie alle wohlhabenden Juden, unglaubliche Sühneleistungen zahlen müssen, Konten seien gesperrt, das Haus in Wannsee schon lange zwangsverkauft worden, aber von tätlichen Angriffen, Anpöbeleien, ebenso wie einem Umzug in eine Judenwohnung sei sie bisher verschont geblieben. Zwei Haushälterinnen kümmerten sich nach wie vor rührend um sie. Sie leide keine Not.
Bernstorff sagt, man müsse Frau Liebermann klarmachen, dass sie, auch wenn sie sich ganz in ihrer Wohnung vergrabe, nicht sicher sei vor den Nachstellungen der Nazis. Schonung sei jetzt nicht mehr opportun. »Sie muss wissen, was ihr droht. Dabei sollten wir nicht übertreiben, aber auch nichts auslassen.«
Er glaube nicht, sagt Uex, dass Frau Liebermann so unwissend sei. »Sie ist eine intelligente Frau, geistig noch vollkommen auf der Höhe, unsentimental und stark.« Wenn sie sich bisher geweigert habe, zu emigrieren, hänge das eher mit ihrem Verständnis von Pflichtgefühl und einer Form von Bescheidenheit zusammen. Um sich selbst habe sie nie große Geschichten gemacht. »Alles drehte sich immer nur um ihren Mann.«
Bestimmt aber, meint Bernstorff, überschätze sie ihre Stärke. Alle überschätzten ihre Stärke. Angesichts der nackten Gewalt werde man klein und jämmerlich. Er drückt die Faust, die er um den Knauf des Spazierstocks geschlossen hat, an die Brust, zieht tief Luft ein und fügt nach ein paar Schritten hinzu: »Jeder wird klein und jämmerlich.«
Sie überqueren die Charlottenburger Chaussee. Die grünen Tarnnetze, die über die Chaussee ebenso wie über die Linden gespannt sind, um den feindlichen Bombern die Orientierung zu erschweren, knattern leise im Abendwind. Durch die Löcher des Netzes blitzt ein letztes magentafarbenes Abendrot.
»Tochter und Enkelin sind der Schlüssel. Wir müssen Frau Liebermann klarmachen, wie sehr beide die Sorge um ihre Mutter und Großmutter belastet, und dass ein Wiedersehen nur durch die Ausreise möglich ist. Hoffnungen auf ein baldiges Kriegsende könnten sie in Versuchung führen, abzuwarten. Doch danach sieht es im Moment nicht aus. Wenn Hitler den Russlandfeldzug gewinnt, ist das Regime auf Jahre, vielleicht Jahrzehnte stabilisiert.«
»Die Siegesmeldungen sind meiner Meinung nach alle nur Propaganda«, sagt Uexküll. »Die Schlacht ums russische Reich ist noch lange nicht gewonnen.« Er kenne das Land zu gut. Sein Reservoir an Menschen sei unerschöpflich, an Leidensfähigkeit auch. »Wenn der Winter kommt, wird sich das Blatt wenden, glauben Sie mir«.
»Wir sind nicht mehr in Napoleons Zeiten.«
»Nein, aber Russland ist nicht kleiner geworden, die Winter nicht weniger streng, die Straßen nicht viel besser. Der Nachschub wird das Problem werden.«
Er wolle auf eine Wende hoffen, auch wenn natürlich niemand Lust auf den russischen Bolschewismus habe, meint Bernstorff. Vielleicht sei die Angst davor noch der einzige Antrieb für den Rest an Kriegslust im Volk.
»Die einen hoffen auf Sieg und Schluss, die anderen auf Niederlage und Schluss«, seufzt Uexküll. »Kriegsbegeisterung hat nicht die gleiche Konjunktur wie 14–18. So weit reicht das Erinnerungsvermögen der Deutschen noch.« Gerüchte hätten sich dagegen zur geltenden Währung entwickelt. Jeder kenne ein neues: Separatfrieden mit England, Militärputsch von rechts. Überhaupt das Militär! Die Unzufriedenen hofften, die Offiziere würden es schon machen. Hitler sei überhaupt ahnungslos. Alle Schuld seinen Schergen. Wenn der Führer nur wüsste, was los sei! Der gute Mensch vom Obersalzberg.
Das Abendrot, plötzlich ausgeknipst, lässt ein fahles Rauchgrau zurück und ein wenig Helligkeit hinter dem Horizont. Gleich wird es stockfinster sein. Wegen der Verdunkelungsvorschrift ist die Straßenbeleuchtung ausgeschaltet. Bernstorff klemmt sich den Stock unter die Achsel und zieht eine Taschenlampe hervor.
»Geben Sie acht, nicht dass einer denkt, sie seien bewaffnet«, warnt Uexküll.
»Die Pistole habe ich in der anderen Tasche. Ich möchte mir in diesem Staat nicht noch ein Bein brechen, wenn schon der Hals in ständiger Gefahr ist.«
Der Taschenlampenstrahl zittert ihren Füßen voraus.
»Jedenfalls werden Devisen für Martha Liebermanns Flucht unerlässlich sein«, nimmt Uexküll den Faden wieder auf. »Alles, was sich in ihrer Wohnung befindet, ist längst registriert und kann nicht zu Geld gemacht werden.«
»Wir müssen jede Verbindung nutzen, vor allem Bürgen in der Schweiz oder Schweden finden. Und wie ist das nun mit der Kunstsammlung in der Schweiz?« fragt Bernstorff.
So viel er wisse, meint Uexküll, habe das Dr. Walter Feilchenfeldt organisiert. Er sei einer der Geschäftsführer der Galerie Cassirer gewesen, über die in erster Linie die Bilder Liebermanns verkauft worden seien. Seine Geschäftspartnerin Grethe Ring sei eine Nichte Martha Liebermanns. »Formidable Frau! Sie erinnern sich an den Fall Wacker, die Van-Gogh-Ausstellung 1928?! Angeblich alles Bilder aus russischem Privatbesitz und alle falsch. Es gab Expertisen von de la Faille und Meier-Graefe.« Aber Feilchenfeldt und Ring hätten sich nicht täuschen lassen. Vor allem Rings Auftreten vor Gericht sei ganz große Bühne gewesen. »33 mussten Ring und Feilchenfeldt liquidieren, jedenfalls sahen sie keine andere Möglichkeit, um einer Arisierung zuvorzukommen.«
»Und Ihre Verbindungen nach Schweden, Uex?«
»Max Liebermann war mit Anders Zorn, dem schwedischen Maler, befreundet. Seine Witwe lebt in Mittelschweden in Mora und kümmert sich um den Nachlass. Der müsste man schreiben und sie auf Martha Liebermanns Schicksal aufmerksam machen.«
Bernstorff hebt die Taschenlampe und strahlt das Standbild Otto des Faulen an. Der letzte Wittelsbacher auf preußischem Thron steht mit schlaff eingeknickter Hüfte, seine Mundwinkel hängen missmutig herab. »Otto der Faule ist mir immer der Liebste gewesen«, sagt Bernstorff, »weil Mensch. Die anderen sind doch alle nur Stein gewordene Ansprüche an ein Preußentum, das mir angesichts der heutigen Lage allerdings als kultiviert erscheint. Der Nationalsozialismus ist dagegen der Triumph des mittelmäßigen Mannes. Die Gefahr ist, dass er jede Form von Qualität hasst und alles auf sein hoffnungsloses Maß reduzieren möchte. – Und übrigens«, fährt er nach einer kurzen Pause fort, »ich liebe ihre Frau wirklich.«
Uex lächelt: »Ich weiß. Alle lieben meine Frau.«
Martha hat ihren Daumen als Lesezeichen zwischen die Seiten ihres Buches geklemmt und mit einem Seufzer innegehalten. Es ist ein Wunder, dass sie mit dieser Brille, die ein Optiker lange vor dem Krieg angefertigt hat, überhaupt noch etwas erkennen kann. Sie blinzelt in die Sonne, die tief stehend über den First des Nachbarhauses scheint. Heute ist es schwer, eine neue Brille zu bekommen. Alles ist heute schwer zu bekommen, nicht nur für Juden, aber für die besonders.
Das Reichswirtschaftsministerium bestimmt, dass Juden keine Kleiderkarten und keine Bezugsscheine für Textilien, Schuhe und Sohlenmaterial erhalten. Ihre Versorgung soll ausschließlich durch die Reichsvereinigung garantiert werden.
An manchen Tagen und wenn das Licht nicht gut ist, bemerkt sie nach einer Weile, dass sie nur noch aufs Papier starrt und aus den schwarzen Strichen, Bögen, Häkchen und Kreisen Sätze entziffert, die sie mehr träumt, als sie wirklich zu lesen. Es ist, als sei sie in ihre Kindheit zurückgekehrt, als sie voller Stolz aus den wenigen ihr bekannten Buchstaben Worte und Sätze erfand, die zu den Bildern auf den gegenüberliegenden Seiten passten. Ihr Vergnügen ist unverändert geblieben, die Seiten umzuwenden, das Papier zwischen den Fingerspitzen auf und ab gleiten zu lassen, Dünndruckpapier etwa, das beim Wenden flattert und ein wisperndes Geräusch erzeugt, während das dickere Bütten pelzig und steif sich sträubt und nur zu einem stumpfen Fauchen fähig ist.
Die Nachwelt werde sie dereinst für eine reizlose und hinfällige Person halten, hat Martha manchmal scherzhaft geklagt, weil Max sie auf seinen Bildern meist ruhend und lesen darstellte. Lesend hat sie versucht, das Leben zu begreifen, ohne die Abenteuer der Realität zu vermissen, bequem im Sessel, auf der Chaiselongue, im Liegestuhl oder auf einer Gartenbank sitzend, den Gedanken anderer folgend, wie durch ein Labyrinth mit exotischen und unbekannten Pflanzen, wilden Tieren und Abenteuern, die zu bestehen in ihrem Anspruch nicht geringer gewesen sind als das wahre Leben. Auch in der Graf-Spee-Straße haben sich ihre Gewohnheiten nicht verändert. Ihr Lesesessel hat hier seinen Platz im Türmchen gefunden, das, aus der Front des Hauses leicht vorspringend, die nördliche Ecke des Bauwerks markiert.
Im Herbst nach Max Tod ist sie in die Graf-Spee-Straße 23, Hochparterre, gezogen, eine großbürgerliche Flucht von vielen Zimmern mit allem Komfort. Es gab eine zentrale Gasheizung, einen Gaskühlschrank und einen Gasherd, natürlich Telefonanschluss. Heute wärmt die Gasheizung kaum noch. Der Hauswart hat Öfen aufgestellt. Und der Kühlschrank hat nichts mehr zu kühlen, auf dem Herd kochen Kartoffeln und Rüben. Von den Hausangestellten sind nur noch Marie Hagen und Alwine Walter übrig geblieben. Die anderen haben sich weniger aus Überzeugung, denn aus Furcht verabschiedet.
Aber am Anfang unterschied sich ihr Leben in der Graf-Spee-Straße noch wenig vom bisher gelebten. Besucher kamen, eine Ausstellung im Jüdischen Museum wurde anlässlich des ersten Todestags von Max zusammengestellt. Sie war ein großer Erfolg. 6.000 Liebermann-Freunde fanden sich ein, unter ihnen auch die treue Käthe Kollwitz. So hatte Martha sich das Witwendasein vorgestellt. Ausstellungen eröffnen, das eine oder andere verkaufen, das eine oder andere verleihen, Ruhm erhalten, mehren, es hätte ihre große Zeit werden sollen, Witwenherrschaft.
Martha setzt die Lesebrille ab. Draußen knattert ein dreirädriger Tempowagen vorbei, beladen mit Baumaterial für die japanische Botschaft am oberen Ende der Straße, die noch immer nicht ganz fertiggestellt ist. Schippen und Spitzhacken klappern auf der Pritsche.
Tempo, Tempo, sagt die Welt, Tempo, Tempo, Zeit ist Geld. Hast du keinen Tempowagen, wird die Konkurrenz dich schlagen.
Hinter dem lärmenden Gefährt fallen Blätter vom Baum und schweben beiläufig zu Boden, machen noch ein paar Zuckungen im aufgewirbelten Staub. Das Rumpeln und Knattern entfernt sich, wird leiser, bricht ab. Martha sieht auf die leere Straße hinaus. Die Sonne ist hinter dem gegenüberliegenden Haus verschwunden. Wie lange wird es dauern, bis draußen die nächste Bewegung stattfindet, bis ein Auto kommt, ein Mensch vorübergeht, das nächste Blatt fällt? Ihre Wahrnehmung der Außenwelt beschränkt sich seit Wochen auf diesen Ausschnitt, das Stück Straße, das Nachbarhaus, den Baum vor dem Fenster, das Pflaster und ein kleines Stück Himmel, wenn sie nahe an die Scheibe heranrückt und den Kopf nach oben dreht.
Die Verordnung über den Stern, den sie am Mantel tragen soll, ist vor etwa vier Wochen herausgekommen. »›Für L–Z‹«, las Marie Hagen aus dem Jüdischen Nachrichtenblatt vor, »›erfolgt die Ausjabe am Donnerstag, dem 18. September durchjehend von 8 bis 20 Uhr in den nachstehend anjejebenen Verteilungsstellen: für die Bewohner der Verwaltungsbezirke Charlottenburg und Tierjarten in der Synajoge Levetzowstraße oder in der Schule Joachimstaler Straße. Die Ausjabe erfolgt nur jejen Vorlegung des lila Bezugsausweises der Reichshauptstadt Berlin. Wer für andere mitbesorgt, muss deren lila Ausweis mitbringen und ihre jenaue Kennkartennummer mit Kennort. Die Ausjabe des Kennzeichens erfolgt jejen Zahlung von 0,10 RM. Jeder kann zunächst nur einen Stern erhalten.‹«
»Levetzowstraße, det ist zu weit, ick jeh inne Joachimstaler«, hat Marie gesagt.
»Ich brauche den Stern nicht.«
»Ick hol den. Wenn Se mal zum Arzt müssen.«
»Dr. Wolff kommt doch hierher.«
»Oder wenn Se mal een Besuch machen wollen.«
Aber seitdem ist Martha tatsächlich nicht mehr ausgegangen.
»Frau Professor, det is doch viel zu finster zum Lesen!« Marie hat die Tür aufgerissen, wie immer ohne zu klopfen. Sie schaltet das Licht an. »Na, und denn machen wir ooch gleich de Verdunkelung runter! Sonst jibt et Ärjer mit dem Blockwart.«
Die Person nimmt sich in letzter Zeit doch sehr viel heraus. Martha beschließt, strenger zu werden. Es klingelt. Marie geht öffnen. Sie meldet die Herren Uexküll und Bernstorff.
Noch am gleichen Abend schreibt Martha an Emma Zorn:
Hoffentlich haben Sie mich nicht ganz vergessen.
Aber das hat sie bestimmt nicht. Die Jahre, die man sich nicht gesehen hat, zählen kaum im Gedächtnis zweier alter Frauen, die seit dem Tod ihrer berühmten Männer nur noch nachleben.
Meine Bitte an Sie geht nun dahin, bei den schwedischen Behörden für mich gut zu sagen.
Von Emma Zorns Gesundheitszustand weiß Martha nichts. Emma ist doch sogar ein paar Jahre jünger als sie gewesen. Alter bekommt im Alter wieder eine größere Bedeutung. Man nennt seine Jahre mit Stolz, wie ein Kind. Immerhin weiß Martha, dass Emma Zorn lebt.
Ich denke noch gern an die guten Stunden, die wir in Paris und Berlin und zuletzt noch am Wannsee gemeinsam verlebten.
Anders Zorn hat es aus einfachsten Verhältnissen zu Wohlstand, Ansehen und Ruhm gebracht. Er hat amerikanische Präsidenten und russische Prinzessinnen porträtiert. Fleiß, Strebsamkeit, merkantiler Erfolg durch ehrliche Arbeit, Werte, die auch für Max galten, Kunst als hohes Handwerk, da war er mit Zorn auf einer Linie, auch wenn Max sich den Reichtum nicht hat erarbeiten müssen, dafür aber umso mehr den Erfolg. Emma stammte wie Martha aus wohlhabender jüdischer Familie.
Ich bin 84 Jahre alt und habe bis vor einigen Monaten niemals an eine Auswanderung gedacht.
Anders nannte sich einen schwedischen Bauer. Er war auf dem Hof seiner Großeltern aufgewachsen, das uneheliche Kind einer Saisonarbeiterin und eines deutschen Bierbrauers. Erfolg bestand für ihn aus Wohlleben und Wut auf seinen Vater, den er nie kennengelernt hatte. Seine Durchsetzungsfähigkeit war beinahe furchterregend, er zweifelte nie an sich.
In den 1890er-Jahren suchten Zorns so wie Max und Martha das Glück an einem Ort einzufangen. Das Haus nannten sie Zorngarden, der See hieß Siljan. Max und Martha waren mehrmals eingeladen. Sie dachten sich das Haus wie Anders, urwüchsig und gastlich, knisterndes Feuer, Trinkgelage an riesigen Holztischen aus einem Stamm gehauen. Sie reisten nie dorthin.
Aber mir ist jetzt die Situation unerträglich geworden, und ebenso wie die heutigen Verhältnisse unvorstellbar waren, ebenso ist es nicht möglich zu ahnen, was noch passieren kann.
Ob Emma überhaupt weiß, was in Deutschland passiert? Wenn sie noch klar im Kopf ist, dann weiß sie es, sie ist immer gut informiert gewesen, eine kritische, rational denkende Person, Gegenpol zu Anders instinktgesteuertem Wesen. Auf den ersten Blick passte sie gar nicht zu Anders, war viel zu fein, zu intellektuell und nicht besonders hübsch. Ein kleines jüdisches Mädchen mit Schlafzimmerblick und krausem Haar. Er lebte ungeniert seine Vorliebe für Modelle mit riesigen Busen und dicken Hintern aus. Aber beide wussten zu gut, was sie aneinander hatten. Emma lehrte Anders, sich in der bürgerlichen Welt zu bewegen, sie war seine Eintrittskarte in eine Gesellschaftsschicht, in der er seine Bilder verkaufen musste. Und er lehrte sie, ihren Mangel an Schönheit durch besonders extravagante Kleidung und Selbstbewusstsein auszugleichen. Bloß nicht wegducken, war seine Devise. Gemeinsam waren sie um die ganze Welt gereist. Einmal wäre Anders beinahe an Darmtyphus gestorben. Aber im nächsten Jahr fuhren sie schon wieder nach Algier. Emmas Wagemut entfachte noch jetzt in Martha so etwas wie Neid, ihr selbst war es nie gelungen, Grenzen zu überschreiten, sie brauchte es nie, jetzt fehlte ihr die Übung.
Ich danke jeden Morgen dem Schicksal, dass mein Mann diese Zeit nicht erlebt und dass meine Tochter mit Mann und Kind dies Land verlassen konnten, weil mein Schwiegersohn einen Ruf an die Universität in New York bekam.
Max bat Anders, ein Porträt Marthas zu malen. Der arbeitete stumm, ächzend wegen seiner Körperfülle, unter seinen Augen straffte sich Martha, saß sehr gerade. Max hielt sich fern, drückte sich im Arbeitszimmer herum, erst am Ende der Sitzungen kam er und begutachtete das Werk. Er hätte es bestimmt ganz anders gemacht.
Das Porträt zeigt eine nach außen gewandte Martha, schön stark und stolz. Er malte die Menschen von ihrer besten Seite. Das bescherte ihm seinen Erfolg.
Meine Bitte an Sie geht nun dahin, für mich bei den schwedischen Behörden gut zu sagen. Pekuniär liegt keine Schwierigkeit vor, denn meine Kinder werden natürlich für die Kosten meines Aufenthaltes dort aufkommen.
Für Max saß sie selten so lange Modell. Sie hintertrieb es im Grunde, sprang plötzlich auf, musste noch dies und das erledigen. Es war deshalb kein Wunder, dass ihr Mann lieber die Gelegenheiten nutzte, wo sie schlafend oder in ein Buch vertieft das Gemalt-werden nicht einmal bemerkte. Es konnte aber nicht wirklich an der fehlenden Zeit liegen. Es lag vielmehr an ihrer Unlust, sich in den Mittelpunkt zu stellen, den forschenden Blick auf sich zu ertragen, der den Schatten und dem Licht auf ihrem Körper folgte, und es dauerte einfach immer so entsetzlich lange.
Das Porträt, das Zorn von Max malte, erschreckte Martha. So war er doch nicht, so melancholisch, traurig, von der Welt enttäuscht? Aber später kam es so, da sollte er so werden. Auch Anders konnte in die Tiefe blicken.
Sobald ich näher weiß, um was ich sie eigentlich bitten soll, schreibe ich wieder, inzwischen wäre es mir eine große Freude, wenn Sie mir ein Wort der Einwilligung schickten. In aller Freundschaft und Verehrung.
Ihre Martha Liebermann.