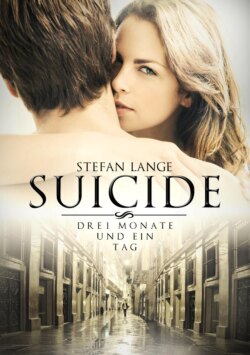Читать книгу Suicide - Stefan Lange - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
April – Mai 1994
ОглавлениеFranziska lernte ich in der ersten Woche kennen. Ich traf sie in der Bar an der Alameda, wo ich am ersten Schultag mein Frühstück eingenommen hatte. Dorthin gingen viele Schüler in der Pause oder nach dem Unterricht, um sich bei einem Kaffee zu sonnen oder zu plaudern. Franziska saß zufällig an meinem Tisch und beschwerte sich über das Niveau ihres Kurses. Für den dreiwöchigen Aufenthalt war ihr das stupide Wiederholen der Grammatik nicht ausreichend genug. Als Franziska erfuhr, daß ich einen Wirtschaftsspanischkurs besuchte, regte sich ihr Interesse und so erweiterte sich tags darauf unsere Gruppe um eine Schülerin. Franziska, eine in der Schweiz geborene Deutsche, studierte Wirtschaftspolitik in Wien. Sie war eine attraktive Erscheinung und obwohl wir heftig flirteten, hatte ich kein körperliches Interesse an ihr. Über unsere Bekanntschaft legte sich schnell eine seltsame Intimität. Wir verstanden uns, ohne viele Worte zu verlieren, egal über welches Thema wir miteinander sprachen. Wir lernten gemeinsam oder stürzten uns mit den anderen in das sevillanische Nachtleben, das selten vor zehn Uhr abends erwachte.
Ausgangspunkt der meisten Streifzüge war die Bar sopa de ganso, in der man Sprachschüler und Einheimische treffen konnte. Anschließend ging es in das Viertel rund um die Plaza Alfalfa oder zu den kleinen Bars an der El Salvador-Kirche. Auf den Stufen zum Gotteshaus und der Plaza del Salvador drängten sich gutgekleidete Sevillanos, Studenten, Artisten oder junge und hübsche Sevillanerinnen, die in hautengen Jeans vorbeistöckelten. Noch am späten Abend war es sommerlich warm, und auf dem Platz herrschte ein immenser Lärmpegel. Man trank Bier oder tinto de verano, ein Mixgetränk aus jungem Rotwein und Lemon. Die Abende ließen Andrew, Brian und ich in einer Bar, die vierundzwanzig Stunden am Tag geöffnet hatte und nur einen Steinwurf von der Residenz entfernt lag, ausklingen.
Andere Male zog es mich in das Viertel nahe der Giralda. Wenn sich der Abend gemächlich über die Stadt legte, wurde dieser Turm von einer Schar kreischender Vögel umschwärmt. In den engen Gassen, die wie ein Labyrinth wirkten, drängelten sich Gruppen von Menschen oder Paare turtelten auf ihrem Weg von einer Bar zur nächsten.
Ich würde mir Zeit nehmen, die Schönheit Sevillas zu entdecken. Auf den Straßen traf ich immer wieder Trauben von Touristen, überwiegend Amerikaner oder Japaner. Ich verachtete ein wenig diese Billigtouristen, die versuchten, Sevilla im Handstreich zu erobern. Sevillas Schönheit mußte man entdecken. Obwohl ich nicht sonderlich auf dem Gebiet der Kunst und Kultur bewandert war, hatte Sevilla so etwas wie Tradition, die man an vielen Ecken spürte. Die Stadt war reich an historischen Sehenswürdigkeiten. Ich war nicht hierhergekommen, um auf dem Pfad der Mauren zu wandeln, aber das Betrachten der Bauwerke löste geheimnisvolle Empfindungen in mir aus.
In Sevilla schrieb Cervantes seinen Don Quijote, der mir als Lektüre zu anspruchsvoll war. Wenn es einen spanischen Poeten gab, den ich schätzte, dann war es García Lorca: Der Dichter der unerfüllten Liebe. Die Liebe war etwas, mit dem Sevilla untrennbar verbunden schien. Auf der Straße begegnete ich vielen Liebespärchen. Die Menschen hatten stets ein Lächeln auf den Lippen, so als gäbe es nichts anderes als die Lust an der Liebe und dem Leben. Und auch im Tanz und im Gesang drückten sie die Liebe und Leidenschaft aus. Ich hatte den Eindruck, daß es hier in Sevilla etwas leichter und lockerer zuging als anderswo auf der Welt.
Ich feierte meinen neunundzwanzigsten Geburtstag. Zusammen mit meiner Gang und anderen Schülern zogen wir von der Residenz zur Bar Aula Magna, die mir von Lolo, Nastassias Freund, empfohlen worden war. Sie lag an einem winzigen Platz im Santa Cruz-Viertel. Es herrschte eine fröhliche und ausgelassene Stimmung, und die Party wurde für alle ein Vergnügen. Ich stand hinter dem Tresen und schenkte Bier aus. Mit unserer Gruppe von fünfundzwanzig Personen waren wir heute Abend fast die einzigen Gäste in diesem Lokal.
An manchen Geburtstagen wagte ich einen melancholischen Rückblick. Ich reflektierte über Vergangenes und ersann Zukünftiges. Mir wurde bewußt, daß sich die Zeit in Sevilla irgendwann dem Ende zuneigen und danach etwas Neues beginnen würde: Der Ernst des Lebens. Noch kurz vor meiner Abreise nach Spanien hatte ich ungefähr vierzig Bewerbungen auf Stellenangebote versandt, die mein Interesse geweckt hatten. Meist waren es Kandidaturen für internationale Traineeprogramme. Sicher war ich mir dennoch nicht. Ich verdrängte den Gedanken, daß mich etwas aus dieser Geborgenheit hier herausreißen könnte. Ich war nicht überglücklich, aber dennoch zufrieden.
Am achtzehnten April begann die Zeit der feria, der kulturelle Höhepunkt Sevillas, neben den berühmten Osterprozessionen. Die feria war ein gigantisches Volksfest, das seinen Ursprung in einer Handelsmesse hatte. Auf einem fast drei Quadratkilometer großen Areal befanden sich Kirmesattraktionen und die sogenannten casetas. Das waren Zelte, in denen die Sevillanos für eine Woche lebten, kochten, tanzten und feierten. Wohlhabende hatten ihre eigene caseta, andere schlossen sich mit mehreren Kompagnons zusammen oder griffen auf die großen casetas der Gewerkschaften und anderer Institutionen zurück. Die feria war übervölkert von Besuchern, und Lärm und Gesang drang aus den Zelten. Die Gassen trugen Namen von berühmten Stierkämpfern und waren nachts erleuchtet von tausenden rot-weißen Lampions. Tagsüber ritten caballeros mit ihren Pferden durch die Gassen und zeigten stolz ihre Braut, die hinter ihnen saß. Das Pferd gehörte hier genauso zum Alltagsbild wie der Stier. Überall sah man Frauen im Rüschenkleid. Einige wirkten mit ihren von Korkenzieherlocken eingerahmten Gesichtern wie Nachbildungen der Carmen.
Unsere Gruppe zog von caseta zu caseta, um die Sevillanos beim Tanzen und Feiern hautnah zu erleben. Ich hatte extra für diesen Anlaß einen Tanzkurs besucht, um die Grundschritte des sevillanas zu erlernen. Wenn ich die Menschen beobachtete und ihre Schritte und Bewegungen für diesen ausdrucksvollen Tanz nachahmte, fühlte ich mich nicht nur als stummer Beobachter, sondern war den Sevillanos auf sonderliche Weise verbunden, obwohl ich wußte, daß ich nicht zu ihnen gehörte, daß ich fremd war. Trotz dieses Umstandes fühlte ich mich hier wohler als zu Hause.
Die Tage verliefen stets im gleichen Rhythmus: Morgens Unterricht, am Nachmittag lernen und abends dann die marcha, so nannte man das Ausgehen. Mit Georg, Brian und Andrew verstand ich mich prächtig, und bei Franziska hatte ich den Eindruck, daß wir uns schon länger kannten.
Eines Abends, wir zogen durch das Triana-Viertel, philosophierten wir über das Thema Liebe und Freundschaft. Darüber hatte ich so meine eigenen Ansichten. Ich war der Meinung, daß es die Liebe, dieses starke Gefühl, nur im Film gab, zumindest bezog ich daher so manche Einstellungen. Ich könnte mit meinem Los eigentlich zufrieden sein. Ich hatte immer eine materielle Sicherheit in meinem Leben genossen und etwas erreicht, wovon manch einer träumen mochte. Aber ich wurde das Gefühl nicht los, daß mir etwas fehlte. In meinem Gefühlsspektrum herrschte eine gewisse emotionale Lücke. Liebe und Geborgenheit hatte ich seit meiner Kindheit entbehrt. Ich denke, daß mir meine Eltern nur das Mindeste mitgegeben hatten, um das Säuglingsalter zu überleben und später gefühlsmäßig nicht vollends zu verdursten. In Beziehungen konnte ich nie das nachholen, was ich vermißte. Die erste Freundin hatte ich, da ich glaubte, eine Freundin haben zu müssen, die zweite Beziehung war eigentlich mehr körperlicher Natur, weil ich mein Nachholbedürfnis an Zärtlichkeiten stillen wollte, und darauf folgten unbedeutende Liebeleien. Wirklich nahe war mir nie jemand gekommen. Sicher wäre es schön, eine Freundin zu haben, mit der ich mich auf körperlicher und geistiger Ebene austauschen könnte, der ich vertrauen und an die ich glauben könnte, die mich stützte, wenn ich wieder einmal in abgrundtiefer Traurigkeit versank, die mich motivierte und belebte. So einen Menschen gab es in meiner Vorstellung nicht. Ich hatte viele Macken in meinem Leben abbekommen, und oft wurde ich das Gefühl nicht los, daß ich zu schwierig sei. Es herrschte manchmal eine Widersprüchlichkeit im Denken und Handeln und mein Temperament war sprunghaft und unberechenbar. In mir lebten eigentlich zwei Seelen. Auf der einen Seite konnte ich eine Frohnatur sein, dann trieb wieder abgrundtiefer Haß nach oben. Vielleicht war es diesem Antrieb zu verdanken, weiter nach der wahren Liebe zu suchen. Es dauerte jeweils eine Zeitlang, bis die Enttäuschung, wieder nicht die Richtige gefunden zu haben, verdaut wurde. Dann suchte ich trotzig weiter und hoffte, die Eine irgendwann einmal finden zu können. Ein ewiger Traum in mir.
Meine Überzeugung, nicht liebenswürdig zu sein, wurde auch genährt durch meine negativen Erfahrungen. Ich hatte Angst vor der Nähe, denn zu oft wurde mein Innerstes verletzt, und ich wollte die schlafenden Schmerzen nicht wecken. Die Vorstellung, mich völlig gehen zu lassen, mich im Anderen zu verlieren, löste Unbehagen in mir aus. Könnte jemand meine ganze Persönlichkeit akzeptieren?
Ich hatte immer wieder von dem Wunder der Liebe gehört, das auf Menschen persönlichkeitsverändernd wirkte. Ich verfügte über ein nicht gerade ausgeprägtes Selbstwertgefühl, glaubte aber dennoch, daß die Richtige in der Lage wäre, mich aus meiner Isolation zu befreien. Eigentlich zog ich es vor, allein zu bleiben, bevor ich mich verletzen oder zurückweisen ließ. Im Grunde genommen war ich schüchtern, eine Tatsache, die mir bei meinem selbstbewußten Auftreten niemand so recht glauben mochte.
Sicher hatte ich mich schon einmal verliebt. Gefühle von Sehnsucht waren mir nicht unbekannt, aber manchmal beging ich auch den Fehler, eine harmlose Verliebtheit mit der großen Liebe zu verwechseln. In Constanza hatte ich einen Menschen gefunden, der sich sehr um mich bemühte. Vielleicht war ich damals gar nicht in sie verliebt gewesen, wünschte mir aber, es zu sein, weil ich ihr nah sein wollte. Bei Constanza hatte ich erstmals den Eindruck, daß jemand wirklich zu mir hielt und sich Sorgen machte. Aber wie das Schicksal es wollte, aus unseren Plänen, gemeinsam eine längere Zeit in Spanien zu verleben, wurde nichts. Constanza hatte einen Freund, zu dem es sie hinzog.
Im Austausch mit anderen beleuchtete ich eher die negative Seite des Gefühlsspektrums. Sehnsucht, Eifersucht und schmerzliches Verlassenwerden waren die Themen. Sicher war ich nicht unbeliebt. Ich war in meinem Leben auch interessanten Frauen begegnet, aber am Ende wurden wir immer nur gute Freunde. Ich haßte es.
Nach und nach hatte sich bei mir die Erkenntnis durchgesetzt, daß ich die Liebe eines Menschen nicht verdient hatte, daß ich über kurz oder lang alleine bleiben würde; ein Los, mit dem ich mich eigentlich seit langem abgefunden hatte.
Ende April trat Franziska die Heimreise an, und ich versprach, mit ihr in Kontakt zu bleiben.
Das darauffolgende letzte Aprilwochenende verbrachte ich mit Brian und Andrew in Nerja, einem kleinen Touristenort an der Costa del Sol. Wir fuhren mit Brians Auto über die Autobahn nach Málaga und nahmen von dort aus die Küstenstraße nach Nerja. Bei lauter Musik und heruntergekurbelten Fenstern ließen wir uns den heißen Wind durch die Haare fahren. In Nerja angekommen, stürzten wir uns ins Meer, tranken Bier am Strand, genossen die Sonne und hatten gemeinsam viel Spaß. Es tat gut, einmal für ein paar Tage aus Sevilla herausgekommen zu sein.
Brian kannte den Ort gut, da er hier im Vorjahr eine Sprachschule besucht hatte. Als kompetenter Führer wußte er, wo abends die chicas anzutreffen waren und wo es die besten Drinks und gute Musik gab.
Die ausgelassene Stimmung wurde an diesem Sonntag, dem 1. Mai, getrübt. Brian, begeisterter Formel 1-Fan, betrauerte den Tod seines Idols Ayrton Senna, der sein Leben beim großen Preis von San Marino in Imola ließ. Wir philosophierten über das Leben und den Tod und waren uns darüber einig, daß der Tod den Menschen, die bereits zu Lebzeiten Legenden waren, noch eine zusätzliche Mystik verlieh.
Obwohl der Montag noch schulfrei war, beschlossen wir, bereits am Sonntagabend nach Hause zu fahren. Ich wollte den freien Tag für die Wiederholung des Stoffes nutzen, zudem türmten sich in meinem Zimmer Berge von Hausarbeiten. Wir ließen das schöne Wochenende, mittlerweile hatte sich Brians Gemütszustand wieder gebessert, in unserer Vierundzwanzigstundenbar ausklingen, ein wenig zu heftig und viel zu lang, denn erst gegen fünf Uhr morgens torkelte ich ins Bett.