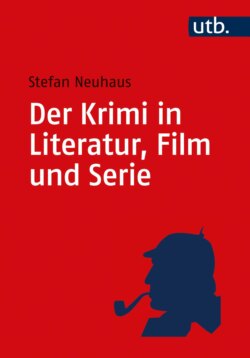Читать книгу Der Krimi in Literatur, Film und Serie - Stefan Neuhaus - Страница 10
2.4 Diskurse von (poetischer) Gerechtigkeit
ОглавлениеAdolf LoosLoos, Adolf hat 1908 einen drastischen Vergleich gezogen: „Das kind ist amoralisch. Der papua ist es für uns auch. Der papua schlachtet seine feinde ab und verzehrt sie. Er ist kein verbrecher. Wenn aber der moderne mensch jemanden abschlachtet und verzehrt, so ist er ein verbrecher oder ein degenerierter“ (Loos 2019, 10). Loos macht zurecht darauf aufmerksam, dass die Auffassung von dem, was als Verbrechen gilt, zeit- und kulturabhängig ist – und sein Text illustriert dies gleich unfreiwillig durch die höchst problematische Perspektive auf ‚das‘ Kind als amoralisch und auf ‚den‘ Papua als ‚das Andere‘. Auch literarische Texte verhalten sich entsprechend zu den Normen und Werten der Zeit, zugleich lassen sie sich aber – als der Kunst zugehörend und somit potenziell überzeitlich rezipierbar – auch auf die Normen und Werte der jeweiligen Rezeptionszeit beziehen.
Literatur macht die Leser*innen immer auch zu Richter*innen über das Verhalten der Figuren: „The literary judge […] is committed to neutrality; properly understood“ (Nussbaum 1995, 86). Allerdings beeinflusst der Text mit seiner Strategie, Handlung und Figuren in (s)einer spezifischen Weise zu präsentieren, das Urteilsvermögen; manchmal wird dies – je nach Anlage des Texts – bei der Lektüre offensichtlicher, manchmal weniger offensichtlich. SchillerSchiller, Friedrich beispielsweise zeigt in Der Verbrecher aus verlorener EhreDer Verbrecher aus verlorener Ehre deutlich, dass die Taten des Protagonisten vor allem auf die sozialen Rahmenbedingungen zurückzuführen sind, auf seine Herkunft und das Verhalten anderer ihm gegenüber. Aus dieser Sicht erscheint das Urteil am Schluss als ungerecht.
Zudem ist festzuhalten, dass der Krimi auch deshalb ein besonders anspruchsvolles künstlerisches Genre sein kann, weil er durch seine Rätselstruktur immer auch nach einem übergeordneten Sinn fragen und auf diese Weise nicht nur sich selbst als Literatur, sondern auch den Konstruktionscharakter von Wirklichkeit thematisieren kann:
In der Detektivliteratur, die die Wahrheit künstlich unzugänglich macht, wird der besondere Zugang des fiktionalen Diskurses zu dem, was in ihm als wahr ausgesagt werden kann, gewissermaßen noch einmal in die Fiktion eingeführt. Ihre Entstehungsbedingungen betreffen daher den Status des fiktionalen Diskurses selbst, nämlich die Art und Weise, in der er sich schließt. (Niehaus 2003, 375)
Beispiele für die Metafiktionalität von Krimis werden immer wieder zu nennen sein, ohne dass auf diesen Aspekt genauer eingegangen werden könnte (zu Literatur und Metafiktion vgl. v.a. die Arbeit von Mader 2017). Die Dreifachstruktur ‚generelle außersprachliche Realität – konkrete gesellschaftlich-kulturelle Realität – fiktionale Realität‘ ist noch durch eine dreifache zeitliche Struktur zu ergänzen: ‚Zeit der Handlung – Zeit der Entstehung und Veröffentlichung – Zeit der Rezeption‘. Dies wird im Krimi besonders am Beispiel von Normen verhandelt. Es betrifft nicht nur Gesetze, sondern auch Verhaltensweisen, also juristische wie moralische Normen, die sich durch die Zeit verändern oder innerhalb einer Zeit als im Wortsinn frag-würdig dargestellt werden können.
Schon allein die Frage nach dem, was unter Gerechtigkeit verstanden werden kann, eröffnet ein schier unermessliches Diskurspotenzial:
Keine andere Frage ist so leidenschaftlich erörtert, für keine andere Frage so viel kostbares Blut, so viel bittere Tränen vergossen worden, über keine andere Frage haben die erlauchtesten Geister – von Platon bis Kant – so tief gegrübelt. Und doch ist diese Frage heute so unbeantwortet wie je. Vielleicht, weil es eine jener Fragen ist, für die die resignierte Weisheit gilt, dass der Mensch nie eine endgültige Antwort finden, sondern nur suchen kann, besser zu fragen. (Kelsen 2016, 9)
Die Vokabel ‚resigniert‘ ist angesichts des ursprünglichen Veröffentlichungsdatums von Hans Kelsens Schrift – 1953 – nur zu verständlich, steckte doch allen noch der Schrecken des Krieges und des Holocausts ganz unmittelbar in den Knochen. Aus heutiger Sicht scheint – abgesehen von zentralen Werten, wie sie in der UN-Menschenrechtscharta festgelegt sind – die Pluralität von Meinungen eher eine Stärke demokratisch verfasster Gesellschaften zu sein. Auch die, wie sie korrekt heißt, „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“, eine rechtlich nicht bindende Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen von 1948, lässt noch genug Spielraum für Interpretationen und Adaptionen.
Das angesprochene Diskurspotenzial kann sich in der Literatur, die bekanntlich nicht an die Grenzen der Realität gebunden ist, noch einmal vervielfachen und es wird zu zeigen sein, dass die Antworten nicht nur zeitlich und kulturell bedingt sehr unterschiedlich ausfallen können, sondern dass sie auch immer, angesichts der Individualität der Protagonist*innen des Verbrechens und seiner bei aller Vergleichbarkeit stets vorhandenen Singularität, eine gewisse Unschärfe aufweisen. Gerade Literatur hat, weil sie polykontextuell, polyperspektivisch angelegt und polyvalent ist, das Potenzial, darauf aufmerksam zu machen: „literature and the literary imagination are subversive“ (Nussbaum 1995, 2). Es hilft auch nichts, wenn eine spezifische Auffassung von Gerechtigkeit vorausgesetzt wird. Damit würde nur, wie in der Trivialliteratur üblich, überdeckt, dass es hinter dieser Setzung keine überzeugende Begründung gibt.
Wenn es um Gerechtigkeit geht, lässt sich etwa die sogenannte Goldene Regel anführen: „Was du nicht willst, das man dir tue, das tue auch einem anderen nicht; oder, positiv ausgedrückt: Was du willst, dass [sic] man dir tue, das tue du auch den anderen“ (Kelsen 2016, 34f.). Das Problem ist nur, dass Menschen unterschiedliche Wünsche und Vorstellungen haben. Das kennen wir bereits vom Schenken an Geburtstagen und an Weihnachten: Wenn wir das verschenken, das wir selber gern geschenkt bekommen würden, können wir fast sicher sein, dass die oder der Beschenkte sich nicht freut. Immanuel Kant hat mit dem Kategorischen Imperativ versucht, die Regel etwas anspruchsvoller auszuführen: „Der kategorische Imperativ ist also nur ein einziger, und zwar dieser: handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, daß sie ein allgemeines Gesetz werde“ (Kant 1974, 51). Doch auch hier ist die Individualität der entscheidende Störfaktor: Wenn ich möchte, dass der Staat stärker Schokolade subventioniert als Brot, dann haben nur diejenigen etwas davon, die wie ich gern Schokolade essen.
Auch die Frage nach dem Einsatz von Gewalt wird so fragwürdig, etwa Gewalt gegen Frauen, die bis vor nicht allzu langer Zeit staatlich legitimiert war, etwa wenn der Ehemann sein angebliches Recht auf Beischlaf ausübte, oder Gewalt gegen Kinder, wenn es in der Schule und später dann immerhin noch innerhalb der Familie bis vor nicht allzu langer Zeit erlaubt war, Kinder körperlich zu züchtigen. Immer noch gibt es Gesetzgebungen, die fragen lassen, ob sie das Gewaltmonopol des Staates nicht missbrauchen – etwa wenn die Abtreibungsgegner weiterhin bestimmen können, dass Abtreibungskliniken und -ärzte nicht durch Werbung auf sich aufmerksam machen dürfen.
Michel FoucaultFoucault, Michel hat hierfür die Begriffe der Bio-Macht und der Bio-Politik geprägt:
Die Fortpflanzung, die Geburten- und die Sterblichkeitsrate, das Gesundheitsniveau, die Lebensdauer, die Langlebigkeit mit allen ihren Variationsbedingungen wurden zum Gegenstand eingreifender Maßnahmen und regulierender Kontrollen: Bio-Politik der Bevölkerung. Die Disziplinen des Körpers und die Regulierungen der Bevölkerung bilden die beiden Pole, um die herum sich die Macht zum Leben organisiert hat. (Foucault 1983, 166)
Foucault hat weiter festgestellt: „[…] verschiedenste Techniken zur Unterwerfung der Körper und zur Kontrolle der Bevölkerungen schießen aus dem Boden und eröffnen die Ära einer ‚Bio-Macht‘“ (Foucault 1983, 167). Nun ist es Aufgabe des Staates, der auch in den westlichen Demokratien immer noch ein Gewaltmonopol hat (wie sollte es sinnvoll an Einzelne delegiert werden?), Regelungen zu finden, die das Individuum auch in seiner körperlichen Integrität und Selbstbestimmtheit möglichst schützen. Doch wie weit muss man das Individuum vor sich selbst schützen, etwa durch Verbote von Drogen oder durch hohe Steuern auf Tabak? Wieviel Zwang darf der Staat im Interesse der Gemeinschaft aller Bürger auf größere oder kleinere Gruppen oder auch auf einzelne Individuen ausüben?
Ferdinand von SchirachSchirach, Ferdinand von, der auch berühmte Kriminalerzählungen und -romane geschrieben hat, hat in seinem Theaterstück Terror von 2015 – unter dem Titel Terror – Ihr UrteilTerror – Ihr Urteil von Lars KraumeKraume, Lars verfilmt und 2016 in der ARD, zeitgleich im ORF und im SRF ausgestrahlt – die Frage gestellt (und durch das Publikum beantworten lassen), ob die Bundeswehr ein von Terroristen entführtes Passagierflugzeug abschießen darf, das die Terroristen in einem vollbesetzen Fußballstadion zum Absturz bringen wollen. Darf der Staat aktiv werden und unschuldige Passagiere töten, um eine größere Zahl unschuldiger Fußballfans zu retten?
Die skizzierten Fragen nach dem Verhältnis von individuellen und gruppen- oder staatsspezifischen Interessen spielen bei der Motivierung und bei der Beurteilung von Verbrechen eine zentrale Rolle. Ulla HahnHahn, Ulla schildert in ihrem Debütroman Ein Mann im HausEin Mann im Haus (1991) den Fall einer Frau, die ihren Geliebten, der ihr immer wieder vorgelogen hat, er werde für sie seine Frau verlassen, in einen Keller sperrt, vergewaltigt und foltert, bis sie ihn schließlich, solchermaßen physisch und psychisch gedemütigt, wieder freilässt. Hier stellt sich die Frage nach der poetischen Gerechtigkeit: Die Sympathien der Leserinnen, aber sicher auch der aufgeklärten Leser werden bei der Protagonistin Maria Wartmann sein, eingedenk einer langen Tradition straffreier Misshandlungen von Frauen durch Männer und des rücksichtslosen Verhaltens Hans Egons, des örtlichen Küsters und Chorleiters. Dazu kommt die bereits in der Namensgebung und Berufsbezeichnung erkennbare Ironie der Schilderung, die ebenso wie die kunstvolle Sprache gegen einen banalen Realismus arbeitet und so Reflexionsanreize setzt.
Gerechtigkeit und poetische Gerechtigkeit sind demnach zu unterscheiden, zumal es sich bei Figuren nicht um Menschen handelt und literarische Texte oder Filme Versuchsanordnungen bieten, die vielleicht an mögliche Fälle in der Realität angelehnt sind, sich aber nicht genau so in der Realität zugetragen haben oder zutragen werden.