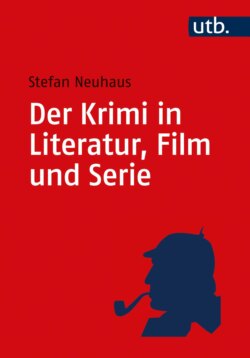Читать книгу Der Krimi in Literatur, Film und Serie - Stefan Neuhaus - Страница 12
2.6 Zuschreibungen von Gut und Böse
ОглавлениеBei der Frage danach, was aus welchen Gründen als ‚gut‘ oder ‚böse‘ einzustufen ist, handelt es sich um einen komplexen Diskurs, der hier nicht genauer nachgezeichnet werden kann (Schäfer 2014). Einige Hinweise müssen genügen. Was zugrunde gelegt werden soll, lässt sich vorab in fünf Punkten zusammenfassen:
1 Das ‚Böse‘ oder das ‚Gute‘ gibt es nicht, beides sind zeit- und kulturabhängige Diskursprodukte.
2 Es gibt dennoch jeweils einen zeit- und kulturabhängigen Konsens darüber, was als ‚das Böse‘ oder ‚das Gute‘ einzustufen ist.
3 ‚Gut‘ und ‚Böse‘ bedingt sich wechselseitig. Dies ist bereits im Christentum Grundlage des Glaubens und wird beispielsweise im Gedanken der Theodizee (etwa bei Gottfried Wilhelm Leibniz) näher ausgeführt. Dass es ein ‚Gutes‘ gibt, setzt die Existenz des ‚Bösen‘ voraus.
4 Seit der Aufklärung setzt sich die Auffassung durch, dass sich der Mensch (mehr oder weniger) frei für ‚das Gute‘ oder ‚das Böse‘ entscheiden kann. Immanuel Kants kategorischer Imperativ fußt auf dieser Annahme. Wenn man so handelt, dass das eigene Handeln zur Maxime des Handelns aller werden könnte, dann lebt man in der besten aller Welten – vorausgesetzt, der Mensch hat und folgt (s)einem Willen zum ‚Guten‘.
5 Der Minimalkonsens aufgeklärter Gesellschaften ist in den 30 Artikeln der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR) zusammengefasst, einer rechtlich nicht bindenden Resolution der Vereinten Nationen, die 1948 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen in Paris verkündet wurde.
Die Resolution stammt nicht zufällig von 1948. Nach dem 2. Weltkrieg bekommt ‚das Böse‘ eine andere Qualität und es hat ein Gesicht – Adolf HitlerHitler, Adolf und den Nationalsozialismus. Der Holocaust gilt zurecht als ‚das Böse‘, handelt es sich doch um einen millionenfachen, industriell organisierten Massenmord und um das bisher schlimmste Verbrechen der Menschheit.
Der Diskurs über Auschwitz als die Tat ‚des Bösen‘ hat sich indes weiter verselbständigt, etwa in der Auseinandersetzung über Hannah Arendts Begriff der „Banalität des Bösen“ (Arendt 2015). Bisher ist der Diskurs stark polarisierend. Der des Antisemitismus beschuldigte Martin WalserWalser, Martin (Lorenz 2005) beispielsweise hat immer wieder, wie etwa Dieter BorchmeyerBorchmeyer, Dieter am Beispiel von Walsers Essays Unser AuschwitzUnser Auschwitz von 1965 und Auschwitz und kein EndeAuschwitz und kein Ende von 1979 gezeigt hat, auf einer durch den Holocaust in die Welt gekommenen und niemals endenden Schuld bestanden:
Der provozierende Titel Unser Auschwitz ist eine Parallelbildung zu Thomas Manns Bruder Hitler und insistiert darauf, daß jeder von uns an Auschwitz seinen Anteil hat. [ ] Und die Rede Auschwitz und kein Ende beginnt mit dem denkwürdigen Satz: „Seit Auschwitz ist noch kein Tag vergangen.“ Auch hier zählt Walser sich und „uns“ der „Volksgemeinschaft der Täter“ zu, wehrt er sich gegen den Wahn, „uns durch Strafverfolgung [ ] entlasten zu können“, den Versuch, die „Schuld“ an Auschwitz „auf eine Handvoll Schergen“ zu delegieren. [ ] Nicht zu vergessen ist die Tatsache, daß Walser es war, der 1989 in der Sächsischen Landesbibliothek von Dresden auf die Tagebücher des jüdischen Romanisten Victor Klemperer stieß und deren Publikation nachdrücklich beförderte. (Borchmeyer 2003, 46f.)
Auch in der berüchtigten Rede zur Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels 1998 hat Martin WalserWalser, Martin unmissverständlich festgehalten: „Ich habe es nie für möglich gehalten, die Seite der Beschuldigten zu verlassen“ (Walser 1999, 11). Und weiter: „Kein ernstzunehmender Mensch leugnet Auschwitz; kein noch zurechnungsfähiger Mensch deutelt an der Grauenhaftigkeit von Auschwitz herum […]“ (Walser 1999, 11f.). Walser hat sich nicht gegen das Gedenken an den Holocaust wenden wollen, ganz im Gegenteil: Er hat sich für ein lebendiges und frisches Gedenken eingesetzt, das er allerdings von einem ritualisierten und dadurch ein Stück weit entlastenden Gedenken absetzt. In diesem Zusammenhang fällt auch der polemisch gebrauchte Begriff der „Moralkeule“: „Auschwitz eignet sich nicht dafür, Drohroutine zu werden, jederzeit einsetzbares Einschüchterungsmittel oder Moralkeule oder auch nur Pflichtübung. Was durch solche Ritualisierung zustande kommt, ist von der Qualität Lippengebet“ (Walser 1999, 13). Die Rezeption der als tendenziell antisemitisch (miss-)verstandenen Rede ist komplex (Neuhaus 2004) und zeigt, dass Walser vor allem durch die Drastik seiner Worte ein Tabu gebrochen hat. An diesem Beispiel ist gut zu erkennen, dass nicht nur die Frage, was als ‚gut‘ und ‚böse‘ gilt, diskursabhängig ist, sondern auch die Wortwahl, in der darüber gesprochen wird.
Wenn man sich die Zeit vor 1933 vorzustellen versucht und den Holocaust nicht als notwendige, sondern als mögliche Folge der Entwicklungen bis zur Machtergreifung der Nationalsozialisten sieht, dann muss zunächst die Fluidität des Bösen in den Blick genommen werden. Dass die Grenzen zwischen ‚gut‘ und ‚böse‘ fließend sind, hat bereits Fritz LangLang, Fritz in einem seiner Kommentare zu MM herausgestellt: „The only conclusion I can draw from this is that we human beings know how frail the barriers are in us between good and evil and once we understand another human being, however horrible he may be, we say, ‚There but for the grace of God go I‘“ (zit. nach Bareiter / Büttner 2010, 187). Langs Kommentar zeigt auch, dass Immanuel Kants idealistische Vorstellung vom freien Willen des vernünftig sich seines Verstandes bedienenden Menschen, der sich für das ‚Gute‘ als das sittlich und moralisch Richtige und nicht für das ‚Böse‘ zu entscheiden vermag, zu kurz greift.
Dennoch hat, das demonstriert das Weltgeschehen ebenso wie das Genre des Krimis, KantKant, Immanuels kategorischer Imperativ nichts von seiner Brisanz verloren, so dass er hier noch einmal zitiert wird: „Der kategorische Imperativ ist also nur ein einziger, und zwar dieser: handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, daß sie ein allgemeines Gesetz werde“ (Kant 1974, 51). In dem Fall gäbe es, so die Annahme, einen bestmöglichen Ausgleich zwischen den Interessen der Individuen, selbstbestimmt zu handeln. Allerdings stellt uns der kategorische Imperativ vor vier Probleme:
1 Nicht alle Menschen sind gleich, sie haben unterschiedliche Ziele und Interessen.
2 Wenn die Tat eines Verbrechers zum allgemeinen Gesetz würde, dann würde Chaos herrschen.
3 Wenn die Gesetze so formuliert wären und befolgt würden, dass die Interessen aller Menschen bestmöglich berücksichtigt wären, dann müsste die gesetzgebende Instanz nicht nur gottähnliche Fähigkeiten haben, sondern möglicherweise noch größere (insofern man die bestehenden Zustände einem unwilligen Gott anlasten wollte), denn wer sollte alle Interessen aller Menschen kennen und in der Lage sein, einen solchen Ausgleich herbeizuführen?
4 Der von KantKant, Immanuel angenommene Hang des Menschen zum Guten ist doch sehr zweifelhaft, auch und gerade, wenn man die Triebhaftigkeit des Menschen berücksichtigt. Kant hat das Problem selbst gesehen und versucht zu lösen, aber die Annahme, es sei beim Menschen prinzipiell von „einem frei handelnden Wesen“ auszugehen (Schäfer 2014, 212) und ‚böses‘ Handeln „entspringt aus der Gebrechlichkeit der menschlichen Natur, zu Befolgung seiner genommenen Grundsätze nicht stark genug zu sein“ (Schäfer 2014, 215), greift leider zu kurz.
Friedrich NietzscheNietzsche, Friedrich hatte für einen solchen Idealismus nur Spott übrig:
Diese Art Mensch hat den Glauben an das indifferente wahlfreie ‚Subjekt‘ nöthig aus einem Instinkte der Selbsterhaltung, Selbstbejahung heraus, in dem jede Lüge sich zu heiligen pflegt. Das Subjekt (oder, dass wir populärer reden, die Seele) ist vielleicht deshalb bis jetzt auf Erden der beste Glaubenssatz gewesen, weil er der Überzahl der Sterblichen, den Schwachen und Niedergedrückten jeder Art, jene sublime Selbstbetrügerei ermöglichte, die Schwäche selbst als Freiheit, ihr So- und So-sein als Verdienst auszulegen. (Schäfer 2014, 281)
Doch auch dies ist ‚nur‘ eine Annahme, eine Setzung, eine mögliche Sicht auf ‚das Böse‘. Die „Entdeckung der Zeichensprache des Triebs“ als „wesentliche[s] Element des Bösen“ (Alt 2010, 22) legt dagegen zweierlei nahe: Erstens, dass nicht leicht zu steuernde, egoistische Motivationen und die mit ihnen zusammenhängenden Emotionen eine große Rolle bei ‚bösen‘ Handlungen spielen; und zweitens, dass die Frage der Beurteilung dessen, was ‚böse‘ ist, von der Übersetzung in einen Code (in eine „Zeichensprache“) nicht zu trennen ist.
‚Das Böse‘ kann eigentlich nur, will man sich darüber diskursiv auseinandersetzen, als Code beschrieben, es kann nur auf der Basis seiner Codierung überhaupt als solches erkannt und eingestuft werden. Literatur und Film können insofern als „textuell vermittelte Ästhetik des Bösen“ (Alt 2010, 30) ‚das Böse‘ als dynamischen Prozess sichtbar machen und, wenn es sich um Fiktionen handelt, zugleich auch seine Kontingenz hervorheben.