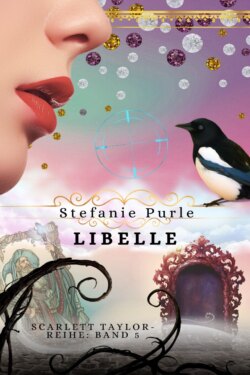Читать книгу Scarlett Taylor - Libelle - Stefanie Purle - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 7
ОглавлениеIch schaffe es, alle weiteren Gespräche über das Reisebüro und den Hexenladen auf einen Zeitpunkt zu verschieben, an dem wir sicher wissen, ob wir das Haus bekommen oder nicht. So entgehe ich den eventuell aufkommenden Gedanken zu den Diamanten und meinem Abkommen mit Juwelier Marder, die Kitty wahrscheinlich wieder laut hinausposaunt hätte.
Stattdessen reden wir über alte und neue Aufträge. Naomi ruft mich zur Seite und berichtet mir von dem Auftrag, zu dem ich sie letzte Woche geschickt habe. Es ging um eine ältere Dame dessen Mann vor Kurzem verstorben war. Sie brauchte die Hilfe von jemandem, der mit den Toten kommunizieren kann. Zuerst hatte ich an Kitty gedacht, jedoch erschien mir unsere Schamanin Naomi für die Witwe mit der brüchigen Stimme besser geeignet. Naomi ist einfach einfühlsamer mit den Lebenden. Außerdem ging es der alten Dame nicht darum, den Geist ihres Mannes ins Licht zu schicken, sondern sie wollte mit ihm in Kontakt treten, und darin ist Naomi die Beste.
„Ich brauche dabei unbedingt deine Hilfe“, sagt die Schamanin, als wir uns separat an einen Zweiertisch gesetzt haben.
Ich bin überrascht. „Meine Hilfe?“, hake ich nach und blicke unbewusst bereits in Kittys Richtung, die noch bei den Männern sitzt und sich mit Berny darüber streitet, wer am besten für einen bestimmten Auftrag geeignet ist.
„Ja, deine Hilfe“, betont sie und legt ihre Hand auf mein Handgelenk, was meine Aufmerksamkeit wieder auf sie lenkt. „Die Hilfe einer Hexe.“
„Ach ja?“ Meine Neugierde ist geweckt.
Sie nickt, nimmt die Hand von meiner und stützt sich mit den Ellenbogen auf dem Tisch ab. „Der verstorbene Mann der Frau war eine Hexe. Eine dunkle Hexe.“
Das erstaunt mich. Davon hatte die Frau am Telefon nichts erwähnt. „Und sie? Ist sie auch eine Hexe?“
„Nein, sie ist menschlich.“
Ich stutze. „Das ist selten, oder? Hexen werden doch viel älter als Menschen.“
„Ja, sie war seine dritte Ehefrau. Sie hätte nie gedacht, dass sie ihn überlebt, aber so ist es nun mal geschehen. Sie selbst ist schon neunundachtzig Jahre alt, sie hatten ein langes und erfülltes Leben miteinander.“
„Und wozu brauchst du mich nun?“
Naomi beginnt mit einem ihrer zwei hüftlangen Zöpfe zu spielen, in den Federn, türkisfarbene Bänder und Perlen eingeflochten sind. „Sie musste ihren verstorbenen Mann kontaktieren, um herauszufinden, wo er sein Testament und die Unterlagen der Lebensversicherung verwahrt. Sie hatte bereits alles abgesucht, war aber nicht fündig geworden. Ich habe den Geist des Mannes dann gerufen und so gemerkt, dass er eine dunkle Hexe war. Seine Frau hatte nichts davon erwähnt.“
„Wahrscheinlich war sie sich nicht sicher, inwiefern wir über die magische Welt Bescheid wissen“, mutmaße ich und Naomi stimmt mir durch ein Nicken zu.
„Als ich ihn als dunkle Hexe erkannte, war sie schon viel entspannter. Sie ließ mich fragen, wo er die Unterlagen versteckt hat. Sein Geist führte uns zu einer Kiste, die nur mit Magie geöffnet werden kann.“
„Oh, jetzt verstehe ich wozu du meine Hilfe brauchst.“
Sie nickt und grinst. „Der Zauberspruch ist in das Holz der Kiste geschnitzt, doch wenn ich ihn spreche, passiert rein gar nichts.“
Ich kann mir ein Lachen nicht verkneifen. „Wie oft hast du es versucht?“
Nun lacht sie auch und klatscht mit der Handfläche gegen ihre Stirn. „Sehr oft“, gibt sie zu. „Die Witwe und ich haben den Spruch gesprochen, gesungen und verschieden betont, doch nichts geschah. Ich habe dann Fletcher angerufen, doch da er eine weiße Hexe ist, konnte er uns auch nicht helfen.“
„Also bleibe nur noch ich übrig“, schließe ich urteilsfrei daraus und zucke mit den Achseln. Die Zeiten, in denen ich mich für meine dunkle Seite geschämt habe, sind weitgehend vorbei. Nur wenn ich zu lange mit meiner Tante Roberta zusammen bin, plagen mich manchmal noch Gewissensbisse. Aber ich habe mittlerweile verstanden, dass zur Hälfte dunkel zu sein nicht bedeutet, böse zu sein. Genauso wie weiße Hexen nicht ausschließlich gut sind. Es sind nur zwei Seiten der Magie und ich habe das Glück, mich beiden bedienen zu dürfen.
„Hilfst du mir?“, unterbricht Naomi meine Gedanken.
„Natürlich helfe ich dir“, antworte ich und spüre einen kleinen Funken Stolz in mir aufflammen. „Wann soll es losgehen?“
Nachdem wir alle zusammen etwas im Booh zu Mittag gegessen haben, verladen wir Naomis Fahrrad in meinen Bulli. Es regnet wieder einmal in Strömen und bevor Naomi und ich zum Haus der Witwe aufbrechen, muss sie noch etwas aus ihrer Wohnung holen und ihre Katzen füttern. Kitty rauscht mit ihrem Sportwagen an uns vorbei und spritzt mit ihren Reifen eine Wasserfontäne in unsere Richtung. Chris und ich können noch im letzten Moment nach hinten springen und der Welle entgehen.
„Kitty!“, schreit Chris verärgert, doch ich bezweifle, dass Kitty beim Aufheulen ihres Motors etwas gehört hat.
„Ärgere dich nicht über sie“, sage ich und blicke zum grauen Himmel empor. „Wir sind eh schon klitschnass.“
Chris verdreht die Augen und umfasst meine Mitte. Mit einem Ruck zieht er mich zu sich heran. „So kann auch nur eine Druidenhexe reden“, sagt er und schüttelt sein nasses Haar aus.
Ich beginne zu kichern und kneife die Augen zu, damit mir keine Tropfen in die Augen fliegen. „Und sich schütteln wie ein Hund kann nur ein Mannwolf“, necke ich ihn und ernte ein grollendes Knurren an meiner Halsbeuge von ihm.
„Wann sehen wir uns wieder?“, fragt er, nachdem er meinen Hals wieder freigegeben hat.
„Keine Ahnung“, sage ich und zucke mit den Schultern. „Wenn ich mit Naomi bei der Witwe fertig bin. So in drei oder vier Stunden wahrscheinlich.“
Chris nickt und ich beobachte, wie sich ein Regentropfen von seiner Haarspitze löst und auf seine Wange tropft, wo sie sich einen Weg zu seinem verführerischen Mundwinkel bahnt. Ich stelle mich auf die Zehenspitzen und ziele mit meinen Lippen genau auf diesen Tropfen, doch im letzten Moment dreht Chris leicht den Kopf und unsere Lippen begegnen sich. Er seufzt in meinen Mund, was mir, trotz der Kälte und Nässe, einen warmen Schauer über den Rücken jagt.
Nach einem innigen Kuss lehnt er seine Stirn gegen meine und schließt die Augen. „Drei oder vier Stunden noch?“
Heißes Kribbeln gleitet über mein Brustbein. „Ich beeile mich, okay?“
Seine Hände liegen auf meinem unteren Rücken und er presst mich noch etwas fester an sich. „Ich kann es kaum erwarten.“
Naomi muss mich auf der Fahrt zu ihrer Wohnung navigieren, da ich noch nie bei ihr zuhause war. Offenbar wohnt sie außerhalb des Ortes in einem alten Bauernhaus, umgeben von Feldern, Baumalleen, Pferdeweiden und holprigen Feldwegen. Der Bulli knallt von einem Schlagloch ins nächste, braune Matschbrühe spritzt hoch bis zu den Fensterscheiben.
„Die nächste rechts, dann sind wir auch schon da“, sagt Naomi, als ich beim nächsten Schlagloch ächzend mit dem Kopf gegen die Decke knalle. „Hier, da ist es schon!“
Ich lenke den Bulli auf eine Schottereinfahrt und parke neben dem Haus vor einem grünen Dielentor. Naomi springt raus, rennt um den Bulli herum auf eine kleine, weiße Haustür zu. Sie hat die Tür geöffnet, bevor ich auch nur aussteigen kann. Mit schnellen Schritten komme ich ihr durch den dichten Regen hinterher und stolpere dabei fast über eine schwarze Katze, die fauchend meinen Weg kreuzt.
„Oh, Entschuldigung“, murmle ich und gehe mit der Katze zusammen ins Haus.
„Ach, das ist Blanche, die ist immer so zickig, das hat nichts mit dir zu tun“, sagt Naomi, die noch immer die Haustür offenhält und nach draußen blickt.
Nach und nach flitzen immer mehr Katzen ins Haus. Ein rot getigertes Exemplar lugt unter meinem Bulli hervor und sieht uns aus großen grünen Augen mauzend an.
„Na, komm! Komm her!“, ruft Naomi und klopft auf ihren Oberschenkel.
Nach einem protestierenden Miau traut sie sich endlich und flitzt durch den Regen ins Haus. Naomi schließt die Tür und knippst das Flurlicht an. Um unsere Beine streichen ein halbes Dutzend Katzen in den verschiedensten Farben. Ein Konzert aus wohligem Geschnurre und forderndem Mauzen dringt in unsere Ohren.
„Sind das alles deine?“, frage ich und beuge mich zu einer weiß-getigerten herunter, die euphorisch ihre pelzige Wange an meinem Hosenbein reibt.
„Mehr oder weniger, ja“, antwortet Naomi und geht an mir vorbei, wobei die Mehrheit der Katzen ihr folgt.
Ich hebe die Getigerte auf meinen Arm und gehe hinter Naomi her, während die Katze ihr Gesicht an meiner Jacke reibt und wieder zu Schnurren beginnt, als ich ihren Nacken kraule.
Wir kommen in eine Küche, die aus wild zusammengewürfelten Möbeln besteht. Beinahe jeder Küchenschrank hat eine andere Front, kein Stuhl passt zum anderen und doch wirkt es urgemütlich. In einer Ecke steht ein Stangenherd in dem noch der Rest eines Feuers glüht, dessen Wärme uns willkommen heißt. Ich setze die Katze ab und ziehe meine Jacke aus. Naomi geht währenddessen zum Kühlschrank und holt einen Emailletopf heraus mit dem sie zum Herd geht. Sie stellt ihn darauf, holt einen Kochlöffel und beginnt darin zu rühren. Dann öffnet sie die Feuerluke, nimmt einen Holzscheit aus dem Weidenkorb neben dem Herd und wirft ihn hinein.
Die Katzen verteilen sich im Raum, ein paar springen auf die Stühle, setzen sich hin und beobachten Naomi. Eine andere streicht ihr um die Beine, eine weitere schnüffelt am Weidenkorb und noch eine springt auf die Fensterbank, wo ein zusammengefaltetes Handtuch liegt, auf das sie sich hinsetzt.
„Wie kommst du denn zu so vielen Katzen?“, frage ich sie mit hörbarer Begeisterung in der Stimme.
Naomi rührt in dem Topf herum, während das Feuerholz im Inneren des Herdes leise knistert. „Es sind nicht immer so viele, manchmal sind es noch mehr, manchmal aber auch weniger. Sie kommen und gehen, wie es ihnen gefällt, das liegt in ihrer Natur. Ich kümmere mich um sie, wenn sie meine Hilfe brauchen. Manche bleiben dann einfach hier, andere ziehen weiter und gehen ihrer Wege.“
„Sie laufen dir einfach so zu?“, hake ich nach und setze mich auf einen freien Stuhl am Kopf des Tisches.
Draußen peitscht der Sturm um das Haus und verbiegt die Spitzen der hohen Erlen, die die Einfahrt säumen. Die Gardine vorm Fenster bewegt sich gespenstisch im Zug des Windes, doch das Feuer vom Ofen wärmt uns hier drinnen schön durch.
Naomi zieht den Topf vom Herd und stellt ihn auf ein Holzbrettchen, das scheinbar dafür parat auf dem Tisch steht. „Manche von ihnen waren schon hier, als ich hierherzog. Aber die anderen sind mir zugelaufen, ja.“ Sie zieht eine Schublade unter dem Tisch auf und holt einen Stapel Plastiknäpfe hervor. „Es spricht sich in Katzenkreisen schnell rum, wo es gutes Essen gibt“, sagt sie mit einem Lächeln auf den Lippen und befüllt den ersten Napf mit dem angewärmten Inhalt des Topfes.
Der Geruch von Blut und gekochtem Fleisch liegt in der Luft und ich beuge mich vor, um zu sehen, was sie den Tieren da in die Näpfe füllt. „Was fütterst du ihnen denn?“
„Ich koche ihr Futter selbst. Hier ist Leber und Herz von Rindern und Hühnern drin, Kaninchenohren, Hüttenkäse, Ei, Kartoffeln und Rapsöl.“
Ich muss schlucken. „Klingt lecker.“
Sie lacht. „Nein, tut es nicht“, gibt sie zu und hat auch den letzten Napf gefüllt.
Die Katzen wissen anscheinend, was nun folgt, denn alle versammeln sich zu ihren Füßen und mauzen aufgeregt. Sie stellt immer zwei Näpfe hin und dirigiert die Katzen zu den jeweiligen Näpfen. Als alle versorgt sind, nimmt sie neben mir am Tisch Platz.
Ich betrachte die hungrigen Vierbeiner, die sich schmatzend über das Futter hermachen. „Ich finde es echt toll, dass du sie fütterst.“
Sie blickt auch zu ihnen hinunter und lächelt milde. „Weißt du, wenn man indianische Wurzeln hat, dann ehrt und respektiert man seine Krafttiere automatisch. Und als Schamanin, die mit Geistern spricht, ist es doch nur natürlich, dass ich den Katzen, also den irdischen Verwandten der Bastet, meinen Dank erweise.“
„Bastet…“, wiederhole ich nachdenklich. „Ist das nicht eine ägyptische Gottheit? Die mit dem Katzenkopf?“
Naomi nickt. „Stimmt genau. Sie ist die Wächterin über die Seelen der Toten.“
„Aber… Sie ist doch eine ägyptische Gottheit, keine indianische… Oder?“, stottere ich ein wenig verwirrt.
Sie legt den Kopf schief und für einen Moment kräuselt sich ihre Stirn. „Ich bin keine Indianerin, Scarlett. Auch wenn ich so aussehe.“
Meine Wangen werden rot. Natürlich ist sie keine Indianerin, das weiß ich. Obwohl ihr langes dunkles Haar, die zimtfarbene Haut und die dunklen Augen natürlich den Anschein erwecken, sie sei eine amerikanische Ureinwohnerin.
„Tut mir leid“, sagt sie plötzlich und legt sanft ihre Fingerspitzen auf meinen Handrücken. „Ich wollte dich nicht in Verlegenheit bringen.“
„Nein, nein, schon gut. Das hast du nicht. Es ist nur…“, stammle ich und schaue hinab zu den Katzen, da es einfacher ist, sie zu fixieren, als Naomis Blick zu begegnen.
„Wir hatten noch nicht wirklich die Gelegenheit uns kennenzulernen, nicht wahr?“
Sie spricht mir aus der Seele und ich schaffe es, wieder in ihre Augen zu schauen. „Ja, das stimmt. Wir arbeiten schon mehr als ein Jahr zusammen, aber ich weiß so gut wie nichts von dir.“
Lächelnd nickt sie mir zu. „Geht mir genauso“, stimmt sie zu und lehnt sich zurück. „Wir könnten ein wenig von unserem Kennenlernen bei einer Tasse Tee nachholen. Bis zum Treffen mit der alten Dame haben wir noch eine halbe Stunde Zeit.“
„Gute Idee.“
Sie erzählt mir, dass ihr Vater ein Stammesmitglied der Hoopa-Indianer in Kalifornien war und ihre Mutter eine Roma, die die Gabe des Wahrsagens besaß. Sie hat die Fähigkeiten beider geerbt, war sich dessen aber lange Zeit nicht bewusst. Ihre Eltern starben bei einem Autounfall, als Naomi sechs Jahre alt war. Danach fingen ihre Visionen an, die als posttraumatische Halluzinationen mit Tendenz zur Schizophrenie eingestuft wurden. Erst als sie älter wurde, verstand sie selbst, dass sie nicht verrückt, sondern hellsichtig war und mit Verstorbenen reden konnte.
Ich lausche ihren Erzählungen, während der Regen gegen die Fensterscheibe trommelt und die Katzen wohlig schnurrend und satt um unsere Beine streichen. Der Tee ist eine Mischung aus Schwarztee mit Zimt und Nelken, der uns von innen heraus wärmt.
„Es war nicht immer leicht, und es gibt eine Menge Stationen in meinem Lebenslauf, die ich lieber streichen würde“, sagt sie und seufzt, doch dann kehrt das Lächeln auf ihre Lippen zurück und ihre dunklen Augen glänzen. „Aber all das hat mich zu dem Menschen geformt, der ich heute bin.“
Bewundernd nehme ich den Stolz in ihrer Haltung wahr und nicke. „Es scheint fast so, als hätte jeder, der in unserer Branche arbeitet, einen steinigen Weg hinter sich gebracht“, bemerke ich und blicke nachdenklich auf den letzten Schluck Tee in meiner Tasse.
„Oh ja“, stimmt Naomi mir zu und lacht. „Manchmal denke ich, ein hartes Leben ist sowas wie ein Eignungstest für unseren Job. Kommt man mit den irdischen Problemen zurecht und überwindet sie, dann ist man auch bereit für das Überirdische!“
Ich stimme in ihr Lachen ein. „Da könntest du recht haben!“
Sie bittet mich, auch den letzten Schluck Tee zu trinken und nimmt mir dann die Tasse aus der Hand, wobei sie eine Handfläche über die Öffnung hält. „Soll ich dir den Teesatz lesen?“
Ich blinzle mehrmals verdutzt, nicke dann aber interessiert. „Ja, wenn du magst.“
Lächelnd beginnt sie die Tasse im Uhrzeigersinn zu drehen, dann schließt sie für einen Moment die Augen und im nächsten Moment stülpt sie die Tasse über meinen Unterteller. Ihr Zeigefinger kreist über dem Porzellan und sie murmelt ein paar Worte in einer mir unbekannten Sprache. Dann pustet sie über die Tasse, nimmt sie wieder auf und blickt hinein.
„Hmm“, brummt sie nachdenklich und runzelt die Stirn.
„Was ist?“, hake ich ungeduldig und ein wenig besorgt nach. „Siehst du was Schlimmes?“
Sie sieht auf und ihre Augen blicken seltsam starr in die Ferne. „Libelle“, haucht sie, ohne zu blinzeln. „Libelle.“
„Was… Was meinst du damit?“
Ihre Pupille scheint die gesamte Iris zu verdrängen. „Libelle“, sagt sie zum dritten Mal, dann blinzelt sie und ihre Augen sehen wieder ganz normal aus. Sie schaut mich an. „Was habe ich gesagt?“
Ich schlucke und fühle mich plötzlich unwohl. „Libelle“, antworte ich. „Du hast dreimal hintereinander Libelle gesagt.“
„Mehr nicht?“
„Nein. Was bedeutet das? Wofür steht die Libelle?“
Sie blickt wieder in die Tasse und zuckt mit den Schultern. „Ich sehe hier keine Libelle“, sagt sie, sichtlich verwirrt. „Und du bist sicher, dass ich Libelle gesagt habe?“
Ich nicke mehrmals hintereinander. „Ja, Libelle. Drei Mal.“
Sie schüttelt mit dem Kopf, sodass die eingeflochtenen Federn über ihre Schultern schwingen. „Hier sehe ich keine Libelle. Aber dafür einen Mond und die Krone. Das steht für plötzlichen Wohlstand und Gewinn. Vielleicht solltest du Lotto spielen!“
Ich begegne ihrem Blick, kann ihr strahlendes Lächeln aber nicht erwidern. „Wofür würde die Libelle stehen?“
Ihre Lippen formen sich zu einer schmalen Linie. „Am ehesten für Leichtigkeit und Akrobatik. Aber auch für die Verbindung zwischen dieser Welt und der Anderswelt, für spirituellen Kontakt.“
Wir sehen einander nachdenklich an, dann beginnt sie wieder zu lächeln. „Vielleicht ist das ein gutes Omen für unseren Termin bei der alten Dame! Immerhin war ihr Mann eine Hexe, und du bist schließlich auch zum Teil eine.“
Mir ist bewusst, dass ihre Fröhlichkeit nur aufgesetzt ist. Irgendwas versucht sie zu überspielen. Ich sehe zu, wie sie den Rest ihres Tees mit zwei großen Schlucken hinunterkippt und dann aufsteht.
„Wollen wir dann los?“, fragt sie und zieht den Reißverschluss ihres Sweatshirts nach oben.
Ich erhebe mich und nehme meine Jacke von der Stuhllehne. „Natürlich, lass uns gehen.“