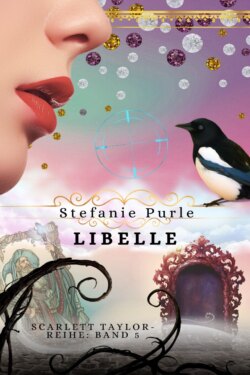Читать книгу Scarlett Taylor - Libelle - Stefanie Purle - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 1
ОглавлениеDer Herbst kam mit dem Ostwind zusammen und pustete innerhalb weniger Tage auch den letzten Rest des Sommers davon. Den Himmel sieht man jetzt nur noch in eine Decke aus grauen Wolken eingehüllt, die den Regen, der uns im Sommer fehlte, jetzt doppelt und dreifach nachliefern. Das Wasser sammelt sich in dreckigen Pfützen, auf denen braun-orange Blätter wie unförmige Boote dahinsegeln. Unter meinen Füßen knacken Eicheln und Kastanien, die auf dem Bürgersteig verstreut liegen. Die Äste der Bäume sind schon fast kahl. Es sieht aus, als versuchen sie mit ihren dürren Fingern die Wolkendecke beiseite zu schieben, um endlich wieder etwas von der wärmespendenden Sonne zu sehen. Doch leider gelingt es ihnen nicht. Stattdessen peitscht der Wind auch die letzten Blätter von ihren Zweigen und lässt sie wie ein Konfettiregen aus Rot, Orange, Braun und Gelb zu Boden schweben.
Ich bin auf dem Weg zu einem Treffen mit meiner Tante Elvira. Sie hat mir gestern eine SMS geschrieben und mich zu einem letzten Eis in der örtlichen Eisdiele eingeladen, bevor nächste Woche die Saison beendet ist. Zuerst wollte ich mit dem Bulli fahren, doch dann habe ich es mir beim Anblick der letzten bunten Herbstblätter in den Baumwipfeln anders überlegt. Ich liebe diese Jahreszeit. Erst recht, seitdem ich eine Hexe, oder besser gesagt eine Druidenhexe bin. Für mich hat jede Jahreszeit ihren eigenen Reiz, doch die Farben des Herbstes mag ich am liebsten und nutze deshalb jede Möglichkeit, um draußen zu sein. So habe ich viel mehr Gelegenheit, das herumwirbelnde Laub zu betrachten, dem Ruf der Krähen zu lauschen und den typisch erdigen Duft des Herbstes zu genießen.
Ein eisiger Windhauch fegt über die Straße hinweg und ich klappe den Kragen meines weinroten Wollmantels hoch. Meine Jackentaschen sind voll mit glänzenden Kastanien und besonders schönen Eicheln. Gerade als ich mich bücke, um eine weitere Kastanie aufzuheben, höre ich Elvira meinen Namen rufen.
„Scarlett! Hier bin ich!“
Ich blicke auf und sehe sie an der gegenüberliegenden Straßenseite stehen. Sie steckt in einem Ungetüm von hellblauem Steppmantel und hat einen ewig langen weißen Schal um ihren Hals gewickelt, dessen Enden vom Wind in alle Richtungen gezerrt werden.
„Hey Elvira!“, rufe ich zurück und schaue über die Straße. „Warte, ich komme.“
Sie nimmt mich in den Arm, sobald ich sie erreicht habe und drückt mich fest. „Schön, dass du Zeit hattest“, sagt sie und blickt mich an. „Neuer Mantel?“
„Ja“, antworte ich und kann nicht umhin, ihre glasigen Augen zu bemerken. „Alles okay bei dir?“
„Ja, ja, natürlich“, sagt sie rasch und wischt über ihre Augen. „Der Wind.“
Dann hakt sie sich bei mir ein und wir laufen die restlichen hundert Meter zur Eisdiele gemeinsam.
Der Fahrradstand, der noch vor knapp zwei Wochen kaum genügend Platz für all die bunten Kinderfahrräder bot, ist nun leer, bis auf ein einzelnes schwarzes Herrenrad, das vom Wind in Schräglage versetzt wurde. Vor dem Eingang, wo sonst mehrere Tische mit Rattan-Stühlen standen, steht nun nichts mehr außer einem ausgeblichenen Plastik-Sonnenschirmständer, um den der Wind kleine Laubhaufen herum drapiert.
Wir gehen hinein und Elvira lotst mich zu einer Nische im hinteren Bereich des Raumes. Schweigend endledigen wir uns unserer Jacken und ich spüre ein seltsames Unbehagen in mir aufsteigen. Elvira ist so anders als sonst, ihre ganze Haltung wirkt angespannt.
„Und du bist sicher, dass mit dir alles okay ist?“, frage ich, als wir uns setzen.
Sie nickt, ohne mich anzusehen, doch dann geht ihr Nicken in ein Schulterzucken und schließlich in Kopfschütteln über.
„Was ist los?“ Ich strecke die Hand über den Tisch aus, doch sie verbirgt ihre Hände in ihrem Schoß.
Mit einem halbherzigen Lächeln sieht sie mich endlich an und holt Luft. „Ich muss dir etwas sagen“, überwindet sie sich schließlich.
Sofort mache ich mir Sorgen. „Ist was mit Mama? Geht es ihr gut? Geht es dir gut?“
„Ja, ja“, beruhigt sie mich und senkt die Lider. „Es geht uns gut.“
Erleichtert lehne ich mich zurück. „Was ist es dann? Was musst du mir sagen?“
Wieder holt sie Luft und reibt ihre Hände unter dem Tisch, vermutlich um sie aufzuwärmen und gleichzeitig Zeit zu schinden. Man kann deutlich sehen, dass sie mit sich hadert.
„Na los, nun spuck schon aus“, fordere ich sie auf und lache, doch sie stimmt nicht in mein Lachen ein, sondern sieht mich ernst an.
„Ella und ich werden umziehen.“
Blinzelnd begegne ich ihrem Blick, während ich die Information verarbeite. „Okay… Wird Mama das Gästezimmer zu klein?“
Elvira schüttelt mit dem Kopf. „Nein. Wir werden wegziehen. Weg von hier.“
Für einen Moment scheint die Zeit stillzustehen. „Weg von hier“, wiederhole ich murmelnd und Elvira nickt. „Und wohin?“
„Ella möchte an die Küste, sie wollte schon immer ans Meer.“
„An die Küste?“, unterbreche ich meine Tante lautstark.
Der Kellner schaut verdutzt und neugierig zu uns, auch die wenigen Gäste drehen sich zu uns um.
„Ja, an die Küste. Rund drei Stunden Fahrt von hier.“
Ich verstehe es nicht und schüttle mit dem Kopf. „Aber wieso? Warum so weit weg?“ Meine Stimme klingt weinerlich, obwohl ich eher verwundert als traurig bin.
„Ich denke, die Küstenluft wird Ella guttun. Sie muss mehr raus, braucht mehr Bewegung. Sie kann nicht den ganzen Tag nur auf diesem Sessel sitzen!“
„Das sehe ich genauso“, antworte ich. „Aber das kann sie doch auch hier! Sie kann genauso gut hier spazieren gehen.“
Meine Tante schüttelt mit dem Kopf. Ihr graues Haar mit den auffallend weißen Strähnen, die vom Töten hunderter dunkler Wesen herrühren, fällt in ihr Gesicht. Sie streicht es sich hinter die Ohren, bevor sie mich ernst ansieht. „Nein, das kann sie nicht“, sagt sie. „Nicht hier.“
Es dauert ein wenig, bis es in meinem Kopf Klick macht. Dabei ist es nicht so, dass ich mir der Tatsache, dass meine Mutter Angst vor mir und meinesgleichen hat, nicht bewusst wäre. Es ist eher so, dass ich mir diesen Gedanken nicht zugestehen mag, da es einfach zu weh tut.
„Weil wir hier sind“, sage ich und mache eine ausladende Handbewegung, die alle magischen Wesen im Ort mit einschließen soll.
Elvira nickt und legt mit einem mitleidigen Blick den Kopf schief. „Es tut mir leid, Scarlett“, sagt sie und schiebt die Unterlippe vor. „Ich habe wirklich geglaubt, dass sie einfach nur Zeit braucht. Aber sie braucht nicht nur Zeit, sondern auch Abstand, so wie es aussieht.“
Ich senke den Blick und blinzle die Tränen weg, die langsam meinen Blick verschleiern wollen. Wie viele Tränen habe ich in meinem Leben schon um meine Mutter geweint? Es müssen Milliarden gewesen sein. Erst habe ich sie vor knapp zehn Jahren durch den Fluch meines Vaters ans Wachkoma verloren, und dann, nachdem endlich der Fluch gebrochen wurde, habe ich sie erneut verloren, weil sie eine tief verwurzelte Angst und Abneigung gegen magische Wesen wie mir hat.
Und nun verliere ich sie schon wieder.
„Und warum konnte sie mir das nicht persönlich sagen?“, frage ich und wische eine Träne von meiner Wange. „Warum schickt sie dich vor?“
„Das weißt du doch. Sie kann es nicht. Es ist alles zu viel für sie.“
Ja, das weiß ich. Alles ist zu viel für meine Mutter, seitdem sie aus dem Koma erwacht ist. Das Leben an sich ist für sie zur Bürde geworden. Alles ist neu, unbekannt und beängstigend für sie.
„Was darf ich Ihnen bringen?“, unterbricht der Kellner unser Gespräch in dem Moment, als wir beide mit gesenkten Köpfen schweigend dasitzen.
Elvira räuspert sich und holt die Eiskarte heran. „Den Nussbecher und eine Cola bitte“, ordert sie und schiebt mir dann die Karte über den Tisch.
Ohne den Kellner, die Karte oder Elvira anzusehen, bestelle ich nur einen Vanille Latte. Den hätte ich auch Zuhause haben können, aber ich habe jetzt keine Lust mir ein Eis auszusuchen.
„Bist du sicher, dass du kein Eis willst?“
„Ja“, antworte ich patzig und starre aus dem Fenster, wo das Laub wirbelnd über den Parkplatz fegt.
„Scarlett, bitte-“,
„Ich habe jetzt keine Lust auf Eis“, unterbreche ich sie ein weiteres Mal und verschränke die Arme vor der Brust.
Der Kellner nickt und entfernt sich rasch.
„Du benimmst dich wie ein bockiges Kind“, zischt Elvira leise mahnend.
Mit vor Wut zusammengepressten Lippen funkle ich sie an. „Und was ist mit dir? Willst du auch weg von hier? Weg von mir?“
Das letzte Wort bleibt mir fast im Halse stecken, woraufhin meine Tante ihre tadelnde Haltung fallenlässt und stattdessen wieder diesen mitleidigen Blick aufsetzt.
„Ach, Scarlett“, seufzt sie. „Ich will doch nicht weg von dir.“ Sie senkt nachdenklich die Lider und scheint ihre Worte abzuwiegen. Dann gleitet ihr Blick zum Fenster. „Aber weißt du, dieser Ort…“
„Was ist mit dem Ort?“
Ein paar weitere Sekunden schaut sie noch den herumwirbelnden Blättern auf dem Parkplatz zu, dann stützt sie die Unterarme auf den Tisch und blickt auf ihre gefalteten Hände.
„Ich habe mich knapp achtundzwanzig Jahre lang dem Paranormalen gewidmet. Ich habe das Parapsychologenbüro geleitet, hatte ein Team bestehend aus Mannwölfen, Medien, Schamanen, Hexen und etlichen Parapsychologen“, erzählt sie und ich frage mich, worauf sie eigentlich hinauswill. „Ich hatte es mit Geistern zu tun, die in der Schule spukten, auf die ich selbst einst gegangen bin. Ich habe gesehen, wie der Sohn meines Postboten von einem Dämon besessen war, wie er Innereien aus einer halbtoten Ziege gefressen hat! Ich musste mitansehen, wie meine Friseuse sich in einen dunklen Vampir verliebte und beinahe selbst zu einem geworden wäre, hätte ich ihn nicht getötet!“
Sie schüttelt mit dem Kopf und schließt die Augen. „Ich habe den Geist der Mutter der Supermarktkassiererin ins Jenseits geschickt, und sie weiß noch nicht einmal davon. Ich war auf der Beerdigung meines Schulfreundes, der offiziell bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Ich war die einzige, die wusste, was wirklich geschehen ist: Er wurde von einem Werwolfsrudel in Stücke gerissen. Ich selbst habe es wie einen Autounfall aussehen lassen.“
Ich höre ihr schweigend zu, warte ab, bis sie auf den Punkt kommt.
Sie seufzt und drückt Daumen und Zeigefinger gegen ihre Augenlider. Ihre Schultern sind herabgesackt, plötzlich wirkt sie auf mich älter als sie eigentlich ist. Dann nimmt sie die Hand herunter und sieht mich aus geröteten Augen an.
„Ich wollte das alles nicht, Scarlett. Ich bin in dieses Milieu hineingerutscht, weil ich deinen Vater dabei beobachtet habe, wie er durch das Tor beim alten Gut hindurchging und sich in Luft auflöste. Es war ein Portal, wie ich heute weiß. Und als er deine Mutter dann schwanger sitzengelassen hat, wollte ich Rache. Doch ich hatte keine Ahnung, auf was ich mich da einließ. Plötzlich war ich mittendrin und eins führte zum anderen.“
Der Kellner kommt mit Elviras Eis, der Cola und meinem Vanilla Latte herbei und wir schweigen. Sein Lächeln und fröhliches Geplapper dringen zu keinem von uns durch, weswegen er mit einem missmutigen Schnauben den Bon auf den Tisch wirft und zurück hinter seine Theke geht.
„Als Ella dann einen Tag vor deinem achtzehnten Geburtstag ins Koma fiel, hatte ich so eine Ahnung, woran es lag. Mir war gleich klar, dass es ein Fluch ist. Und meine Kontakte zur magischen Welt bestätigten es irgendwann dann auch. Jeder wusste Bescheid darüber, doch kaum einer traute sich, es auszusprechen. Doch nun war ich noch wütender auf deinen Vater! Nicht nur, dass er Ella und dich vor deiner Geburt verlassen hatte, er hatte meine Schwester nun auch noch ins Koma gelegt!“
„Ja, ich weiß das alles“, melde ich mich wieder zu Wort. „Aber der schwarze König ist tot! Er ist keine Gefahr mehr.“
Sie gibt ein ironisches Lachen von sich. „Als wenn er das einzige Problem wäre, Scarlett.“ Kopfschüttelnd und mit einem falschen Lächeln auf den Lippen macht sie eine ausladende Handbewegung. „Sie sind überall! Der ganze Ort ist voll von Erinnerungen an die letzten neunundzwanzig Jahre! Hinter jeder Ecke lauert etwas!“
Ich kann nicht anders, als sie mit Unverständnis anzublicken. „Ich finde, du kannst stolz auf das sein, was du geleistet hast“, sage ich in ruhigem Ton, da wir erneut die Aufmerksamkeit aller Gäste auf uns gezogen haben. „Du hast die Welt ein ganzes Stück besser gemacht.“
Jetzt schnaubt sie und vergräbt ihr Gesicht in den Händen. „Das mag sein“, murmelt sie in ihre Handflächen hinein. „Aber für mich ist es, als sei ich in einem immerwährenden Albtraum gefangen.“
Einige Atemzüge lang sagt keiner von uns etwas. Die Gespräche im Raum nehmen wieder zu, Löffelklappern und Tassenklirren mischen sich zu einem monotonen Rauschen.
„Elvira… Ich hatte keine Ahnung, dass es dir so damit geht“, sage ich schließlich, ehrlich schockiert, und bin versucht nach ihrer Hand zu greifen, lasse es dann aber sein.
Sie nimmt die Hände von ihrem Gesicht und streicht sich die Haare hinter die Ohren. „Die Parapsychologie war nie mein Gebiet. Es ging mir immer nur darum, meine Familie zu schützen.“ Wieder seufzt sie und wirkt dabei matt und müde. „Ich musste so viele Menschen anlügen, was meinen Beruf anging. Nie konnte ich wirklich jemanden an mich heranlassen, ohne zu riskieren, sie in Gefahr zu bringen.“ Sie sieht mich an und in ihren Augen sehe ich ein stummes Flehen. „Ich denke, es ist an der Zeit, dass ich auch mal an mich denke.“
Mein Kopf bewegt sich automatisch zu einem Nicken. Ich verstehe sie, auch wenn ich nicht so empfinde. Noch nicht. Vielleicht wird mir das Paranormale auch irgendwann zu viel. Womöglich ist meine Neugierde eines Tages gestillt und ich empfinde die Welt auch als einen Ort, an dem hinter jeder Ecke Monster lauern.
Allerdings bin ich selbst eines dieser Monster.
„Und mit Mama an die Küste zu ziehen ist das, was du willst?“, hake ich schließlich nach.
Elvira nickt. „Ja… Ein neuer Ort, wo wir von niemandem die Geheimnisse kennen, das wäre schön. Ein Ort, wo mich nicht jedes Gebäude mit seiner Geschichte heimsucht, wo mich nicht jedes Gesicht an einen Fall erinnert.“
Mit leicht verschwommenem Blick nehme ich meinen Löffel und rühre den Schaum meines Latte unter. In mir kämpfen zwei widersprüchliche Gefühle um die Oberhand: Einerseits verstehe ich Elvira und kann mir vorstellen, dass sie an einem Ort, wo sie niemanden kennt und noch einmal von vorne anfangen kann, glücklicher wäre. Andererseits bin ich wütend und enttäuscht, weil meine Tante und meine Mutter vor mir und meinesgleichen fliehen wollen.
Mama… Sie hat sich noch nicht einmal getraut, mir persönlich von ihrem Umzug zu erzählen. Aber das sollte mich eigentlich nicht wundern, denn wir haben seit ihrem Erwachen kaum ein vernünftiges Gespräch miteinander geführt. Um ehrlich zu sein, waren unsere Gespräche intensiver, als sie noch im Wachkoma lag, denn da konnte sie sich wenigstens nicht von mir abwenden!
„Und wann soll es losgehen?“, traue ich mich schließlich nach einigen schweigsamen Minuten zu fragen.
Elvira blickt nicht von ihrem Eisbecker auf, in dem sie nur gedankenverloren herumrührt, ohne davon zu essen. „Ende der Woche.“
Mir fällt mein Löffel aus der Hand und landet scheppernd auf dem Marmortisch. „Was?“
„Geplant haben wir den Umzug schon länger, wir wollten dich aber erst informieren, wenn alles feststeht.“
„Ende der Woche?“ Mein Gehirn braucht etwas Zeit, um die Informationen zu verarbeiten. Sie gehen weg. Es steht fest. Und ich kann nichts daran ändern.
Als hätte sie meine Gedanken gelesen, greift Elvira nach meinem Handgelenk und schließt mitfühlend ihre kalten Finger darum. „Du kannst es nicht verhindern, Kindchen. Dieser Umzug ist längst überfällig, für Ella und für mich.“ Als ich nicht antworte, sondern sie nur verständnislos anschaue, nimmt sie ihre Hand weg und fährt fort. „Ich habe dir das Büro übergeben und du bist besser für den Job geeignet, als ich es je war. Du hast im vergangenen Jahr bewiesen, dass du auch sehr gut alleine klarkommst.“
„Darum geht es doch gar nicht, Elvira“, entgegne ich und muss mich beherrschen, einen ruhigen Ton zu bewahren. „Es geht nicht um das Büro oder die Arbeit! Ihr seid doch meine Familie! Ihr könnt nicht einfach wegziehen!“
Wieder schiebt sie die Unterlippe vor und sieht mich entschuldigend an. „Doch, Scarlett. Das können wir, und das werden wir auch. Bitte denk dabei doch auch an uns. Wir müssen raus aus diesem Ort mit all seinen Erinnerungen.“ Sie macht einen langen Seufzer und blickt zum Fenster hinaus, wo die ersten Regentropfen gegen die Scheibe prasseln.
„Du weißt aber schon, dass es Hexen, Mannwölfe, Geister, Dämonen und so weiter auch an der Küste gibt, oder? Es gibt sie überall!“
Ohne den Blick von einem besonders dicken Regentropfen zu nehmen, der langsam in Schlangenlinien an der Fensterscheibe herunterläuft, nickt sie. „Ja, das weiß ich“, antwortet sie in traurigem Ton und sieht mich wieder an. „Aber wenigstens weiß ich dort nicht, wer ein magisches Wesen ist und wer nicht.“
„Und was ist mit dem Reisebüro und deiner Wohnung?“
„Du wirst das Büro mit zu Chris nehmen müssen. Ich war heute beim Makler und werde beides verkaufen.“
Unsere Blicke begegnen sich noch eine Zeitlang, dann schaut sie auf ihren Eisbecher und lächelt. „Das Eis ist wohl hin“, bemerkt sie und zuckt mit den Schultern.
„Nicht nur das Eis“, murmle ich.