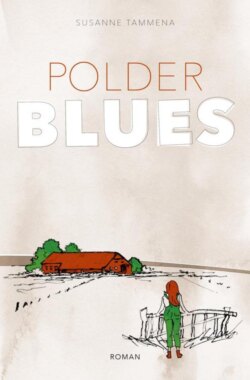Читать книгу Polderblues - Susanne Tammena - Страница 2
Teil 1: Engelshaar 1.
ОглавлениеWenn man wie Dr. Conradin DeClerq einen flämischen Namen trug, der in den Kriegswirren der Jahre 1914-18 durch die Liebe eines adeligen, aber dennoch feindlich gesinnten Hauptmanns zu einer ostfriesischen Lazaretthelferin ins Rheiderland gelangt war, dann war eine freiberufliche Betätigung quasi vorprogrammiert. Nicht etwa, dass fremdenfeindliche Vorurteile einen DeClerq davon hätten abhalten können, ein braver Beamter oder tüchtiger Bäckermeister zu werden. Aber anders als einem Müller oder Janssen war einem DeClerq auch bei nur mittelmäßigen Erfolgen als Rechtsanwalt oder Arzt der Respekt seiner einfacheren Mitbürger sicher, davon war der Notar selbst zutiefst überzeugt. Der Name ließ an Weltläufigkeit und Erfahrung denken, sein Klang beschwor Erinnerungen an die großen Offiziersschulen europäischer Armeen herauf, sprach von Aufrichtigkeit, Geradlinigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Durchhaltevermögen, und war trotz des Namenszusatzes ohne die geringste Andeutung französischer Schlüpfrigkeit; ein Name also, der wie geschaffen dafür war, dort zu wirken, wo Menschen Vertrauen fassen wollten, da sie sich mit ihrem Körper, ihrer Seele oder ihrem Besitz ausliefern mussten, also beim Arzt, beim Anwalt oder beim Unternehmensberater...
DeClerqs Wahl fiel schon einige Jahre vor dem Abitur auf das Jurastudium, da er die Körperlichkeit scheute, mit der sein Vater täglich in seiner Arztpraxis zu tun gehabt hatte, und von Zahlen verstand er nichts. Außerdem entsprach der Beruf seinem Vornamen. Konrad stand für „kühner Ratgeber“, aber auch für alle Mandanten seiner
Kanzlei, die diese Bedeutung nicht kannten, klang Conradin durchaus gutbürgerlich und gesetzt, aber mit dieser neckischen Endung, die eine gute Portion Witz und Einfallsreichtum versprach.
Der Name prägte den Menschen mehr als gemeinhin angenommen, auch davon war DeClerq überzeugt. Die Wirkung, die der Klang des Namens auf seine Mitmenschen ausübte, konnte nicht ohne Einfluss auf den eigenen Auftritt innerhalb der Gesellschaft bleiben. Der richtige Name konnte, wenn schon nicht den Lebenslauf bestimmen, so doch zumindest starken Einfluss darauf nehmen. Diese Theorie war DeClerqs liebstes Steckenpferd, mit dem er sich gern und häufig beschäftigte, wenn er terminlich in seinem Notariat nicht zu stark in Anspruch genommen war.
Ausgangspunkt seiner Überlegungen war dabei stets seine eigene Person, deren Werdegang und Integrität in seinem Beruf er gern damit begründete, dass sein so wohlgelungener Name ihm den Weg an die für ihn passende Stelle innerhalb der Gesellschaft geebnet hatte.
In Momenten allerdings, die von noch größerer Selbstüberzeugung geprägt waren, als DeClerq sie ohnehin in sich trug, kehrte er diese Grundüberlegung um und erhob die Folge – also seinen vortrefflichen Charakter und exzellenten und exzellenten Geschmack – in den Rang der Ursache und degradierte die Ursache – seinen wohlklingenden Namen – zu einem zufälligen Glücksgriff seiner Eltern, der frei nach dem Sinnspruch „Nomen est Omen“ wie göttlicher Goldstaub an seiner Existenz haftete.
Häufig sinnierte er vor geschäftlichen Terminen, für deren reibungslosen Ablauf seine Sekretärin bereits die nötigen Formulare vorbereitet hatte, über den dort aufgeführten Namen, um sich schon einmal ein Bild von den entsprechenden Personen zu machen. Vor einigen Monaten hatte zum Beispiel ein Harald Dirksen ein kleines Stück Grünland erworben, das am Rande der Gemeinde lag. Verkäufer war Hinrikus Boekhoff, einer der größten Landwirte des Ortes. Boekhoff - dieser Name hatte Gewicht, er barg ostfriesische Tradition in sich, er sprach vom Reichtum der Polderfürsten, die auf dem fetten Schwemmland der Marschen mit der Landwirtschaft ihr Vermögen gemacht hatten. Dazu noch die mächtige römische Endung des Vornamens – Ehrfurcht gebietend. Wie bei ihm selbst konnte dieses Zusammentreffen von bedeutendem Rang in der Gesellschaft und respektabler Größe des Namens nicht einfach dem Zufall zugeschrieben werden. DeClerq erwartete mit dem Großbauern eine echte Autorität in seiner Kanzlei. Harald Dirksen dagegen – ein unbeschriebenes Blatt. Wer auch immer sich hinter diesem dürftigen Familiennamen verbarg, hatte auch noch das Pech gehabt, von seinen Eltern mit einem solchen Vornamen gestraft zu sein. Die etymologische Bedeutung war in etwa Heerführer oder auch -verwalter, also nur eine Haaresbreite vom Verwalter, Beamten oder auch Verwaltungsfachangestellten entfernt. Harald – welch eine Freveltat, die wohl nur einem jahrhundertealten Bewusstsein der eigenen Mittelmäßigkeit entspringen konnte, in der sich der Träger des Namens Dirksen unweigerlich befunden hatte, als er am 23. 4. 1958 im Standesamt in Emden die Geburt seines Sohnes anmeldete. Von dieser Seite, so war sich der Notar sicher, stand nicht viel Interessantes zu erwarten. Vielleicht ein langweiliger, aber wohl gutmütiger Großvater, der sein Erspartes dazu gebrauchte, seinen Enkelinnen eine Ponyweide zu kaufen.
Tatsächlich sah DeClerq sich nach Eintreffen des Käufers in der Kanzlei bestätigt. Harald Dirksen war nach Aussehen und Auftreten gleichermaßen unscheinbar, der Kauf schien ihm jedoch äußerst wichtig zu sein, wie aus einigen unterdrückten Seufzern zum Spannungsabbau zu schließen war. Vielleicht war ihm auch nur die Gewichtigkeit des Notarzimmers mit seinen dunklen Eichenmöbeln unangenehm, da sie ihm seine eigene kleinbürgerliche Existenz vor Augen führte. Beim Gedanken an diese Möglichkeit frohlockte DeClerq. Stolz ließ augenblicklich seine Brust schwellen und verlieh seiner Stimme einen gravitätischen Klang.
Die Persönlichkeit des Hinrikus Boekhoff dagegen enttäuschte den Notar zutiefst. Als der Großbauer einige Minuten nach Dirksen das Büro betrat, erschrak DeClerq förmlich vor dem senilen Erscheinungsbild, das dieser bot. Der Alte schien zwar geistig völlig klar, litt jedoch an einem starken Tremor im Nacken, der seinen Kopf wackeln ließ wie bei einer schlecht kontrollierten Marionette. Wahrscheinlich hatte er Parkinson oder so etwas. Sehr bedauerlich, dass Krankheiten in der Lage sind, die Würde eines Menschen so zu untergraben, dachte DeClerq bei sich, und wie in einem natürlichen Reflex nahm der Notar, quasi stellvertretend für den alten Herrn, vor dessen gebeugter Haltung eine Verbeugung kaum angebracht schien, die Rolle als Autorität des Augenblicks ein.
Die Vertragsunterzeichnung ging schnell und reibungslos über die Bühne, eine unbedeutende Formalität, die den Besitz des Landeigentümers kaum schmälerte.
Nachdem die beiden Mandanten seine Kanzlei verlassen hatten, blieb DeClerq in Gedanken noch ein wenig bei seinem Steckenpferd und konnte es nicht verhindern, dass ihn erstmals Zweifel an der Allgemeingültigkeit seiner Thesen überkamen. Die senile Gestalt des alten Boekhoff hatte ihn verwirrt, mehr noch, sie hatte ihn in eine für ihn völlig untypische Melancholie gestürzt, in eine traurige Endzeitstimmung, die sich in seiner Seele festsetzte, als hätte sich ein dunkler Dämon hier eine Heimstatt gesucht. Weit davon entfernt, in seinem großangelegten Konzept einer Gesellschaft, die ihre Plätze nach Namen vergab, die Möglichkeit des natürlichen Verfalls als normale Ausnahmeerscheinung zuzulassen, beschlich ihn der unheimliche Gedanke, dass er sich vielleicht in einer Phase des Wandels befand, dass ein gesellschaftlicher Umbruch bevorstand, der die alten, würdigen Namensträger hinwegfegen und eine neue Ordnung erschaffen würde. Vielleicht sollten die Schmidts und Müllers bald die neuen Würdenträger sein, und die alten Fürstengeschlechter der Boekhoffs und Tammingas ablösen, denen wie dem Adel am Fin de Siècle die Kraft der inneren Erneuerung abhandengekommen war. Der alte Boekhoff schien dem Notar auf einmal ein besonders leuchtendes Beispiel für diese Entwicklung zu sein, hatte der Alte doch keinen eigenen Hoferben. Und warum hatte er überhaupt Land verkauft? Der ostfriesische Bauer verkaufte kein Land. Wenn er mehr hatte, als er für sein Milchvieh als Weidefläche benötigte, dann verpachtete er. Verkaufen tat nur der Bauer mit Geldsorgen, dessen war DeClerq sich sicher. Seine Stimmung drohte ins Bodenlose zu sinken.
Es war wohl vor allem ein Generationenproblem. Die Träger der großen Namen waren inzwischen zu alt, um diese mit Würde zu tragen, und der nachfolgenden Generation hatten sie einfach nicht mehr die richtigen gegeben. Zuerst diese elende Generation, zu der auch dieser Harald gehört hatte, lauter Uwes, Gerds und Heinze, allerhöchstens Fußballerniveau, manchmal ein Alfred, seltener ein Kurt. Ein Jahrzehnt später hießen dann alle nur noch Thomas, Michael, Andreas oder Torsten. Niemand hielt mehr etwas auf Traditionen.
An diesem schon häufiger erreichten Punkt seiner Gedankenspielereien gebot ihm sein Unterbewusstsein aus reinem Selbstschutz Einhalt, denn angesichts der nicht zu leugnenden Häufung höchst inakzeptabler Anglizismen hätte ihn eine wissenschaftlich korrekte Evaluation der Namensverteilung innerhalb der jüngeren Jahrgänge in tiefste Verzweiflung und – wer konnte das schon mit Sicherheit ausschließen? – an den Rand eines Herzinfarktes gebracht, weshalb er es vorzog, den geraden Pfad des Zeitstrahls zu verlassen und auf einer kleinen kunstvollen Schleife zu sich selbst zurückzukehren.
Einmal mehr bedauerte er nun, dass er seine namenswissenschaftlichen Überzeugungen nicht schon in jungen Jahren als Buch veröffentlicht und auf diese Art die Entwicklung der letzten Jahrzehnte abgewendet hatte. Bedeuteten seine Zweifel vielleicht, dass er selbst alt wurde? Gehörte er nicht auch zu dieser niedergehenden Generation der würdigen Namensträger, deren erster Vertreter Hinrikus Boekhoff war und der er nachfolgen würde als tattriger Greis, um seine Kanzlei einem Martin Schneider oder sonst wem zu überlassen?
Doch seit einiger Zeit konnte man zumindest wieder hoffen – die jüngste Schwemme nordischer Namen hatte anscheinend auch das Interesse an den traditionellen ostfriesischen wieder geweckt, und vor Kurzem hatte eine Ditzumer Krabbenfischer-Dynastie ihren Sprössling tatsächlich auf den stolzen Namen Harmannus getauft. Das nannte er vorausschauendes Handeln der Eltern! Es war ein großartiger Name ohne jede abwegige Verniedlichung, die in späteren Jahren für eine standesgemäße Entwicklung nur hinderlich wäre. Er hoffte, er könnte den Lebensweg des jungen Mannes noch ein Weilchen mitverfolgen, vielleicht ließen sich dort einige Daten sammeln, die seine theoretischen Überlegungen untermauerten.
Der Gedanke an diesen namentlichen Hoffnungsträger hatte damals den dunklen Dämon der Vergänglichkeit wieder aus DeClerqs Seele verscheucht, und auch jetzt, mehr als zwei Jahre später, vermochte es die positive Erinnerung daran, ihm seinen Optimismus zu bewahren.
Er trat ans Fenster, um in den vorfrühlingshaften Märzhimmel zu schauen. Nomen est Omen, dachte er verzückt, und zugleich blitzten die ersten Sonnenstrahlen dieses Jahres in sein vornehmlich westlich ausgerichtetes Büro und verliehen dem Moment etwas Magisches. Ja, die Zukunft hielt doch noch etwas für ihn bereit.
DeClerqs Blicke schweiften über die Dachrinnen der Häuser auf der gegenüberliegenden Straßenseite hinweg in Richtung des Himmelsblaus, als sie von einer Bewegung im Dämmerlicht der Straßenschlucht zum Erdboden zurückgezogen wurden.
DeClerq wurde jäh, aber durchaus nicht unangenehm in seinen Körper zurückgeholt. Ein Paar lange wohlgeformte Beine in schwarzen Strümpfen schauten unter einem kurzen bunten Wintermantel hervor. Sie steckten in für seinen Geschmack etwas zu klobigen Winterstiefeln, ein feineres Schuhwerk mit schmaleren und nicht zu hohen Absätzen hätte den Bewegungen sicherlich noch etwas mehr Anmut verliehen, aber diese Beine waren wirklich nicht zu verachten. Sie gehörten zu Anja Fresemann, einer hochgewachsenen, schlanken jungen Frau mit wilder roter Mähne, die einem Gemälde Klimts hätte entstammen können, wenn Klimt nicht diese Vorliebe für Gold gehabt hätte. Anja leuchtete kupferfarben, und wenn die Sonne auf ihre Locken schien, das wusste der Notar von früheren Begebenheiten, denn jetzt war es nicht der Fall, die Straße war zu schmal, als dass die Sonnenstrahlen über die Dächer der Häuser hinweg den Bürgersteig erreicht hätten, dann schienen sie Feuer zu fangen.
DeClerq bezwang seine vorübergehende Erregung, indem er mit väterlicher Fürsorge an die traurigen Familienverhältnisse der Fresemanns dachte, die todkranke Mutter – oder war sie schon verstorben? – der stets abwesende Vater, dessen früher Tod vor zehn Jahren kaum noch eine Lücke hatte reißen können. Er sollte den Kontakt besser pflegen, schließlich hatte er Alma Fresemann damals nach dem Tod ihres Mannes erbrechtlich beraten. Gleich morgen würde er einen Besuch im Krankenhaus machen, nahm er sich vor. Bei dem Vorsatz blieb es freilich, doch für den Moment war er guten Willens und schaute Anja voller Entzücken nach, bis sie hinter der nächsten Straßenecke verschwunden war.
„Jantina“, rief der Anwalt seine Gehilfin laut ins Büro, „hast du die Ausbildungsanzeige schon an die Zeitung gegeben?“
Jantina bestätigte die Frage mit einem Nicken. Er gedachte ihrer stets als seine ‚Gehilfin‘, obwohl sie voll ausgebildete Rechtsanwalt- und Notarfachangestellte war. Sie war sehr tüchtig, ein Glücksgriff, der wunderbar in sein Leben passte. Von Glück auszugehen, entsprach in diesem Fall zwar dem gängigen Sprachgebrauch, aber natürlich nicht im mindesten seinem Gefühl für feinsinnige Fügungen des Schicksals. Denn wenn er ehrlich war, dann hatte er sie nur wegen ihres Namens ausgesucht. Was, wenn nicht der traditionelle, ostfriesische Name konnte ein besseres Indiz sein für die Eignung einer Bewerberin, in seiner Kanzlei zu wirken?
Mit Familiennamen hieß sie Hallenga, bis sie Gerd Kampen geheiratet hatte. Natürlich gehörte es sich so, dass die Ehefrau den Namen ihres Gatten annahm, trotzdem war es ein Frevel, aus einer Hallenga eine Kampen zu machen. Welch ein Niedergang zum einfachen Landvolk! Außerdem hätte er selbst sie auch genommen, sie gefiel ihm vom ersten Moment an, aber da war sie schon verlobt, und Conradin war nicht so pietätlos gewesen, sie offensiv zu bedrängen. Vielleicht hätte er es tun sollen, schließlich wäre er eindeutig die bessere Partie gewesen. Doch er hatte sich zurückgehalten und nur das eine oder andere kleine Kompliment fallenlassen, auf das sie leider nicht eingegangen war. So war es eben. Er hatte nie geheiratet. Frauen, die seinen hohen Ansprüchen genügen konnten, waren nicht so dicht gesät. Eine von diesen Frauen war seine Mutter gewesen, und die Wahrscheinlichkeit, in einem Leben gleich zweimal der perfekten Frau zu begegnen, war natürlich noch geringer, als es der einmalige Glücksfall gewesen war. Aber eigentlich bestand auch kein Grund zur Besorgnis, was nicht war, konnte noch werden. Er war noch keine fünfzig, also noch im besten Mannesalter.
Sein Vater war bei seiner Geburt auch schon über vierzig gewesen. Daran musste Conradin denken, auch wenn er sich ansonsten dagegen sträubte, seinen Vater als Maßstab für das eigene Leben zu nutzen. Er war ein Mann geworden, ohne dazu die Hilfe seines Vaters in Anspruch genommen zu haben. Seine Mutter und seine Großmutter väterlicherseits hatten dazu völlig ausgereicht. Mit der Idee väterlicher Fürsorge konnte Conradin nicht viel anfangen; Vater zu sein, bedeutete für ihn vor allem die Weitergabe eines würdigen Namens, und zumindest diesen Part hatte sein Vater hervorragend erledigt.
Conradins Vater Heinrich wurde 1918 unter denkbar schlechten Voraussetzungen geboren, denn sein Vater hatte ihm zwar den herrschaftlichen Namen, aber kein Vermögen vererbt, als er nur wenige Tage vor Kriegsende von der Spanischen Grippe dahingerafft wurde. Seine Mutter ging zurück nach Deutschland, wo im feuchten Klima ihrer ostfriesischen Heimat die Pandemie noch stärker gewütet hatte als der Krieg und sie nur noch wenige vertraute Gesichter ihrer Generation wiederfand. Denn diese Influenza hatte die seltsame Eigenschaft, die Gesellschaft in der Mitte zu zerschlagen, anders als es die üblichen Grippewellen zu tun pflegten. Nicht die kranken Alten und nicht die schwachen Jungen starben wie die Fliegen, sondern die 20- bis 40-jährigen. Es traf Arbeiter, Soldaten und junge Frauen der unteren Schichten ebenso wie die vielversprechenden Sprösslinge der feineren Gesellschaft, und ihr früher Tod riss große Löcher ins soziale Netz der Gesellschaft.
Warum ausgerechnet Anneliese DeClerq, geborene Meier, sich nicht mit dem Virus infizierte, obwohl es im Lazarett weder Mundschutz noch Handschuhe für sie gab, blieb ein Geheimnis des Himmels. Dass sie außerdem die Heimkehr zu Fuß mit einem Säugling im Arm überlebte – und ihr Kind ebenfalls –, war dagegen eine Charakterfrage. Anpassungsfähigkeit und das Fehlen hindernden Stolzes verschafften ihr stets ein warmes Bett, oft genug in den Armen eines einsamen Bauern.
Sie kehrte mit der irrigen Vorstellung zurück, ihren Eltern durch Ehering und Sohn beweisen zu können, dass ihre Ehre in der Fremde nicht gelitten hatte. Dass sie nicht wie prophezeit in der Gosse gelandet war, bevor die Front in Sichtweite kam. Doch der Vater war inzwischen tot – nicht die Grippe, sondern ein Herzinfarkt hatte ihn zur letzten Ruhe gebettet – und die Mutter war ohne den Rat ihres Mannes schlicht nicht in der Lage, die Entscheidung zu treffen, ob ihre Tochter zu rehabilitieren sei. So war Anneliese zunächst zu Hause nur geduldet, doch die Freude, den kleinen Heinrich wachsen und gedeihen zu sehen, ließen das Herz der Mutter bald weich werden.
Das Zusammenleben mit den zwei liebenden Frauen prägte den Jungen nachhaltig. Eine halbe Stunde schmeichlerischer Höflichkeit am Tag verschaffte ihm ein Höchstmaß an Freiheit. Das Vertrauen der Damen war grenzenlos. Weniger grenzenlos war ihr finanzielles Vermögen, ihm ein Studium zu finanzieren, doch neben dem stattlichen Namen des Vaters hatte er vor allem den Opportunismus der Mutter geerbt. Mit der gleichen Anpassungsfähigkeit, die seine Mutter 1918 nach Hause geführt hatte, ergriff Heinrich seine Chance in der Partei.
Er studierte Medizin, weil ihn das Prestige reizte, er keine Angst vor Blut hatte und die Studienplätze leicht zu bekommen waren, zumindest für Parteimitglieder. Außerdem hatte ihm seine Klassenlehrerin in der Grundschule einmal gesagt, er wäre ein guter Sanitäter, nachdem er Karl Hersfeld im Erste-Hilfe-Kurs das Knie verbunden hatte. Da Heinrich eine Berufung ebenso wenig in sich spürte wie eine Gesinnung, wurde dieses Lob für ihn eine Art Prädestination.
Bei Kriegsausbruch stand er kurz vor dem Abschluss. Er überlebte den Krieg in Frankreich, wo er schon nach wenigen Wochen mit einem zerschossenen Knie im Lazarett landete. Dort blieb er, denn nach seiner Genesung gab es hier für den fertig ausgebildeten Arzt, dem nur noch das Diplom fehlte, genug zu tun. Er tat gute Dinge, heilte Menschen, und mit den üblen Machenschaften seiner Kollegen in den Spitälern der Heimat und den Versuchsstationen der Konzentrationslager hatte er nichts zu tun. Davon erfuhr er tatsächlich erst nach 1945, viel später als seine Mutter, die gute Ohren hatte und ein Raunen schon mitbekam, als Heinrich sich gerade erst fürs Studium eingeschrieben hatte. Doch der Sudelfleck auf der Ehre seines Berufsstandes machte ihm schwer zu schaffen.
War er unschuldig, nur weil ihn niemand jemals an den Abgrund der Schuld geführt hatte, an dem er sich hätte entscheiden müssen? Wäre er nicht zu vielen Verbrechen in der Lage gewesen, aus Angst, aus Feigheit, wenn jemand es von ihm verlangt hätte? Im Laufe seines Lebens wurde Heinrich ein verzweifelter Grübler, der sich selbst damit quälte, dass er versuchte, in seinem mittelmäßigen Wesen eine Spur von Wahrhaftigkeit zu entdecken, die seine Unschuld bewies. Anders als die Kriegsverbrecher, die sich vor Gericht verantworten mussten und dort um ihr Ansehen kämpften, die sich auf die Befehle beriefen und ihre Notlagen beteuerten, hatte Heinrich keine Ankläger. Er blieb mit seinen Zweifeln allein, ein tiefer See, in den er so oft hinabtauchte, bis er eines Tages nicht mehr an die Oberfläche kam.
Als er sich mit über vierzig Jahren das erste Mal in seinem Leben verliebte, war die Auserwählte eine Krankenschwester, die seine melancholischen Augen unwiderstehlich fand. Sie hatte eine wunderschöne, kleine, runde Figur und dichtes dunkelbraunes Haar, das ihr in Locken auf die Schultern fiel. Ihre blauen Augen blitzten häufig vor Vergnügen, doch sie konnte sein Abtauchen in die Nacht der Depression nur eine kurze Weile aufhalten. Nach der Geburt ihres Sohnes Conradin wandte sie sich ganz dem Säugling zu, der ihren Frohsinn geerbt hatte und oft vor Vergnügen kreischte, auch wenn er ganz allein mit seinem Spielzeug im Gitterbettchen lag. So entkam sie der bedrückenden Düsternis ihrer Ehe. Heinrich dagegen wurde nach der Geburt seines einzigen Kindes einsamer, als er es vorher gewesen war, und bevor Conradin seinen zweiten Geburtstag feierte, hatte er sich auf dem Dachboden des alten Meierhofes erhängt.
Gemeinsam hatte Conradin mit seinem Vater nur den Namen und die Tatsache, allein unter Frauen aufgewachsen zu sein. Conradin neigte daher zu der Ansicht, dass sich das Zeugen von Nachwuchs und damit die Weitergabe seines ideellen Erbes, des Namens, auch noch im höheren Alter bewerkstelligen ließ. Solange die Mutter nur jung genug war und für die Erziehung des Kindes ausreichend Kraft hatte, stand dem Fortbestand einer Dynastie nichts im Wege. Auch seine Stunde würde noch kommen, da war er sich sicher, noch spürte er Saft und Kraft in sich.