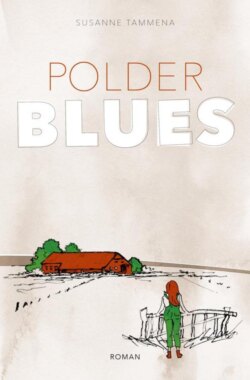Читать книгу Polderblues - Susanne Tammena - Страница 8
7.
ОглавлениеDie schöne Anja Fresemann, deren rote Locken noch immer durch Beenes Träume tanzten, war vom Postboten, daran bestand kein Zweifel. Und als Kind hatte sie das auch oft genug gehört. Ihre schlanke, großgewachsene Gestalt, die so gar nicht zur eher kleinwüchsigen, gemütlichen Behäbigkeit ihrer Schwestern passen wollte, ihr ausgeprägter Bewegungsdrang, ihr Haar - ihre Großmutter schüttelte bei ihren Besuchen regelmäßig den Kopf darüber und gab diese Weisheit zum Besten.
Anja hatte den Satz in ihren Kinderjahren natürlich nicht so richtig verstanden (Sollte sie etwa in einem Paket an die Familie geschickt worden sein?), und in ihrem gemütlichen Heim in der Siedlung hinter dem Gymnasium kam er zum Glück nie zur Sprache.
Doch einmal überraschte sie ihren Großvater, als er ihr gedankenverloren über die roten Haare strich und sich leise fragte, woher sie die nur hätte, mit dem Ausruf: „Ich bin doch von der Post, weißt du das denn nicht?“ Und dann mussten sie beide herzlich lachen, ihr Opa war ein lustiger Mensch.
Ihre Mutter hielt Anja dagegen für humorlos, denn sobald vom Postboten die Rede war, lachte sie hüstelnd und gefror innerlich zu Eis. Anja spürte das immer sofort, auch wenn andere es offenbar nicht bemerkten. Da der Spruch ein Witz war, den ihr Opa verstand und ihre Oma auch, verstand ihre Mutter anscheinend keinen Spaß, was Anja sehr bedauerte, denn sie selbst lachte gerne. Die frostige Anspannung ihrer Mutter dagegen hasste sie von ganzem Herzen.
Zum Weihnachtsfest 1999, als Anja drei Jahre alt war und ihr volles brandrotes Haar das erste Mal mit Schleifchen frisiert werden konnte, beugte Tante Erika, Almas ältere Schwester, die nach Art der Erstgeborenen als Kind etwas altklug und später stets forsch in der Erkundung seelischen Geländes war, sich über den hübschen Kinderkopf und fragte in leicht verschwörerischem Tonfall:
„Müsste sie nicht eigentlich blond sein?“
Eisschrank, Anja konnte es deutlich spüren.
Alma sah ihre Schwester ernst an, legte hinter Anjas Rücken den rechten Zeigefinger auf ihre Lippen und deutete mit dem linken auf die Pinnwand, die an der Stirnseite des Küchentisches an der Wand hing. Dort war mit Stecknadeln ein Plakat befestigt, das eine Bronzemaske Ernst Barlachs zeigte, das großflächige Gesicht eines Engels mit geschlossenen Augen. Unter der Maske stand in großer Schrift eine Lebensweisheit Sapphos: „Rühr nicht ans Geröll!“
Erika hielt sich daran. Die indirekte Bestätigung ihrer Vermutung reichte ihr allemal über den kleinen Anfall von Neugierde hinweg. Für den Moment war der Familienfrieden gerettet, denn Anja hatte noch nichts verstanden, außer dass ihre Mutter rote Haare auch nicht witzig fand.
Nach ihrer Einschulung hänselten sie auch manchmal Mitschüler wegen ihrer Haarfarbe, es gab nur wenig anderes an Anja, über das man sich hätte lustig machen können. Wenn sie nach so einem Streit traurig war, dachte sie darüber nach, wie alt man wohl sein musste, um sich die Haare färben zu dürfen. Sie wusste, dass so etwas ging, Haare färben. Tante Erika färbte sich schließlich die grauen Strähnen weg. Aber vielleicht konnte man auch nur grau überfärben, denn das war ja fast gar keine Farbe. Als sie ihre Mutter danach fragte, lachte die nur auf ihre elend dumme Eisschrankart. Anja war wütend und beschloss, zu warten und später ihre Schwester Astrid zu fragen. Die wollte sowieso Friseurin werden, dann würde sie Bescheid wissen.
Etwas später konnte sie dann auch die Schrift auf dem Küchenplakat entziffern. Der Spruch erschien ihr seltsam, die Worte unverständlich. Warum sollte man Steine anrühren, rühren ging doch nur bei Flüssigkeiten oder Kuchenteig? Sie fragte ihre Mutter danach, als diese gerade den Tisch deckte.
„Weil es gefährlich ist“, antwortete Alma, „die Steine könnten sich lösen, einen Berg herunterrollen und jemanden verletzen, ja, vielleicht sogar eine Lawine auslösen.“
Vor Anjas Augen erschien das Bild ihrer Mutter, die versuchte, mit den Rührstäben ihres Mixers in einen Steinhaufen zu bohren. Es erschien ihr absurd, dass jemand so etwas tun sollte, aber natürlich hatte ihre Mutter recht, es war sicher gefährlich.
„Aber wenn alle immer Angst vor den Steinen haben müssen, dann ist es doch eigentlich besser, wenn man das Geröll anders hinlegt, oder?“, hakte Anja nach.
„Aber oft sind das viel zu viele Steine, und außerdem ist es ja gefährlich, dort zu arbeiten“, erklärte ihre Mutter.
Anja war nicht überzeugt.
„Also ich würde einfach allen Leuten Bescheid sagen, damit alle wegrennen können und ganz laut Achtung schreien“, erklärte sie mit kindlicher Logik. „Und dann würde ich ganz kräftig von oben in den Steinhaufen rühren, sodass alle Steine so weit herunterpurzeln, bis sie irgendwo fest liegen bleiben. Dann braucht keiner mehr Angst zu haben.“
„Das ist nicht immer gut“, sagte ihre Mutter und seufzte tief.
Alma überlegte, ob sie versuchen sollte, Anja zu erklären, dass manche Sprüche auch eine übertragende Bedeutung haben, oder ob sie lieber weiter im Bild bliebe, bei herabfallenden Steinen, mitgerissenen kleinen Mädchen, die dann ebenfalls den Berg hinunterkullerten, oder Ähnlichem. Doch Anja hatte bereits die Küche verlassen. Geröll schien ebenfalls ein Thema zu sein, über das sie mit ihrer Mutter nicht sprechen konnte. Dann würde sie eben ihren Vater fragen, der hatte immer eine lustige Antwort und gab ihr auch oft recht, was logisch war, meistens hatte sie ja auch recht. Sie nahm sich fest vor, ihm am Wochenende die gleichen Fragen zu stellen, doch bis er kam, hatte sie es wieder vergessen.
Obwohl Anja schon früh an ihrer Mutter zweifelte, war ihre Kindheit glücklich. Sonntagsmorgens lag die ganze Familie im Ehebett und Anton erzählte Geschichten. Nachmittags wurden Ausflüge in die grüne Umgebung der Kleinstadt unternommen und es gab irgendwo Kuchen oder Eis. Nach Anjas Geburt stärker als je zuvor bildeten Alma und Anton eine Einheit, die Zweifel nicht zuließ, und die Kinder kreisten wie Trabanten auf festgefügten Umlaufbahnen um dieses Elterngestirn.
Doch dann starb Anton an einem Herzinfarkt, und als hätte Alma allein nicht genügend Anziehungskraft, um die Mädchen zu halten, schwebten die drei auf einmal haltlos durchs Universum. Astrid war damals fünfzehn und überlebte Antons Tod wahrscheinlich nur durch den glücklichen Umstand, dass keiner ihrer Freunde ihr jemals härtere Drogen als Alkohol und Cannabis anbot. Über zwei Jahre klinkte sie sich aus dem Weltgeschehen aus und schwebte in einer fremden Galaxie aus fein versponnenen Lichtpunkten, deren Nebel ihre Familie nicht durchdringen konnte. Sie wiederholte die neunte Klasse und war kurz davor, das Gymnasium zu verlassen, als ihr in gemeinsamer Geste eine zugewandte Vertrauenslehrerin und ein netter Schüler aus der Oberstufe zwei Hände reichten und sie auf die Erde zurückholten. Almuth dagegen klammerte sich an ihre Mutter und weinte an deren Seite, und gemeinsam erfuhren sie die kathartische Wirkung offener Trauer.
Anja fror nach Antons Tod, ihr ganzer Körper zitterte manchmal über Stunden hinweg unkontrollierbar, bevor sie völlig erschöpft in von Übelkeit begleitete Bewegungslosigkeit verfiel. Sie schwebte nicht im Raum, gegen Schweben hätte sie gar nichts einzuwenden gehabt. Luft war ihr Element, und vor Dunkelheit hatte sie auch keine Angst. Sie fühlte sich, als hätte jemand sie mitten in der Nacht aus ihrem warmen Bett gezerrt und ihr eine Ecke in einem ungeheizten Kaninchenstall zugewiesen. Und in ihrem Magen lag ein schwerer Backstein, der sie zu Boden drückte, so stark, dass sie nicht davonlaufen konnte. Doch im Laufe einiger Monate schrumpfte der Stein auf Kieselgröße, und was ihr blieb, war das Gefühl, aus etwas herausgestoßen worden zu sein, in dem sie sich lieber noch eine Weile geborgen gefühlt hätte. Sie versuchte, das Beste daraus zu machen und suchte sich in neuer, kalter Freiheit ein eigenes Leben, in dem die Familie zwischen der Schule und ihren Freundinnen nicht mehr die Hauptrolle einnahm. Ihre Mutter verlor ihren Status als Vertrauensperson und Anja machte in der Folgezeit die meisten Probleme mit sich allein aus. Da sie Alma schon immer für unverständlich gehalten hatte, war es nur ein kleiner Schritt gewesen.
Als Frau Fresemann ihre Tochter dann doch noch über das Geheimnis ihrer Herkunft aufklärte, über ihre roten Haare und über das Geröll, da war es also schon zehn Jahre zu spät. Aus den Rissen im Vertrauensverhältnis war eine unüberwindbare Kluft voller Widerstände geworden. Warum sie es überhaupt noch tat? Um Anja das zu erklären, fehlte ihr schon die Kraft.
Alma war 52, als bei einer Vorsorgeuntersuchung ein schnell wachsender Tumor in ihrer linken Brust gefunden wurde, der schon über das Lymphsystem gestreut hatte. Trotz schneller Operation und anschließender Chemotherapie fanden die Ärzte bei jeder Untersuchung neue Metastasen: in der Bauchspeicheldrüse, der Leber, zuletzt auch in der Lunge. Anja war da gerade achtzehn, wohnte als Einzige noch zu Hause und war verzweifelt. Es war weniger die Angst um ihre Mutter als mehr die gesamte Flutwelle aus Ängsten ihrer verlorenen Kindheit, die sie zu überrollen drohte. Das Zittern kam wieder, die Erschöpfung und die Übelkeit. Und dazu gesellte sich ein neues Gefühl: Wut.
Anfangs war sie jeden zweiten Tag mit dem Zug nach Oldenburg ins Krankenhaus gefahren, wohin ihre Mutter sofort nach der Diagnose verlegt worden war. Dort lag sie schwach, aber immer sehr gefasst auf dem weißen Kissen, und sofort überkam Anja diese neue, unglaublich mächtige Empfindung. Warum musste das passieren? Warum tat sie ihr das an und ließ sie hier allein? Sie brauchte sie doch noch. Warum konnte ihre Mutter nicht einmal weinen? Hatte sie keine Angst? Warum schrie sie nicht genauso verzweifelt, wie es in Anjas Inneren schrie und warum dieses ewig gleichbleibende sanfte Lächeln? Meist sprachen Anja und Alma kaum miteinander, wenn sie sich sahen. Und sobald Anja das Zimmer verließ, schämte sie sich dafür und weinte die ganze Zugfahrt über.
Nach ein paar Wochen hatten Anjas Schwestern einen sinnvollen Betreuungsplan für ihre Kleinkinder entwickelt und fuhren abwechselnd mit dem Auto nach Oldenburg und nahmen Anja mit. Von nun an verliefen die Treffen entspannter, friedfertiger. Astrid stellte ihrer Mutter Fragen über den Krankenhausalltag, ob das Essen gut sei, die Schwestern nett oder ob sie neue Wäsche brauche. Die Mutter antwortete dann leise und ernst. Sie hielten sich die Hände, aßen gemeinsam einige Pralinen und dann fuhren die Töchter wieder.
Almuth sprach auch manchmal von ihrer Angst und fragte die Mutter nach ihren Gefühlen, unglaublich einfühlsam und zart, manchmal weinte die Mutter und bedauerte, ihre Enkelkinder nicht aufwachsen sehen zu können. Dann musste auch Almuth weinen, doch es war eine so ehrliche, reine Trauer und nicht vom Gift stummer Vorwürfe durchsetzt, dass ihre Mutter danach erleichtert zu sein schien und auch Almuth getröstet nach Hause fuhr.
Anja fühlte sich wie eine Voyeurin, die dem Leid völlig fremder Menschen zuschaute, so als wäre sie zufällig in eine intime Unterhaltung geraten, die nicht für sie bestimmt war. Meistens setzte sie sich mit ihrem Besucherstuhl etwas abseits ans Fenster, während ihre Schwestern in dem engen Krankenzimmer immer auf dem Bett der Mutter saßen. Mit dieser auch räumlich sichtbaren Distanz sah Anja ihrer Mutter beim Sterben und ihren Schwestern bei der Sterbebegleitung zu, erstaunt, wie liebevoll und friedlich ein so grausamer Verfallsprozess ertragen werden konnte, und war so einsam wie nie zuvor.
Mitte September wurde Alma nach Leer ins Hospiz verlegt, in ein großes Einzelzimmer, sonnendurchflutet, mit Blick in einen schönen Garten. Das Hospiz lag nur wenige Minuten zu Fuß vom Haus der Fresemanns entfernt, sodass die gemeinsamen Autofahrten mit ihren Schwestern endeten. Anja war froh darüber, denn manches Mal hatten die Schwestern auf der Rückfahrt versucht, ein Gespräch mit ihr zu beginnen, aber sie konnte einfach nicht mit ihnen sprechen. Nicht über den Krebs, nicht über den Tod, nicht über ihre Verzweiflung und am allerwenigsten über ihre Wut. Sie konnte keine ruhigen Worte finden für das, was in ihrem Innern tobte. Wenn sie versuchen würde, über die Mutter zu sprechen, dann würde sie nur schreien können, da war sie sich sicher, schreien, schreien, schreien …
Zur Wut kam die Angst vor ihrer eigenen Abartigkeit. Wenn sie weinte, dann voller Selbstmitleid über ihre eigene Unfähigkeit, in Frieden Abschied zu nehmen. Und wenn sie Alma jetzt besuchte, saß sie noch immer etwas unbeteiligt am Fenster und gab einsilbige Antworten auf die Fragen nach der Schule und ihren Freundinnen. Es musste ihrer Mutter das Herz brechen, sie so harsch und abweisend zu sehen, aber Anja war nun einmal eine schlechte Schauspielerin und konnte ihr kein Mitgefühl vorspielen. Dieser Gedanke brachte sie sofort wieder in Rage, und in Gedanken unterstellte sie ihrer Mutter, sie würde von ihr Schauspielerei verlangen, nur um selbst unbesorgt von der Bühne abtreten zu können.
In Wirklichkeit suchte Alma ebenso verzweifelt wie ihre Tochter ein Mittel, Frieden in den Abschied zu bringen, und da sie sie mit mütterlicher Wärme und Zuneigung nicht mehr erreichen konnte, versuchte sie es mit Komplizenschaft, so wie kleine Mädchen auf dem Schulhof Freundschaften mit der Einweihung in tiefste Geheimnisse belohnen.
Alma bat Anja mit ernster Miene zu sich ans Bett und eröffnete ihr das Geheimnis ihrer Herkunft. Und sie leitete diese Stunde der Vertraulichkeit mit den Worten ein:
„Ich muss dir etwas anvertrauen“, als wollte sie betonen, dass es hier um ein Geheimnis, nicht etwa um eine Beichte ging.