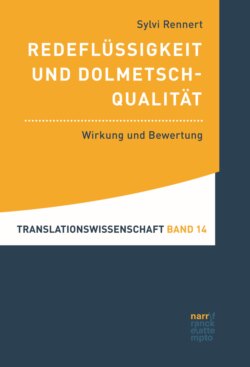Читать книгу Redeflüssigkeit und Dolmetschqualität - Sylvi Rennert - Страница 9
2.1.3 Operationalisierung des Qualitätsbegriffs
ОглавлениеIn der wissenschaftlichen Diskussion muss zwischen einem theoretischen Konstrukt und dessen Operationalisierung unterschieden werden. In den vorhergehenden Abschnitten wurde das Konstrukt der Qualität herausgearbeitet: In 2.1.1 wurde festgestellt, dass zur Bestimmung der Qualität der Dienstleistung Dolmetschung sowohl der produktbezogene Qualitätsbegriff als auch die subjektive Bewertung durch die KundInnen (ZT-RezipientInnen) berücksichtigt werden sollten. Aufbauend darauf wurde in 2.1.2 Dolmetschqualität für die Zwecke der vorliegenden Arbeit als kognitive Wirkungsäquivalenz definiert, die hier als produktbezogener Qualitätsbegriff betrachtet werden soll. Bis auf die stets als sehr wichtig eingestufte Sinnübereinstimmung mit dem Original, die bereits im produktbezogenen Qualitätsbegriff enthalten ist, variieren KundInnenerwartungen, wie bereits erwähnt, unter verschiedenen Zielgruppen sehr stark (siehe auch 3.2.1). Man kann also nicht von einer allgemeingültigen, homogenen Definition von Qualität für DolmetschnutzerInnen ausgehen. Vielmehr ist es sinnvoll, die wahrgenommene Dienstleistungsqualität für die jeweiligen NutzerInnen individuell zu erheben. In diesem Abschnitt soll nun festgelegt werden, wie diese Aspekte messbar gemacht, also operationalisiert, werden sollen.
Wie in 2.1.2 gezeigt wurde, postulieren verschiedene DolmetschwissenschaftlerInnen und PraktikerInnen (z.B. Herbert 1952, Seleskovitch 1988, Déjean Le Féal 1990), dass AT und Dolmetschung die gleiche Wirkung auf ihre jeweiligen RezipientInnen haben sollten; Methoden zur Messung der Erreichung dieses Ziels werden jedoch nicht immer besprochen. In der Skopostheorie (Vermeer 1978: 101) gilt eine Translation als erfolgreich, wenn vom Empfänger kein Protest eingelegt wird. Dies lässt sich jedoch schwer messen und Protest von RezipientInnen kommt in der Praxis zumindest in nicht-dialogischen Dolmetschsettings wohl kaum vor. Déjean Le Féal merkt an, dass man bei Diskussionen auch das Funktionieren der Kommunikation als Zeichen einer geglückten Dolmetschung ansehen könne, was aber nicht mit der Erfüllung der Qualitätsstandards gleichgesetzt werden dürfe (Déjean Le Féal 1990: 156). Sie schlägt daher zur Beurteilung der Verständlichkeit einer Dolmetschung vor, das Verständnis einer „typischen“ DolmetschrezipientIn mit jenem einer vergleichbaren RezipentIn des AT zu vergleichen (Déjean Le Féal 1990: 159). Auch Kalina (2009) spricht sich für einen Vergleich von AT- und ZT-Wirkung aus, da Beurteilungen des ZT durch die RezipientInnen lediglich der Überprüfung der ZT-Rezeption dienen könnten (Kalina 2009: 172):
Dieser Vergleich wäre jedoch eine wichtige Größe für die Bestimmung des Erfolgs der Wirkung des ZT, da die intendierte Wirkung des Originals auf die AT-Rezipienten für die mit der ZT-Produktion intendierte Wirkung eine Rolle spielt (…). Wenn die Relation zwischen ZT und Rezipienten im Mittelpunkt steht, so sind die Verstehensprozesse der Rezipienten einzubeziehen. (Kalina 2009: 170)
Eine tatsächliche Operationalisierung im Bereich des Lautsprachdolmetschens erfolgt zunächst allerdings nur durch Gerver (1972), der die Verständlichkeit verschiedener Dolmetschmodi mittels Hörverständnistests vergleicht, sowie über zwei Jahrzehnte später durch Shlesinger (1994). Sie setzt Hörverständnistests ein, um die Verständlichkeit von Dolmetschungen und vorgelesenen Transkripten derselben Dolmetschungen zu messen (siehe 3.3.1).
Im Bereich des Gebärdendolmetschens ist die Verwendung von Tests zur Beurteilung der Verständlichkeit von Dolmetschungen jedoch wesentlich weiter verbreitet (siehe 3.3). Bereits seit den 1970er-Jahren wurden hier einerseits verschiedene Dolmetschmodi (z.B. Murphy & Fleischer 1977, Cokely 1990, Livingston et al. 1994) oder Dolmetschungen von muttersprachlichen vs. nichtmuttersprachlichen GebärdensprachdolmetscherInnen (z.B. Llewellyn-Jones [1981]/2015) untereinander verglichen, andererseits wurde auch untersucht, ob gehörlose Personen die gebärdete Dolmetschung gleich gut verstehen wie hörende Personen die in Lautsprache gesprochenen Inhalte (z.B. Marschark et al. 2004, Napier & Spencer 2008, Rodríguez Ortiz & Mora Roche 2008).
Im Bereich des lautsprachlichen Dolmetschens wird die Messung der Verständlichkeit der Dolmetschung erst 15 Jahre nach Shlesinger (1994) an der Universität Wien wieder aufgegriffen, wo Hörverständnistests als Teil des im Rahmen des QuaSI-Projekts entwickelten funktional-kognitiven Ansatzes zur Bewertung von Dolmetschqualität (vgl. Pöchhacker 2012) zum Einsatz kommen.
In einem Pilotversuch untersucht Grübl (2010) den Einfluss der Stimmlage auf die Verständlichkeit von Dolmetschungen und vergleicht das Verständnis der Dolmetschungen mit dem des AT (siehe 3.3.2). Diese Methodik wird im QuaSI-Projekt weiterentwickelt und für die Studie zu Simultandolmetschen vs. Englisch als Lingua Franca (Reithofer 2014) sowie die Untersuchung des Einflusses der Parameter Intonation (Holub 2010) und Flüssigkeit (Rennert 2010, 2013, vorliegende Arbeit) auf die kognitive Wirkung der Dolmetschung verwendet.
Wie besprochen soll zusätzlich zu diesem produktbezogenen Qualitätsbegriff auch die kundInnenseitig wahrgenommene Qualität erhoben werden. Beim im Rahmen der vorliegenden Arbeit durchgeführten Experiment ist ein Ratingformat gut geeignet, um die subjektive Bewertung des Versuchsmaterials durch die ProbandInnen zu erheben. Die Ratingfragen können ebenso wie der Hörverständnistest in schriftlicher Form administriert werden. Diese subjektiven Bewertungen können dann den Ergebnissen des Hörverständnistests gegenübergestellt werden, um so ein mehrdimensionales Bild der Qualität zu erhalten und gleichzeitig festzustellen, ob und in welcher Weise die beiden Qualitätsperspektiven auseinandergehen.
Beispiele für die hier besprochenen und andere Methoden der Qualitätsforschung in der Dolmetschwissenschaft finden sich in Kapitel 3, in dem ausgewählte Studien vorgestellt werden, die sich mit Redeflüssigkeit als Qualitätsmerkmal befassen. Der Begriff der Redeflüssigkeit wird nachfolgend definiert.