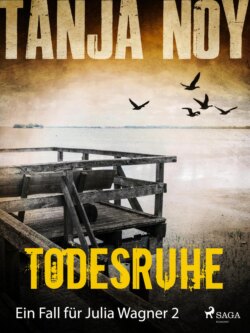Читать книгу Todesruhe - Ein Fall für Julia Wagner: Band 2 - Tanja Noy - Страница 6
2. KAPITEL
ОглавлениеStörung
Fast genau drei Stunden später, um 7:06 Uhr, gab es in der Klinik eine „Störung“. Gerade hatten die Patienten noch im Speiseraum beim Frühstück gesessen, nun fanden sie sich auf dem Flur wieder und beobachteten interessiert, wie Heide Sacher und Jan Jäger mit großen Schritten auf das Zimmer von Karl Waffenschmied zueilten und dann darin verschwanden. Nur wenige Sekunden später kam auch schon Dr. Silvia Sattler angerannt. Auch sie verschwand in dem Zimmer.
Man sagt, das Schlimmste in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik sei die Langeweile. Und tatsächlich, dies entspricht der Wahrheit. Denn wenn man nicht gerade eine Therapiestunde hat, tut man als Patient den ganzen langen Tag nichts anderes, als sich vom Frühstück zum Mittagessen und vom Mittagessen zum Abendessen zu schleppen. Dazwischen raucht man sich zu Tode – sofern man raucht und über genügend Zigaretten verfügt –, führt belanglose Gespräche – sofern man jemanden findet, der dazu in der Lage ist, sich auf belanglose Gespräche einzulassen – und tut ansonsten … nichts.
Vielleicht spielt man gelegentlich ein Gesellschaftsspiel, was wiederum davon abhängt, ob man jemanden findet, der dazu in der Lage ist, den Sinn und die Spielregeln eines solchen Unterfangens zu erfassen. Oft genug ist dies nicht der Fall, was zur Folge hat, dass Prügeleien entstehen, Spielbretter durch die Luft geworfen oder Spielsteine samt Würfel einfach verschluckt werden, was wiederum jede Menge „Störungen“ zur Folge hat. Ansonsten, wie gesagt, tut man nichts. Außer vielleicht die Welt hinter dem Fenster zu betrachten und sich vorzustellen, was all die freien und – mehr oder minder – gesunden Menschen dort draußen jetzt wohl gerade taten. Vielleicht denkt man auch an die Familie, was dieselbe Frage zur Folge hat. Im Sommer ist es besonders schlimm. Weil die Sonne für jeden scheint. Nur nicht für die Patienten in der Klinik.
Nun also überzog mehr oder minder lautes Gemurmel den Flur, denn endlich passierte wieder einmal etwas.
Der Einzige, dem die Ablenkung von aller Tristesse nicht gefallen wollte, war Stefan Versemann. Störungen jedweder Art brachten seinen Rhythmus durcheinander, und das mochte er gar nicht, weil es ihn unsicher machte. Er brauchte feste Konstanten. Dinge, die absolut sicher waren, die sich beständig wiederholten und auf die er sich verlassen konnte. Deshalb legte sich sein Blick nun auch unwillig auf Waffenschmieds verschlossene Zimmertür. Vermutlich hatte der Alkoholiker, der hier schon zum x-ten Mal eine Entgiftung machte, sein Bett angezündet. Das tat er ständig. Genau genommen war das auch schon wieder eine Konstante, auf die man sich verlassen konnte. Beinahe erleichtert atmete Versemann auf. Dann sah er sich um, und sein Blick fiel auf Robert Campuzano. Der große Mann mit den langen Haaren und den vielen Tätowierungen stand, die Arme vor der Brust verschränkt, vor der Tür zum Speiseraum. „He, Schlaumeier“, sagte er.
„Guten Morgen“, murmelte Versemann und wandte den Blick schnell wieder ab. Er hatte es sich zum Grundsatz gemacht, einen großen Bogen um diesen riesigen Kerl zu machen. Allerdings brachte er es auch nicht fertig, ihn nicht zu grüßen. Campuzano war nämlich höchst aggressiv und leicht reizbar. Man durfte ihn auf keinen Fall provozieren.
Ganz in dessen Nähe stand der alte Viktor Rosenkranz, der wieder einmal sein Jesuskind in den Armen hielt. Das Jesuskind war eine Plastikpuppe, die er immer bei sich trug, niemals losließ und beständig fest an sich drückte.
Viktor litt unter Demenz und war in diesem Augenblick ganz bestimmt in einer ganz anderen Welt, denn wäre er in dieser gewesen, dann hätte er sich nicht so nahe bei Campuzano aufgehalten. Jeder, der noch irgendwie – und wenn auch nur andeutungsweise – klar denken konnte, machte einen großen Bogen um den Mann. Und gerade der alte Viktor, der die achtzig bereits überschritten hatte, konnte sich kaum wehren, was ihn zu einem beliebten Opfer machte.
Versemann sah sich weiter um.
Von Elisa Kirsch war weit und breit nichts zu sehen. Von ihr wusste er nur, dass sie früher einmal eine einigermaßen erfolgreiche Balletttänzerin gewesen war. Er erinnerte sich noch sehr gut daran, wie sehr er sich wunderte, als er zum ersten Mal davon hörte.
„Man darf Menschen nicht nur nach ihrem Jetzt-Zustand beurteilen“, hatte Effinowicz damals zu ihm gesagt. „Für sie alle gab es auch einmal ein Leben vor der Klinik.“
Wie auch immer, Elisa war schwer zu berechnen. Sie nahm nicht täglich am Frühstück teil, obwohl das eigentlich zum Pflichtprogramm gehörte, und es war Versemann noch nicht gelungen, eine echte Regelmäßigkeit in ihren Zeiten zu entdecken. Darüber ärgerte er sich, kam aber nicht dazu, weiter darüber nachzudenken, weil er in diesem Moment Ilona Walter entdeckte, die offenbar die Chance nutzte, sich unbemerkt vom Frühstück zu entfernen und für einen Moment in ihrem Zimmer zu verschwinden, um wenig später mit einem Kulturbeutel unter dem Arm wieder heraus und in Richtung Duschraum zu eilen. Das war merkwürdig, denn sonst duschte sie immer schon vor dem Frühstück. Irritiert zog Versemann die Augenbrauen in die Höhe. Eben noch beim Frühstück hatte er Ilona heimlich beobachtet, wie sie sich eine Tasse von dem koffeinlosen Gebräu eingeschenkt hatte, das sie hier Kaffee nannten. Dann hatte sie die Tasse in kleinen, langsamen Schlucken leer getrunken. Neben ihr hatte eine alte, zerfledderte Zeitschrift gelegen, aber sie hatte nicht hineingeschaut. Sie hatte nur vor sich hingeblickt. Das tat sie oft. Und wie meistens hatte Versemann bei sich gedacht: Sie ist sehr, sehr unglücklich.
Sich wieder konzentrierend, sah er sich nun weiter um. Um den Kreis in seinem Kopf zu schließen und die Störung einigermaßen verarbeiten zu können, fehlten ihm noch drei Personen. Unsicher setzte er sich in Bewegung und schritt suchend den Flur ab. Weder Weinfried Tämmerer noch Susanne Grimm hatten am Frühstück teilgenommen. Julia Wagner war zumindest körperlich anwesend gewesen, jetzt aber gerade nicht zu sehen.
Er ging an Aufenthaltsraum und Pflegerzimmer vorbei. Beide Räume lagen sich direkt gegenüber und verfügten über hohe Glastüren – wobei das Glas natürlich kein Glas war, sondern aus Kunststoff bestand –, damit die Pfleger alles im Blick hatten und sofort einschreiten konnten, wenn es im Aufenthaltsraum zu Streitereien kam.
Susanne Grimm hielt sich im Pflegerzimmer auf. Sie war dort mit der Spüle beschäftigt und schien sich nicht für die Störung zu interessieren. Dafür umso mehr für die Freiheit jenseits des Fensters. Immer wieder warf sie sehnsüchtige Blicke hinaus.
Erleichtert atmete Versemann auf. Auch das war eine Konstante. Dieser sehnsüchtige Blick nach draußen war symptomatisch für die Frau mit den bunten Haaren. Sie stand fast immer am Fenster und blickte hinaus. Natürlich wohnte die Sehnsucht nach Freiheit, nach der Rückkehr in die „normale“ Welt, in ihnen allen. Aber bei Susanne Grimm schien sie besonders stark ausgeprägt.
Jetzt schritt auch Julia Wagner an Versemann vorbei. Auch sie schien sich nicht für die Störung zu interessieren, was ebenfalls nichts Ungewöhnliches war. Die Frau schien sich ohnehin für nichts zu interessieren, was um sie herum geschah. Deshalb nahm er ihr auch nicht übel, dass sie ihn nicht grüßte, ging er doch davon aus, dass sie ihn überhaupt nicht wahrnahm. Sie hatte sich völlig in sich zurückgezogen, sprach so gut wie nie, weshalb man auch nicht viel über sie wusste. Untereinander aber munkelten die Patienten, dass ihr etwas ganz Furchtbares passiert sein musste. Etwas, das sie völlig aus der Bahn geworfen hatte.
So schloss sich der Kreis in Stefan Versemanns Kopf. Jedenfalls beinahe.
Noch einmal sah er sich suchend um.
Wo war Weinfried Tämmerer?
Julia hatte Versemann sehr wohl bemerkt. Er interessierte sie nur schlicht nicht. In ihrem Kopf spielten sich ganz andere Dinge ab. Wie in Trance versuchte sie sich auf die Zimmernummern zu konzentrieren, an denen sie vorbeiging, die geraden Zahlen rechts, die ungeraden links. Auf gar keinen Fall wollte sie nachdenken – und konnte es trotzdem nicht verhindern. Einmal mehr hatte sie das letzte Zusammentreffen mit Eva vor Augen …
An jenem Tag im Mai hatte es geregnet, und Julia hatte sich gefragt, warum zum Teufel es auf einmal so heftig regnete. Genau genommen hatte es geschüttet wie aus Eimern. Die Bäume vor dem Fenster bogen sich im Sturm. Von fern grollte der Donner. Ein heftiges, lautes Maigewitter.
Mit bleierner Mattigkeit in den Knochen, die es ihr schwer machte, sich überhaupt zu erheben, hatte Julia Minuten damit zugebracht, sich unter heftigen Schmerzen ein frisches Sweatshirt überzustreifen, als es an die Tür des Krankenzimmers klopfte. Und dann stand sie auf einmal da. Eva.
Das Licht von draußen brachte ihre hellen roten Locken zum Leuchten, und ihre grünen Augen blickten Julia aufmerksam an.
So standen sie sich ein paar Sekunden gegenüber, unbeholfen, jede erwartete von der anderen, dass sie den ersten Schritt tat und damit den Tenor ihres Wiedersehens bestimmte. Und Julia hatte bei sich gedacht: So ist sie also, die Begrüßung, über die ich so lange nachgedacht habe. Zwei ehemalige Freundinnen, die dem Tod nur knapp entkommen sind, sich nun wiedersehen und nicht mehr wissen, wie sie miteinander umgehen sollen. Dann fiel ihr auf, dass ein Koffer an Evas Seite stand. „Du gehst.“ Mehr fiel ihr nicht ein.
„ Ich bin heute entlassen worden.“
„ Schön.“ Julia fühlte ein merkwürdiges Stechen in der Brust und blickte zu Boden.
Eva machte zwei Schritte auf sie zu, dann legten sich ihre Finger einen Moment lang auf Julias Hand. „Es ist besser für mich, wieder dahin zurückzugehen, wo ich hingehöre.“
Julias Blick verharrte auf dem Verband, der um Evas Hand gewickelt war. Sie senkte die Augen und blickte auf die andere Hand, die ebenfalls umwickelt war. Die beiden Verbände verbargen die Narben, die die Nägel darin hinterlassen hatten. Noch. Ein Stigma. Auf alle Ewigkeit deutlich sichtbar für jeden.
„ Es tut mir so leid, Eva. Es tut mir so unendlich leid.“
Julia hatte gedacht, es würde ihr besser gehen, wenn sie es ausgesprochen hatte. Irgendwo in einem kindischen, idiotischen Winkel ihres Gehirns hatte sie die vage Hoffnung genährt, alles würde irgendwie besser werden, wenn sie sich entschuldigt hatte. Vielleicht würde Eva sie beschimpfen, aggressiv werden. Wahrscheinlich hätte es Julia sogar geholfen, wenn es so gewesen wäre. Aber Eva schimpfte nicht. Sie war auch nicht wütend. Sie stand einfach nur da, und Julia stellte fest, was für eine Idiotin sie doch gewesen war. Naiv war das Wort, das sie heute für jene Gedanken von damals fand. Wenn ein Mensch um ein Haar sein Leben wegen eines anderen Menschen verlor, dann war man ein Idiot, wenn man glaubte, eine Freundschaft würde dadurch keinen Schiffbruch erleiden.
„ Wir müssen beide damit leben“, sagte Eva leise. „Du für dich und ich für mich. Verzeih mir.“
Damit ging sie, und die Tür fiel hinter ihr zu.
Julia zählte die Schritte, die sie den Flur auf und ab machte. 199, 200, 201 … Alles war in jenem Augenblick in ihr zerbrochen, sosehr sie Eva auch verstand. Sie fragte sich, was sie wohl getan hätte, wenn auch sie ihretwegen gestorben wäre. Sie musste schon mit Sandmanns Tod leben, wie hätte sie auch noch Evas Tod verkraften sollen?
In diesem Augenblick konnte Julia wieder Langes Gelächter hören. Es war einfach überall, und sie spürte schon wieder einen Anfall von Übelkeit in sich.
Es wäre so einfach, dachte sie. So einfach, dem Ganzen ein Ende zu setzen. Das Ringen zu beenden. Die Stimmen zum Verstummen zu bringen und die Albträume ein für alle Mal zu zerschmettern. Die Vorstellung war verlockend. In gewisser Weise bot sie sogar die Lösung auf alles. Aufhören zu atmen. Aufhören zu träumen. Aufhören zu denken. So, wie Kerstin es getan hatte. Ein Schritt genügt. Ende und aus.
Als Julia das nächste Mal den Blick hob, stellte sie fest, dass sie gerade an Zimmer Nummer 9 vorbeikam. Nicht, dass es wichtig gewesen wäre, sie registrierte es nur. Doch dann trat sie mit ihrem Turnschuh auf etwas und hielt inne. Eine Serviette. Sie bückte sich, um sie aufzuheben.
Es war eine ganz normale, weiße Papierserviette, wie sie jeden Tag zu Dutzenden im Speiseraum ausgegeben wurden. Der einzige Unterschied zu den anderen war der, dass jemand mit einem dicken schwarzen Stift, vermutlich einem Edding, die Zahl 5 darauf geschrieben hatte.
Julia sah sich um. Hatte jemand die Serviette verloren? Die Patienten hier sammelten alles Mögliche, warum nicht auch Papierservietten?
Julias Blick blieb an der Tür hängen, vor der sie gelegen hatte. Sie stand ein Stück weit offen und als sie genauer hinsah, entdeckte sie im Inneren des Zimmers etwas, was sie nicht sofort einordnen konnte. Ein roter Fleck auf dem Fußboden.
Aus dieser Entfernung hätte alles Mögliche dahinterstecken können, aber Julia wusste instinktiv, dass es sich dabei um nichts Gutes handelte.
Sie zwang sich, einen Schritt auf die halb offene Tür zuzugehen. Dann sah sie etwas, was aussah wie ein ausgestreckter Arm, der sich nach Hilfe reckte. In der nächsten Sekunde kippte das Bild vor Julias Augen und formte sich neu. Sie ließ eine Minute verstreichen, zählte die Sekunden. Dann betrat sie das Zimmer.