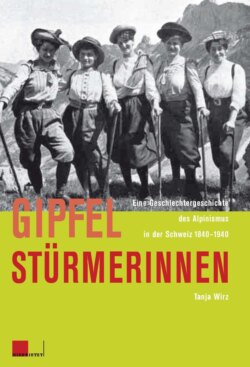Читать книгу Gipfelstürmerinnen - Tanja Wirz - Страница 13
ОглавлениеDAS SCHREIBEN VON TOURENBERICHTEN
Dass Bergsteigen nicht nur aus Klettern, sondern auch aus Schreiben besteht, zeigen die von Angeville erwähnten Aktivitäten auf dem Gipfel: Kaum oben, schrieb sie ihr Motto in den Schnee und verfasste Briefe.204 Während meines ganzen Untersuchungszeitraums war die Publikation eines Berichtes eine zentrale Anforderung an alle, die zur Diskursgemeinschaft der gebildeten Alpenreisenden gehören wollten. Deshalb folgen nun im dritten Teil dieses ersten Kapitels einige Gedanken zum Schreiben von Tourenberichten. Dazu werde ich neben Angevilles Schriften Texte einer weiteren frühen Bergsteigerin, Dora d’Istria, und die Fahrtenbücher zweier schweizerischer Bergsteiger beiziehen.
DER TOURENBERICHT ALS BEWEIS EINER ERSTBESTEIGUNG
Welches war die erste Frau, die bergsteigen ging? Diese Frage wird gerne als Kernstück einer Geschlechtergeschichte des Alpinismus gesehen. Und auch Angevilles Bemühungen, Marie Paradis als Erstbesteigerin des Montblanc abzuwerten, belegen, dass das Ziel, «Erste» oder «Erster» zu sein, für die symbolische Praxis Bergsteigen zentral ist: Der erste Mensch auf dem Piz Sowieso, die erste Frau auf dem XY-Horn, die erste Winterbesteigung, die erste reine Frauenseilschaft, der erste Führerlose, der erste Sauerstofflose: So geht das ohne Ende.205 Unter modernen Alpinisten gilt es als Allgemeinplatz, dass das höchste aller Ziele ist, als Erster auf einem möglichst hohen oder schwierig zu ersteigenden Gipfel zu stehen und darüber einen Text zu publizieren.
Doch die Vorstellung, es sei von besonderem Wert, als Erste oder Erster einen Gipfel zu betreten oder eine Route zu begehen, ist eine moderne Erfindung. Petrarca etwa legte 1336 keinerlei Wert darauf, als Erster auf dem Mont Ventoux gewesen zu sein. Erst im Zeitalter der grossen «Entdeckungs-» beziehungsweise Eroberungsfahrten der europäischen Nationen wurde diese Idee populär. Bezeichnenderweise datiert denn auch eines der frühesten Beispiele einer solchen Erstbesteigung – die Besteigung des bei Grenoble gelegenen Mont Inaccessible durch den Kammerherrn des französischen Königs – von 1492, dem Jahr der «Entdeckung» Amerikas.206
Wie bereits dargelegt, distanzierte sich Angeville von Paradis, indem sie das Klischee der einem anderen Stand angehörenden «naturhaften» Berglerin nutzte. Das wichtigste Argument, mit dem sie die Einheimische als Erstbesteigerin des Montblanc glaubte ausschliessen zu können, war aber die Erklärung, bisher sei noch keine Frau auf dem Berg gewesen, um von ihren Eindrücken zu berichten. Paradis sei wohl auf dem Gipfel gestanden, habe aber im dichten Nebel nichts gesehen.207 Und wer nichts sieht, kann nichts beschreiben und ist folglich auch gar nicht wirklich da gewesen, lautete die implizite Gleichung. Angeville hingegen verfügte über die kulturelle und soziale Kompetenz, einen schriftlichen Bericht über ihre Tour zu verfassen und zu publizieren.
Die Idee, dass Berge erst bestiegen und «erobert» waren, wenn darüber auch schriftlich berichtet worden war, ist ein Standardtopos des alpinistischen Diskurses. Besonders prägnant vertrat diesen Standpunkt einige Jahrzehnte später der amerikanische Alpinist W. A. B. Coolidge. Als Redaktor der Zeitschrift des britischen Alpine Clubs machte er sich Gedanken über die alpinistische Geschichtsschreibung und verfasste 1893 für eine österreichische Bergsteigerzeitschrift einen Artikel zur Frage «Was ist eine ‹Erste Besteigung›?» Darin schrieb er in Lehrsatzmanier, die «alpine Geschichte» beginne «erst mit denjenigen, welche nachgewiesenermassen zuerst die Besteigung ausführten, daher die Wichtigkeit der ersten, notificierten Ersteigung vom historischen Standpunkte aus», und schlug vor, Erstbesteigungen, über welche die Betreffenden nichts publiziert hatten, als nicht durchgeführt zu betrachten, denn seiner Ansicht nach verstiess es gegen den alpinistischen Ehrenkodex, so etwas geheim zu halten.208
Coolidge betrachtete also alle als Alpinisten, die es schafften, einen Tourenbericht zu publizieren. Andere Kriterien wie etwa die soziale Herkunft oder die Absichten des Erstbesteigers sollten demgegenüber keine Rolle spielen. Das war nicht selbstverständlich: Andere waren der Ansicht, nur wer ohne materielle Interessen auf Berge steige, sei ein Alpinist, und schlossen damit alle aus, die dafür Bezahlung erhielten, wie etwa Bergführer oder auch Balmat und Paccard, welche die von Saussure ausgesetzte Geldprämie in Anspruch nahmen.209 Doch auch Coolidges Definition wirkte marginalisierend, indem sie alle jene vom «wahren» Alpinistentum und von der damit verbundenen gesellschaftlichen Anerkennung ausschloss, die nicht über das nötige kulturelle Kapital verfügten, einen Bericht zu publizieren.
Coolidge wollte verhindern, dass er und andere Chronisten des Alpinismus den falschen Personen die Ehre erwiesen, für ihre Leistung gerühmt zu werden. Leistung war dabei nicht im Sinn körperlicher Leistung gemeint – diese wäre ja bei jeder weiteren Besteigung gleich gross –, sondern im Sinn von Entdeckungsleistung. In seinem Text vermengte Coolidge Wissenschaft und Imperialismus, Bergsteigen war für ihn eine Art Eroberungsfeldzug, bei dem es darum ging, als Erster unbekanntes Terrain zu betreten, um es in den eigenen Besitz zu bringen – zumindest symbolisch. Das zeigt sich auch in seiner Wortwahl: Er verglich die «Erstürmung der grossen Gipfel unserer Alpen» mit einem Kampf, in dem die Berge mit Steinen und Lawinen «bewaffnet» und in dem einzelne Touren «Schlachten» oder «Scharmützel» sind.210 Wer die Sache so betrachtete, fand es logischerweise ärgerlich, im Nachhinein schlimmstenfalls feststellen zu müssen, dass der «eroberte» Gipfel schon einem anderen Sieger «gehörte».
Coolidges Kriterien datieren zwar erst rund sechzig Jahre nach Angevilles Montblanc-Expedition, doch galt das meiste davon schon damals. Die Bergsteigerin fasste ihren Bericht dementsprechend ab; dies zeigt ein Vergleich zwischen ihren Tagebuchaufzeichnungen und dem Tourenbericht, in dem Angeville ihre Taten unter Verwendung der passenden Bilder beschrieb und die in der oralen Tradition lebende Marie Paradis ausschloss. Ihre unterwegs gemachten Aufzeichnungen sind vergleichsweise nüchtern: Den Aufstieg beschrieb sie knapp und sachlich, fast ohne Hinweis auf persönliche Erfahrungen, nur die am Schluss erlittene Höhenkrankheit erwähnte sie etwas ausführlicher. Im nachträglichen Bericht hingegen hüpft Angeville dank ihrem überragenden Willen in solcher Leichtigkeit bergan, dass sich ihre Führer in ihrer Männlichkeit bedroht fühlen. Und auch was auf dem Gipfel oben geschah, liest sich im späteren Bericht einiges heroischer als im Tagebuch: Privat notierte Angeville, dass sie weniger sah als erwartet, und am wichtigsten war ihr, ihren Freunden Briefe zu schreiben und Zeichen zu senden, wohl um ihrem unmittelbaren Bekanntenkreis zu beweisen, dass sie es geschafft hatte. Publizieren wollte sie hingegen, dass sie auf dem Gipfel die geforderte ganzheitliche Vision hatte, «wie ein Soldat» ihren Stock aufpflanzte und ein edles Motto ins ewige Eis schrieb. Im Tagebuch schrieb Angeville von Küssen, Umarmungen, sozialen Kontakten zu Freunden und Familie. Im Bericht hingegen merzte sie dies alles aus, zu Gunsten hoher Ideale wie Patriotismus und wissenschaftlicher Erkenntnis – kurz: zu Gunsten einer heroischeren Selbstdarstellung, wie sie besser in den alpinistischen Diskurs passte. Sie hatte damit den gewünschten Erfolg: Es wurde von niemandem angezweifelt, dass Angeville auf dem Montblanc gewesen war. Wie noch zu zeigen sein wird, war dies keine Selbstverständlichkeit für eine Bergsteigerin.
ÜBER DIE EIGENEN TATEN BERICHTEN: EIN SCHWIERIGES UNTERFANGEN FÜR EINE DAME
Henriette d’Angeville musste also einen schriftlichen Bericht über ihre Tour verfassen und wenn möglich publizieren, um als Montblanc-Besteigerin ernst genommen zu werden. Das war nicht nur ihr klar: Sie berichtete, man habe sie allseits beschworen, über ihre Expedition zu schreiben.211 Angeville war alles andere als abgeneigt, hielt es aber für eine schwierige Aufgabe, vor allem für eine Frau – denn eine Dame, die sich nicht damit begnügte, Teil des staunenden Publikums zu sein, das die wagemutigen Taten von Männern wie Saussure durchs Fernrohr bewunderte, sondern in aller Öffentlichkeit von eigenen Taten berichtete, forderte Kritik heraus. In ihrem Bericht behauptete Angeville deshalb, den Text primär für den engsten Familien- und Freundeskreis geschrieben zu haben. Dies war jedoch bloss eine rhetorische Bescheidenheitsgeste.212 In ihrem Tagebuch stellte Angeville Überlegungen zur Suche nach einem Verleger an und berichtete, eine Freundin habe bei englischen Buchhändlern erste Abklärungen getroffen. Ausserdem beauftragte sie acht namhafte Künstler, insgesamt 54 Illustrationen anzufertigen, und 1839 reiste sie auf der Suche nach einem Verleger nach Paris – allerdings vergeblich.213
1900 publizierte eine französische Bergsteigerzeitschrift Angevilles Tagebuchnotizen, das Manuskript des Tourenberichtes hingegen war lange Zeit verschollen. Es wurde erst im 20. Jahrhundert wiederentdeckt und 1987 neu publiziert. Der Herausgeber nahm Angevilles Bescheidenheitsbeteuerungen wörtlich und schrieb im Vorwort, der Text sei nie zur Publikation gedacht gewesen.214 Ein Missverständnis, das auch daraus entstanden sein mag, dass Angeville es nicht auf eine Öffentlichkeit im modernen Sinne abgesehen hatte: Sie wandte sich mit ihrem Werk an das gebildete Publikum der Salons, das sich idealerweise persönlich kannte. Als Autorin und Frau orientierte sie sich in ihrem Verhalten primär an den Normen dieser adeligen Gesellschaft und nicht an der Geschlechterordnung des Bürgertums. In der anonymen Öffentlichkeit der Presse fand Angevilles Expedition zwar ebenfalls grosse Beachtung, doch es scheint, dass ihr daran wesentlich weniger gelegen war als an der Anerkennung ihrer Taten und Schriften im exklusiven Kreis der Salons, ja, sie äusserte ein gewisses Unbehagen gegenüber diesen schlecht kontrollierbaren Publikationen, obwohl gerade Zeitungsartikel sie auch in Paris bekannt gemacht hatten.215 1839 wurde sie am Hof empfangen und zu zahlreichen Soirées eingeladen. Emile Gaillard, der 1947 eine Biografie über sie verfasst hat, zitiert eine Dame der guten Pariser Gesellschaft, die über die Bergsteigerin schrieb:
«Le lion du monde fashionable et intelligent est en ce moment la célèbre Mademoiselle d’Angeville, cette voyageuse intrépide qui, l’année dernière, a gravi le sommet du Mont Blanc, la première, la seule femme qui eut accompli ce dangereux pèlerinage. Chacun veut la voir; on l’entoure, on l’interroge, et Mademoiselle d’Angeville répond, aux nombreuses questions dont on l’accable, avec beaucoup de bonne grâce et d’esprit.»216
Obwohl ihr illustriertes Album in diesen Kreisen Anklang fand, fand Angeville keinen Verleger.217 Berühmt wurde sie jedoch, und sie genoss es, obwohl das Vergnügen ein getrübtes war, da Stolz und Eitelkeit bei einer Frau als besonders schlimme Charaktermängel galten. Das Suchen und Geniessen von Ruhm war für Angeville deshalb ein ständiges Thema.218 Nicht, dass männliche Bergsteiger nicht genauso viel dafür getan hätten, bewundert zu werden – nur reflektierten sie dies selten. Es schien ihnen selbstverständlich, für ihre Leistungen anerkannt werden zu dürfen, weshalb sie es gar nicht erst problematisieren mussten.
Anders Angeville. Ihr Bericht ist von einer seltsamen Mischung aus Bescheidenheit und selbstbewusstem Auftreten geprägt, die auf den schwierigen Status schreibender Frauen in der frühen bürgerlichen Gesellschaft hinweist. Sie beschrieb sich als heroische Alpinistin, wies aber beständig darauf hin, dass ihr der Status als Heldin nicht so recht behage. Und einleitend versteckte sie sich gleichsam hinter einem Schleier weiblicher Bescheidenheit, indem sie notierte, sie könne unmöglich über sich selbst schreiben, denn «je conserve le sentiment délicat des bienséances qui interdit à une femme d’être elle-même l’auteur de son portrait».219 Frauen durften sich demnach also nicht selbst beschreiben, sondern mussten auf die Beurteilung durch andere warten, um etwas über sich zu erfahren. Umso mehr musste sie sich dadurch positionieren, dass sie sich in ihrer Erzählung von anderen bejubeln liess oder auch absetzte – mit ein Grund, weshalb sie Marie Paradis in ihrem Bericht einen wichtigen Platz einräumte: als Negativfolie, vor der sie selbst als Beispiel eines erstrebenswerten, selbstbestimmten Frauenbildes posieren konnte. Denn dass die Beschreibung durch andere nicht immer zufriedenstellend ausfiel, wusste sie nur zu gut: In ihrem Bericht dankte sie ironisch verschiedenen Zeitschriften für ihre «Galanterie», hatten sie sie doch als «jeune Française» und als Frau, die auf die 40 zugehe, bezeichnet. Sie sei in Wirklichkeit älter – nämlich 44 –, verkündete sie kraft der sich selbst zugeschriebenen «qualité d’historien véridique», und wolle sich keines ihrer Jahre «stehlen» lassen.220
Dass Angeville trotz aller gesellschaftlicher Vorurteile einen publikationsreifen Text hinterlassen hat, hängt vermutlich mit ihrem Selbstverständnis und ihrer sozialen Stellung als Aristokratin zusammen. Späteren Bergsteigerinnen fiel es schwerer, mit Berichten über ihre Touren in die Öffentlichkeit zu treten, und manche davon publizierten anonym, unter dem Namen eines männlichen Verwandten, oder blieben gar stumm. Erst die Zeitschriften der im 20. Jahrhundert gegründeten Frauenalpenclubs boten eine geschützte Halböffentlichkeit, die es Bergsteigerinnen ermöglichte, Tourenberichte zu publizieren, ohne in Widerspruch zum gesellschaftlich geforderten Weiblichkeitsideal zu geraten.
DIE «BRAUT DES MONTBLANC»
Mit ihrem Bericht hatte Henriette d’Angeville allen Normen zum Trotz die Definitionsmacht über sich selbst gesucht. Sie behielt sie jedoch nicht lange. Im alpinistischen Diskurs wurde sie immer wieder erwähnt, allerdings unter recht unterschiedlichen Vorzeichen: Während manche sie als Wegbereiterin des Frauenalpinismus priesen, wie 1894 etwa die französische Bergsteigerin Mary Paillon, machten vor allem Männer sie zum blossen Kuriosum. So etwa 1933 der österreichische Alpinist Karl Ziak: «Der Auszug des vierundvierzigjährigen kühnen Jüngferleins erregte natürlich in Chamonix beträchtliches Aufsehen. Das Fräulein stak in einer bis auf die Knöchel reichenden Pumphose, die aber bis zu den Knien durch eine Bluse schamhaft verdeckt war. Ein zeitgenössisches Bild zeigt die Dame sogar in einem Reifrock über eine riesige Gletscherspalte steigend.»221 Von Scham ist bei Angeville selbst nichts zu lesen. Ihr spezielles Kostüm war eine selbstbewusste Eigenkreation. Dabei eine Hose zu wählen, bereitete ihr keinerlei Bedenken; die Vorstellung, Hosen seien für kletternde Frauen zwar praktischer, aber eigentlich unmoralisch und daher zu verstecken, kam, wie bereits erwähnt, erst später auf.
Gerade in Bezug auf die Geschlechterordnung irritierte Angeville Ziak aber offenbar ziemlich: Er meinte, Angevilles Entschluss, den Montblanc zu besteigen, zeuge von «männlichem Wesen», um sogleich klarzustellen, dass sie trotzdem eine Frau war. Er schrieb: «Wie eine Königin sass sie auf dem Gipfel. […] ‹Wollen ist Können› schrieb sie mit ihrem zierlichen Bergstock ins ewige Eis. Und sie stieg noch über den Montblanc hinaus, nämlich auf die Schultern ihrer Begleiter. Anderthalb Meter höher als alle Männer, das war ihr besonderer Triumph, und dafür gab sie den Führern gern einen Kuss.»222 Ziaks Text enthält zahlreiche, teils erotisch aufgeladene Spekulationen über Angevilles Wesen. Zuerst einmal verniedlichte er sie zum «Jüngferlein» und beschrieb ihre Ausrüstung als «zierlich»; gleichzeitig wies er ihr eine moralisch zweifelhafte Rolle zu, indem er behauptete, sie habe die zusätzliche Dienstleistung der Führer freimütig mit Küssen «bezahlt». In dem für die Publikation gedachten Manuskript Angevilles ist nirgends von solchen schwierig einzuordnenden Küssen die Rede. Im Tagebuch hielt sie die entsprechende Episode fest – nur tönt sie bei ihr etwas anders: Die Bergführer hätten in aller Höflichkeit darum gebeten, sie küssen zu dürfen; also eher so, wie man es einer Respektsperson höheren Standes, einem Fürsten oder kirchlichen Würdenträger gegenüber getan haben mochte.223 Zudem ist da nirgends die Rede davon, dass sie auf den Schultern der Männer gesessen hätte, sondern sie schrieb, die Führer hätten sie auf eigenen Wunsch hin und aus «männlichem Stolz» mit verschränkten Händen hochgehoben, damit ihre Kundin höher hinaufgelange als alle anderen Montblanc-Besucher.224 Offenbar hielt Angeville zumindest die Kussepisode aber auch für unpassend für eine «richtige» Bergsteigerin und liess sie im Bericht weg.
Das von Ziak so intensiv behandelte Moralproblem war für Angeville vergleichsweise unwichtig, denn wie bereits erwähnt, zählten die Führer punkto guter Sitten für sie kaum. Als Diener gehörten sie für Angeville praktisch einer anderen Kaste an und stellten – da sie als Partner ohnehin nicht in Frage kamen – keine Bedrohung ihrer Ehre dar. Nicht dass Angeville die Wahrung gesellschaftlicher Formen gleichgültig gewesen wäre, ganz im Gegenteil: Dem polnischen Baron gewährte sie während des Biwaks bei Grands Mulets die gewünschte Visite erst, nachdem dieser sie ganz formell per «Billet» darum ersucht hatte. Und als sie sich im Biwak umkleiden musste, liess sie sich von den Führern eine Umkleidekabine aus Decken aufstellen. Für das Korsett jedoch brauchte sie Hilfe, und einer ihrer Begleiter musste als Kammerzofe fungieren, was Angeville allerdings bloss amüsant und keineswegs unschicklich fand.225
Später wurde die Aristokratin immer wieder «die Braut des Montblanc» genannt, ein Beiname, der nicht aus dem für die Publikation geschriebenen Text stammt, sondern aus ihrem Tagebuch, wo sie sich wiederholt als «Verlobte» des Berges bezeichnete. Dass dieser Beiname den späteren Chronisten der Geschichte des Alpinismus so gut gefiel, dürfte daran liegen, dass Angeville so doch noch in die traditionelle Geschlechterordnung eingeordnet werden konnte, nämlich als Frau in Bezug auf ein männliches Wesen, wenn auch – wie eine Nonne als «Braut Christi» – nicht auf eines aus Fleisch und Blut. Die Bezeichnung eignete sich auch, um Angeville als «alte Jungfer» zu verspotten, die wegen ihres angeblich unweiblichen Charakters keinen Mann gefunden hatte: Die englische Schriftstellerin Claire-Eliane Engel etwa erklärte, Angeville habe den Berg geliebt, weil sie sonst niemanden zum Lieben hatte.226 Engel warf ihr zudem vor, sie sei nur aus Eifersucht auf die Berühmtheit der Schriftstellerin George Sand auf den Montblanc gestiegen.227 Angeville bestritt nicht, Ruhm gesucht zu haben, doch wertete sie dies weder so negativ wie Engel, noch sah sie sich deswegen in Konkurrenz zu anderen Autorinnen.228
Die meisten Autoren bemühten sich jedoch, Angevilles Expedition als grotesk darzustellen, beispielsweise mit dem bereits erwähnten, stereotypen Hinweis auf den angeblich allzu vielen Proviant. Manche sprachen ihr gar den Status als Bergsteigerin ab: Max Senger meinte 1945 in seinem Buch «Wie die Schweizer Alpen erobert wurden» unter dem Titel «Weiblicher Alpinismus», der sich im Kapitel «Hilfsmittel» (!) findet, bis 1854 sei keine Bergtour von Frauen als «hochtouristisch oder alpinistisch anzusprechen». Sämtliche bis dahin vorkommenden Bergsteigerinnen gehören für ihn ins Kapitel der «ergötzlichen Anekdote».229 Zwar erwähnte er Angeville, doch befand er, erst mit «einer Mrs. Hamilton aus England», die 1854 auf dem Montblanc war, beginne «die Reihe der eigentlichen weiblichen Bergsteiger».230 Ob es für diesen Autor undenkbar war, die Chronik des Frauenalpinismus, einer in seinen Augen von Grund auf bürgerlichen Sache, mit einer französischen Adligen zu beginnen? Jedenfalls erteilte er lieber einer ansonsten kaum bekannten, aber gutbürgerlichen Engländerin diese höheren Weihen.
Die Funktion dieser Nacherzählungen von Angevilles Expedition war einmal mehr, die symbolische Praxis Bergsteigen zu kontrollieren. Die Texte gaben implizit zu verstehen, wie man oder allenfalls frau sich zu verhalten hatte, um es «richtig» zu machen und durch die korrekte Investition kulturellen Kapitals die Zugehörigkeit zu einer Gruppe zu bekräftigen. Zum Zeitpunkt all dieser Nacherzählungen hatte sich die relevante Gruppe der Bergreisenden jedoch deutlich geändert: Nun waren es nicht mehr adelige Naturforscher, die bestimmten, welche Arten des Reisens in den Bergen bleibenden Ruhm rechtfertigten und die dazu aufgewendeten Mühen legitimierten, sondern Vertreter des Bildungsbürgertums. In diesen beiden Gruppen hatten Frauen eine sehr unterschiedliche Stellung: Während aristokratische Frauen kraft ihres Standes durchaus ein gewisses öffentliches Machtpotenzial hatten, beschränkte die bürgerliche Ideologie Frauen auf Herd und Heim und wies ihnen eine von Männern abhängige Rolle zu: Nur als Töchter, Ehefrauen oder Mütter von Männern hatten sie Anrecht auf einen Platz in der Gesellschaft. Selbstbestimmte und unabhängige Frauen wie Henriette d’Angeville, die – anders als die vornamenlose Mrs. Hamilton – schlecht als Anhängsel eines Mannes gesehen werden konnte, passten da nicht hinein und wurden ausgeblendet.
DORA D’ISTRIA UND DIE ERSTE BESTEIGUNG DES MÖNCHS
Ein weiterer interessanter Fall einer Frau, die als Erste einen Berg ersteigen wollte, ist Dora d’Istria. Sie ist bis heute im alpinistischen Diskurs gegenwärtig, zum einen, weil es ihr gelang, einen Tourenbericht zu publizieren, zum anderen, weil es manchen Alpinisten erstaunlich wichtig war, immer wieder zu betonen, der von ihr beanspruchte «Gipfelsieg» sei nichtig. «Dora d’Istria» war das Pseudonym der aus der Walachei im heutigen Rumänien stammenden Gräfin Helene Koltzoff-Massalsky, geborene Ghika (1829–1888). Sie publizierte 1856 das Werk «La Suisse allemande et l’ascension du Mönch», in dem sie unter anderem ihre Erstbesteigung des Mönchs schildert. Im in der SAC-Bibliothek vorhandenen Exemplar der deutschen Übersetzung dieses Buches findet sich die belehrende Bleistiftnotiz: «Angebliche Erstbesteigung des Mönch. Wird angezweifelt.» Heute gelten der Wiener Alpinist Sigismund Porges und die Führer Christian Almer sowie Ulrich und Christian Kaufmann mit ihrer Tour im Jahr 1857 als Erstbesteiger des Berges. Nun wäre es geschlechtergeschichtlich allerdings pikant, wenn gezeigt werden könnte, dass in Wirklichkeit einer wagemutigen und unkonventionellen Frau diese Ehre gebührt – doch aufgrund der Quellenlage ist dies unmöglich; bestenfalls kann gesagt werden, es sei ungewiss, was die bergsteigende Gräfin eigentlich genau erreicht hatte. Interessant ist jedoch, wie viel Energie aufgewendet wurde, um sie zu diskreditieren.
Dora d’Istria, die Tochter des Innenministers der Walachei, war wie ihre ganze Familie eine Anhängerin der Aufklärung, befürwortete einen modernen rumänischen Nationalstaat und interessierte sich für Wissenschaft und Kunst. 1840 verliessen die Ghikas aus politischen Gründen Bukarest und zogen an den Dresdner und später den Wiener Hof und schliesslich nach Venedig. 1849 heiratete Helene den russischen Fürsten Alexander Koltzoff-Massalsky (1826–1875) und zog mit ihm nach Petersburg. 1855 verliess sie Russland – vermutlich aus politischen Gründen – und reiste in die Schweiz. Zu diesem Zeitpunkt begann sie unter dem Pseudonym «Dora d’Istria» ihre Karriere als Schriftstellerin und publizierte zahlreiche Reiseberichte und politische Werke. Besonders stark beschäftigten sie die Stellung der Frauen und die Macht der katholischen Kirche, welche sie heftig ablehnte: In einem ihrer Bücher vertrat sie die Ansicht, das Mönchsleben sei unchristlich und ein Import aus dem Brahmanismus und Buddhismus.231
Über ihre Reisen in der Schweiz berichtete sie in verschiedenen europäischen Zeitschriften, unter anderem auch im «Journal des Débats», das bereits Henriette d’Angeville begeistert gefeiert hatte.232 Dora d’Istria verstand ihre Schweizer Reise als politische Forschungsexpedition in ein vorbildliches Land, die ihr Argumente für ihre politische Haltung liefern sollte. In ihrem Bericht befasste sie sich deshalb vor allem mit der schweizerischen Reformation, die sie als Ursache für die Entstehung einer aufgeklärten Freiheit ansah. Zwingli, Bodmer, Lavater, Pestalozzi, Haller und Escher von der Linth waren ihre Helden, die katholische Kirche erhielt einmal mehr vernichtende Kritik. Ihre politischen Analysen bettete sie in romantische Landschaftserlebnisse ein, und ähnlich wie Saussure liess sie ihren Text in einer Bergtour kulminieren, die ihr als Symbol der erfolgreichen Erkenntnissuche diente – höchst sinnreich zudem, dass es ausgerechnet der Mönch war, den die erklärte Gegnerin des Katholizismus bezwungen haben wollte.233
Heute sind die Schriften von Dora d’Istria mehrheitlich vergessen, bloss ihr Reisebericht aus der Schweiz wird im alpinistischen Diskurs ab und zu als kuriose Anekdote über das belanglose Geplänkel einer gelangweilten Gräfin erwähnt.234 Ganz anders zu ihren Lebzeiten: Die Rumänin und ihre Bücher wurden damals in Europa stark beachtet. Als sie während der Niederschrift ihres Berichts neun Monate lang in einem Hotel in Lugano residierte, erschienen Textauszüge aus dem Buch in Tessiner und italienischen Zeitungen. Ihre dezidierte Stellung in religiös-politischen Fragen führte dazu, dass die katholischen Tessiner Ultramontanen gegen sie gerichtete Flugblätter verteilten, was wiederum die protestantisch-liberalen Kreise verärgerte und zu einer heftigen Kontroverse in der schweizerischen Presse führte.235 Ihr Reisebericht wurde schliesslich von zahlreichen europäischen Zeitschriften lobend besprochen: Man rühmte ihre umfassenden Kenntnisse und die gewissenhafte Erforschung des Landes. Die in Genf erscheinende «Bibliothèque universelle» schrieb, das Buch sei «das erste Werk, welches eine Übersicht von dem jetzigen Zustand der Eidgenossenschaft gibt».236 Dass Dora d’Istria ihre Reise als aufklärerische Suche nach einer politischen Utopie in den Alpen inszenierte, bemerkten auch ihre damaligen Rezensenten. So hiess es etwa in der «Revue des Deux Mondes»:
«Wenn die Frau Gräfin Dora d’Istria die deutsche Schweiz bereist, so ist es weniger, um herrliche Aussichten, grossartige Landschaften, erhabene und prächtige Anschauungen zu suchen, als um die Luft jener Berge und Seen einzuatmen, in welchen die religiöse und politische Unabhängigkeit entstand, um über die heldenmütigen Kämpfe zu sinnen, deren Erinnerung diese Täler und diese Schluchten belebt. Nicht die Schweiz sieht sie in der Schweiz, sondern ihr eigenes Vaterland, und wenn ihre Stimme die schweizerische Freiheit preist, so ruft ihr Herz nach der Freiheit der Rumänen.»237
Die Gräfin war zu ihrer Zeit also eine renommierte Publizistin gewesen, und so erstaunt es doch etwas, dass sie im alpinistischen Diskurs später lediglich als extravagante Hochstaplerin präsentiert wurde. Wie konnte es dazu kommen? Den unter schweizerischen Alpinisten geltenden Wissensstand fasst der Historiker Quirinus Reichen zusammen, indem er schreibt, ihre Bergführer hätten die Gräfin, entgegen ihrem Wunsch und ohne dass sie es realisierte, auf einen unbedeutenden Nebengipfel des Mönchs geführt, um die hartnäckige Dame loszuwerden.238
Dora d’Istrias eigener Bericht ist nach allen Regeln der Kunst verfasst und erinnert in vielem an Angevilles Text. Allerdings ist zu Beginn völlig unklar, um welchen Berg es eigentlich geht. Erst wer weiterliest, erfährt, dass die Gräfin eigentlich eine Tour auf die Jungfrau plante.239 Ähnlich wie Angeville berichtete Dora d’Istria, ihre Bekannten seien entsetzt gewesen und man habe ihr Vorhaben für gefährlich und für eine blosse «Laune» gehalten.240 Sogar die Natur schien sich gegen sie verschworen zu haben: Am Abend vor der Tour habe es sintflutartig zu regnen begonnen. Ein Fingerzeig des Himmels? Jedenfalls schrieb Dora d’Istria: «Ich erhob meine Seele zu Gott. In diesem Augenblick brach das Gewitter in seiner ganzen Macht aus; die Lawinen wiederhallten in den Bergen, und das Echo wiederholte tausendfach das Brausen des Falles. Die Sterne erbleichten am Himmel, als ich mein Fenster öffnete.»241 Die Schreckensgeschichten, mit denen man sie abzuhalten versuchte, weckten jedoch ihre Neugierde – und die der Leser – erwartungsgemäss erst recht. Ihre Bergführer seien zuerst wenig begeistert gewesen über den Auftrag, hätten wegen des schlechten Wetters von der Tour abgeraten und zweifelten an der Motivation ihrer Kundin: «Sie suchten in meinen Augen zu lesen, ob meine Festigkeit auch wahr sei. Endlich sagte Johannes Jaun […]: ‹Ich glaube, dass bei dem Mut dieser Dame die Reise unternommen werden kann. Ich habe viele Männer bei solchen Gelegenheiten viel stärker zittern sehen als sie.›»242 Und schliesslich hätten sich die vier nicht weniger mutig zeigen wollen als die fremde Dame.243
Wie Angeville thematisierte auch Dora d’Istria die Kleider, die sie für die Bergtour wählte: schwarzweiss gestreifte Tuchhosen, eine bis zu den Knien reichende Jacke, ein runder Filzhut nach Art der Bergbewohner, ein Paar weite, grobe Stiefel, eine gefärbte Brille zum Schutz vor der Sonne, anders als ihre Bergführer aber kein Schleier.244 Sie beschrieb ihre Garderobe als Männerkleidung, die sie aber nicht unschicklich, sondern bloss ungewohnt kratzig fand. Am Abend vor der Tour übte sie das Gehen darin, denn: «[…] ich fürchtete, es möchten die Führer an mir verzweifeln, wenn sie mich bei jedem Schritt stolpern sähen. Ich war ziemlich gedemütigt. Nur triftige Gründe konnten mich verhindern, meine Frauenkleider wieder anzuziehen. Doch fiel mir ein Ausfluchtsmittel ein. Ich packte meinen Rock und meine Stiefelchen ein und gab sie einem Träger, um mich ihrer zu bedienen für den Fall, dass ich von diesen verdammten Kleidern, die ich so unbequem fand, in meinen Bewegungen allzu sehr gehindert würde.»245
SIGHTSEEING IM REICH DES TODES
Am Sonntag, dem 10. Juni 1855, ging es los, mit vier Bergführern und vier Trägern, die Proviant, Leitern, Stricke und Haken transportierten. Dass es ausgerechnet an einem Sonntag sein musste, noch dazu bei nicht idealem Wetter, mag ebenfalls mit der politischen Haltung der Gräfin zusammenhängen: die Bergtour als weiterer Beweis dafür, dass die katholische Kirche den Fortschritt zur Aufklärung hin nicht aufhalten konnte. Den ersten Teil des Weges legte Dora d’Istria im Tragsessel zurück, weniger aus Bequemlichkeit denn als Zeichen ihres Standes und weil sie sich in der von ihr getragenen Männerkleidung unpräsentabel fühlte.246 Ihre weitere Tourenbeschreibung liest sich wie das Absolvieren eines vorgegebenen Rituals, das Abhaken einer Liste obligatorischer Sehenswürdigkeiten: Ein Gletscher wird bestaunt, «Volkslieder» werden gesungen, beim Anblick eines Jägers wird Schiller zitiert, eine Fahne der Walachei soll auf dem Gipfel gehisst werden, und im Biwak lässt sich die Gräfin von ihren Führern umsorgen, die Idealbilder edler Wilder sind.247
Die Tour ist jedoch auch eine Prüfung: «Man hatte mich meiner eigenen Kraft überlassen, vermutlich um meine Gewandtheit beurteilen zu können. Ich hatte mich an meine Kleider gewöhnt und ging auf dem Schnee sicheren Schrittes vorwärts, indem ich über die Spalten setzte, welche die verschiedenen Eislager trennen.»248 Die Führer freuen sich über ihre Trittfestigkeit und meinen gar, «dass sie mir wegen meines Selbstvertrauens die Leitung des Unternehmens überlassen könnten», so ihre Worte.249 Doch die Gruppe entfernt sich immer weiter aus dem gewohnten menschlichen Alltag, die Schwierigkeiten nehmen zu. Die Gräfin berichtete, sie habe sich in eine «andere Welt» versetzt geglaubt, «in der nichts dem ähnlich war, was ich bis dahin gesehen hatte. […] Wir befanden uns mitten in einer unermesslichen Wüste, im Angesicht des Himmels und der Naturwunder. […] Der Weg wurde immer mühsamer. Wir kletterten auf allen Vieren, wie Katzen rutschend, oder wie Eichhörnchen von einem Felsen zum andern springend.»250 Zudem machten sich erste Anzeichen von Höhenkrankheit bemerkbar, und die Gruppe musste mit Leitern Abgründe überqueren. Dies nutzte die Gräfin allerdings sofort, um den von ihr gesammelten Sehenswürdigkeiten das Erlebnis des erhabenen Gruselns anzufügen: Mit «unbeschreiblichem Entzücken» habe sie «die gähnenden Schluchten» betrachtet, erzählte sie.251 Am zweiten Tag gelangten sie im dichten Nebel um zehn Uhr vormittags auf eine Fläche am Fuss des Mönchs. Dort musste Dora d’Istria eine längere Pause einlegen. Ihre Erzählung folgt mithin dem klassischen dramaturgischen Schema: Kurz vor dem erfolgreichen Schluss kommt die Krise.
Dora d’Istria schrieb: «Wir hatten im vollen Sinne des Wortes unsere Kräfte erschöpft. Der Atem ging uns aus und seit einigen Augenblicken warf ich Blut aus. Dennoch bereute ich weder die Anstrengung noch den Entschluss, der mich bis dahin gebracht hatte. Ich fürchtete nichts, als dass ich vielleicht nicht weiter gehen könnte. Selbst die Luft, die mir so wehe tat, war mir wegen ihrer ausserordentlichen Reinheit ein Gegenstand interessanter Beobachtungen.»252
Während die Gräfin auf diese Weise versuchte, durch eine distanzierende, wissenschaftlich-objektive Betrachtungsweise die Kontrolle zu behalten, beschlossen ihre Führer, das angestrebte Ziel Jungfrau aufzugeben: «Ich bemerkte hierauf, dass man einige Schritte von mir entfernt zusammentrat, um leise zu beratschlagen. Die Wächter [ihre Bergführer] waren voll Besorgnis. […] Ich gab ihnen innerlich Recht, aber es schmerzte mich, dass ich das Ziel, das so nahe zu liegen schien, nicht erreichen sollte.»253 Ein letztes Mal versuchte sie, ihre Begleiter umzustimmen, doch Johann Almer habe gedroht, sie zu verlassen, da er die Fortsetzung der Tour nicht mit seinem Gewissen vereinbaren konnte. Schliesslich – so der Bericht der Gräfin – kam ihr die rettende Idee: Ob nicht stattdessen der näher gelegene Mönch bestiegen werden könnte? Man habe ihr erstaunt mitgeteilt, dieser sei noch unbestiegen. «‹Desto besser›, rief ich aus, ‹so wollen wir ihn taufen!› und indem ich meine Müdigkeit auf einen Augenblick vergass, begann ich festen Schritts vorwärts zu gehen. Da Peter Jaun und Peter Bohren mich so entschlossen sahen, ergriffen sie die Fahne, gingen voraus und pflanzten sie auf den höchsten Spitzen des Mönchs auf, ehe wir selbst dahin gekommen waren.»254 Eine aufklärerische Tat im Namen des geliebten Heimatlandes: Kaum war die Fahne gehisst, habe das Wetter umgeschlagen und der Mönch sei als einziger Berg in der Sonne gestanden. Auf dem Gipfel habe sie denn auch die passenden erhaben-religiösen Gefühle verspürt:
«Das Bild des Unendlichen trat in seiner ganzen furchtbaren Grösse vor meinen Geist. […] Es durchdrang mich eine so mächtige Vorstellung von Gott, dass mein Herz bis dahin nicht Raum gehabt haben konnte, sie zu fassen. Ich gehörte ihm ganz an. Von diesem Augenblick an versenkte sich meine Seele in den Gedanken an seine unbegreifliche Macht.»255
Der Rückweg ging vergleichsweise leicht und lustig vonstatten, und zurück in Grindelwald seien sie bestaunt worden, als seien sie Geister. Aus dem Reich des Todes kehrte Dora d’Istria ihren Worten zufolge geläutert und um eine visionäre Erfahrung reicher zurück; zum Beweis der Tat stellten ihr die Bergführer ein Diplom aus, das sie in ihrem Buch abdrucken liess.256
Es scheint allerdings, dass die Führer ihre Unterschrift entweder unter ein lügnerisches Dokument gesetzt hatten – oder dass sie die gut bezahlte Erstbesteigung des markanten Viertausenders ein zweites Mal verkaufen wollten. Jedenfalls gab Dora d’Istrias Chefführer Johannes Jaun (1806–1860) später dem Gletscherforscher Daniel Dollfus-Ausset zu Protokoll, als dieser die Erlebnisse des Bergführers für sein Buch «Matériaux pour servir à l’étude des glaciers» aufzeichnete, sie hätten Dora d’Istria damals gar nicht wirklich auf den Mönch geführt.257 Jaun erzählte, er sei erstaunt gewesen, dass eine Frau bergsteigen wollte, erwähnte aber – anders als die Gräfin – nichts davon, dass er oder seine Kollegen versucht hätten, sie von ihrem Plan abzuhalten. Detailliert und abschätzig kolportierte er hingegen, dass die Dame so weit wie möglich per Sänfte habe transportiert werden wollen und anschliessend abwechslungsweise geschoben, gezogen und getragen habe werden müssen – für ihn vermutlich Beweis genug, dass sie nicht als «richtige» Bergsteigerin gelten konnte. Zudem habe sie bis zum Erbrechen unter Höhenkrankheit gelitten, und schliesslich habe er, Jaun, beschlossen, es sei Zeit zur Umkehr, da ein längeres Verweilen in der Höhe wegen des kalten Wetters für die schlechter ausgerüsteten Führer gefährlich geworden wäre. Allerdings sei es unter den Begleitern der Gräfin diesbezüglich zu Meinungsverschiedenheiten gekommen: Während die einen geprahlt hätten, noch weiter gehen zu können, hätten er und Lauener beschlossen, die Gruppe und ihre Kundin notfalls zu verlassen. Das überzeugte die anderen schliesslich. Dora d’Istria habe allerdings darauf bestanden, dass die mitgebrachte Fahne aufgestellt werde, und so habe man diese halt auf einen Grat seitlich des Mönchs gesteckt. Dann hätten sie sich an den Abstieg gemacht.258
Seine Unterschrift auf besagtem Diplom erwähnte Jaun in dieser Erzählung mit keinem Wort, und auch sonst bleiben einige Ungereimtheiten, die kein gutes Licht auf die Führer werfen: Warum nahmen sie eine ihrer Ansicht nach derart berguntaugliche Person überhaupt auf eine Jungfrau-Tour mit? Weshalb kehrten sie nicht früher um? Wie rechtfertigte Jaun, dass er seine Kundin in der Not allein gelassen hätte? Und warum stellte er ihr ein Diplom für ihre Leistung aus? Diese Fragen beantwortete der Bergführer nicht, doch das war offenbar auch gar nicht nötig: Von Alpinisten wurde nie daran gezweifelt, dass die Gräfin wegen ihrer Selbstüberschätzung selber daran schuld war, dass sie von listigen Bergführern übers Ohr gehauen worden war.
Die meisten, die über sie schrieben, kannten Jauns Bericht nicht und hielten die Lage trotzdem für eindeutig: Offenbar war es innerhalb des alpinistischen Diskurses zum Allgemeinplatz geworden, dass Dora d’Istria eine Hochstaplerin sei. Zum Beleg wurde eine ganze Liste von «Beweisen» angeführt: Etwa, dass sie allgemein dazu neigte, sich zu idealisieren – was nicht von der Hand zu weisen, für Bergtourenberichte aber durchaus typisch ist. Weiter, dass sie den Aufstieg auf den eigentlichen Berggipfel in ihrem Bericht zu knapp abhandle. Dann: dass es nicht möglich sei, in so kurzer Zeit vom Gipfel des Mönchs nach Interlaken zu wandern, und dass sie den Blick vom Gipfel – ein must in jedem rechten Tourenbericht – nicht beschrieben habe.259
Tatsächlich unterscheidet sich die Passage der eigentlichen Gipfelbesteigung in ihrem Tourenbericht von der vorhergehenden Beschreibung des Aufstiegs durch Knappheit, und es ist aufgrund ihres Textes durchaus denkbar, dass die Gräfin einen anderen Bergspitz bestiegen und diesen in den Nebelschwaden für den Mönch gehalten hatte. Weiter wird argumentiert, sie habe die Führer mit tausend Franken – für damalige Verhältnisse eine Unsumme – dazu bringen wollen, weiterzugehen; wohl ein Versuch, Jauns seltsames Verhalten zu rechtfertigen.260 Und schliesslich heisst es gar, das von den Bergführern ausgestellte Diplom sei der Beweis, dass Istria nicht wirklich oben war, da es damals unüblich gewesen sei, dass Bergführer ihren Arbeitgebern Diplome ausstellten. Vielmehr hätten die Touristen ihren Führern eine Empfehlung ins so genannte Führerbuch geschrieben.261 Henriette d’Angeville, die ein vom Chamonixer Bürgermeister unterzeichnetes Diplom vorzuweisen hatte, wurde dies nie zur Last gelegt, und es fragt sich ohnehin, ob der Kanon der unter Alpinisten gängigen Beweismittel 1855 schon derart festgelegt war oder ob Dora d’Istria hier nicht im Nachhinein an einer erst später festgelegten, stark geregelten Praxis gemessen wird.262
Mangels brauchbarer Indizien ist die Geschichte um die rumänische Gräfin meiner Ansicht nach weniger eine Detektivgeschichte zur Frage: «War sie oben?» als ein Beispiel dafür, wie zentral das Reden und Schreiben über die gemachten Touren für die symbolische Praxis Bergsteigen war und ist. Und in diesem Zusammenhang erscheint es mir bemerkenswert, mit welcher Vehemenz und welcher Fülle von Argumenten versucht wurde, eine Frau im Nachhinein daran zu hindern, der Nachwelt als Erstbesteigerin eines Berges in Erinnerung zu bleiben. Ein selbstbewusst abgefasster Tourenbericht von einer Autorin, die durch ihre Herkunft und ihr Geschlecht einfach nicht ins Wertesystem der alpinistischen Gemeinde passte, war offenbar eine gewaltige Irritation.
FAHRTENBÜCHER: «ES MUSS MATERIAL FÜR GLORREICHE ERINNERUNGEN GESAMMELT WERDEN!»
Ein publizierter Tourenbericht war Bedingung, um als Erstbesteigerin oder Erstbesteiger anerkannt zu werden. Über die eigenen Unternehmungen zu schreiben, war für die meisten Bergsteiger aber auch bei weniger spektakulären Touren wichtig, und so machten viele von ihnen umfangreiche private Aufzeichnungen in Form von Reisetagebüchern beziehungsweise «Fahrtenbüchern», wie es in Bergsteigerkreisen hiess. Ein aufschlussreiches Beispiel einer solchen Dokumentation befindet sich im Besitz des Schweizerischen Alpinen Museums. Es handelt sich dabei um die 17 handschriftlichen Fahrtenbücher des Berner SAC-Mitglieds Paul Montadon (1858–1948) aus den Jahren 1874 bis 1940.263 Montadon war einer der schweizerischen Pioniere des führerlosen Bergsteigens, und das Klettern war ihm wichtiger als sein Beruf als Bankier – zumindest tönt es im von ihm selbst für die SAC-Zeitschrift verfassten Nachruf so.264 Der umtriebige Alpinist dokumentierte seine Touren in nahezu manischer Genauigkeit auf über 5700 eng beschriebenen Seiten. Zusätzlich führte er verschiedene Listen über «Biwaks, freiwillige» und «Biwaks, unfreiwillig», über Touren zusammen mit seiner Frau und über «Solo-Besteigungen», also Alleingänge.265 Seine Berichte sind in launigem, anekdotenreichem Stil gehalten, als schriebe er für die Zeitschrift einer Studentenverbindung, und so finden sich neben der Dokumentation der eigenen Leistungen auch Berichte darüber, wie er und seine Gefährten dem Bier zusprachen und mit Reisebekanntschaften anbandelten, etwa 1889:
«[…] die anziehenden Touristinnen, mit denen wir uns hernach im Gotthardzug zusammenfanden, verdüsterten unsere Stimmung keineswegs. Funer’s übermenschliche Anstrengungen, sich unwiderstehlich oder doch wenigstens interessant zu machen, indem er Kravatte und Kragen entfernte und eine alte Pfeife zwischen die Zähne steckte, hatten höchstens einen Lacherfolg, und in Brunnen verliessen uns unsere Vis-à-vis, ohne dass es uns schien, als ob ihnen die Trennung sonderlichen Schmerz verursacht hätte. Bergsteiger haben mit mannigfachen Schwierigkeiten zu kämpfen, und auch wir überwanden die Versuchung, die Windgälle aufzugeben und den die Französinnen begleitenden älteren Herrn um Erlaubnis anzugehen, uns ihrer Partie anzuschliessen.»266
Durch die Beschreibung der gemeinsamen Erlebnisse bestätigte Montadon seine Zugehörigkeit zur lustigen Männerclique auf grosser Fahrt und festigte seine Identität als Alpinist, der zwar einem Spass nicht abgeneigt war, aber das höhere Ziel stets im Auge behielt. Er schrieb dabei weniger über allgemeine Ziele des Alpinismus, sondern nutzte die vom alpinistischen Diskurs vorgegebenen Vorstellungen zur privaten Selbstdarstellung. Tagebücher sind ein Mittel zum Erschreiben einer eigenen Identität, denn diese beruht neben der Zugehörigkeit zu bestimmten sozialen Gruppen zu einem Gutteil auf autobiografischen Erinnerungen. Das war auch vielen Bergsteigern bewusst: Henriette d’Angeville beispielsweise schrieb in ihrem Tagebuch, die geplante Tour auf den Montblanc sei «un immense souvenir à se créer dans la vie», und die deutsche Bergsteigerin Hermine Tauscher-Geduly meinte 1881 im Bericht über eine Tour auf den Piz Bernina: «Vorwärts denn! Es muss ja Material für neue glorreiche Erinnerungen gesammelt werden.»267 Es handelte sich bei diesen Unternehmungen also nachgerade um die gezielte Produktion wünschenswerter Erinnerungen und damit um eine bewusste Technik der Selbstinszenierung: ein Beleg dafür, wie wichtig Ferien und Freizeit – also das Ausbrechen aus dem Alltag – für die Identitätsbildung moderner Menschen war und ist: Ausserhalb der Zwänge des täglichen Lebens und Überlebens kann ausgewählt werden, an was man sich später erinnern kann, welche Identität man sich selbst er-leben will.
Auch im Fahrtenbuch eines weiteren Alpinisten findet sich die Erklärung, dass die Aufzeichnungen der späteren Erinnerung dienen sollten: Der Schneider und Buchhalter Eugen Wenzel (†1989), ebenfalls SAC-Mitglied, führte von 1920 bis 1984 Fahrtenbücher. Im ersten Heft erklärte er einleitend: «Dem Zwecke späterer Erinnerung zeichne ich hier in diesem Buche alle meine Wanderungen auf. Ich fange zwar etwas spät damit an, denn ich habe bis heute schon unzählige Touren unternommen, sei es mit der Schule, der Familie oder allein.»268 Es folgt eine nahezu endlose Aufzählung aller Spaziergänge, Ausflüge und Wanderungen, an die Wenzel sich noch erinnern konnte, und diese Liste nutzte er sogleich zur kritischen Reflexion seiner Leistungen. «Ich weiss schon, dass ich im Verhältnis sehr wenige Berge bestiegen habe, wenn man die Mannigfaltigkeit der Bündner Berge kennt», vermerkte er bescheiden: «Ich glaube aber, dazu noch genug Zeit zu haben in der Zukunft.»269 Wenzel folgte damit, zusammen mit vielen anderen Alpinisten, der protestantischen Tradition der Tagebuchführung: Durch die Aufzeichnung sämtlicher Leistungen und Verfehlungen sollte systematisch der eigene Gnadenstand kontrolliert werden, zum Zweck der Selbsterkenntnis und stetigen Verbesserung.270
Die Fahrtenbücher stehen daneben allerdings auch in der Tradition der wissenschaftlichen Forschungsreise, auf der noch vor Ort möglichst präzise alle wichtigen Beobachtungen und Vorkommnisse notiert werden sollten. Anders als Montadon hielt Wenzel sich eher knapp und imitierte in seinen Texten den Stil eines Logbuches oder Forschungsjournals. So lautet sein Eintrag zu einer Tour im Juli 1920:
«Schwarzhorn. Auf meine Anregung hin machen wir uns zu 4. am Samstag um 9 Uhr auf die Beine und sind um 12.15 am Flüela Hospiz. Teilnehmer sind Westermann, Lecrupte, Hugi und ich. Extra zu nennen ist ‹Nick›, der Hund Westermanns. Obschon wir nach Abmachung zum Sonnenaufgang hinauf wollten, bleiben wir auf dem Stroh über Nacht. Lustige Szenen mit Nick. 6 Uhr Aufstieg. Über Schnee bis zum Gipfel woselb. wir um 9 Uhr waren. Herrl. Fernsicht und überaus klares Wetter. Abgekocht. 1 Uhr Abstieg. Hugi und ich nach Grischna, die anderen nach Flüela. 6 ½ Uhr zu Hause. Besonders zu bemerken ist, dass ich nie wieder ohne Schneebrille eine Tour mache. Im übrig. hat mich das Gewaltige des Piz Kesch gereizt und der Beschluss zu dessen Besteigung ist in mir ganz gereift. Glück auf!»271
Wenzel bediente sich einer stark typisierten Sprache und deutete Erlebnisse nur an, ohne sie wirklich zu erzählen. Offenbar ging er davon aus, dass er sich bei einer allfälligen späteren Lektüre dann schon noch würde erinnern können, wie die «lustige Szene» mit dem Hund verlaufen war oder was ihm die «herrl. Fernsicht» offenbart hatte. Andernorts hielt er über eine Tour auf den Piz Kesch im Jahr 1920 fest: «Um 3 Uhr aufstehend und typisches Hüttenleben geniessend wird die Spannung immer grösser. Um 4 Abmarsch. Der Gletscher ist fein. Endlich also seh ich ihn, den Kesch, von allernächster Nähe. Ehrfurcht und Freude am Gewaltigen Machwerk der Natur füllen mich aus. Also hinaus! Ich hätte es mir nicht so leicht vorgestellt. Herrl. Aussicht aber leider keine allzu grosse Fernsicht. Jungfrau ist nur noch verschwommen.»272 Auch hier setzte er selbstverständlich voraus, dass bekannt ist, was unter «typischem Hüttenleben» zu verstehen war. Ich meine, dass die Verwendung solcher Formeln darauf hindeutet, wie stark sich Wenzel am bereits bestehenden alpinistischen Diskurs orientierte, um seine Erlebnisse darzustellen und zu deuten. Wie schon am Beispiel Angevilles gezeigt wurde, war relativ streng vorgegeben, wie eine typische Bergtour verlief und vor allem, wie sie dargestellt werden konnte. Beides bestätigt die Ritualhaftigkeit der Aktivität Bergsteigen: Es handelt sich dabei um einen mehr oder weniger vorgegebenen Erlebnisparcours, den es zu durchlaufen galt und gemäss dem unterwegs Erfahrungen gesucht wurden: Die akribische Planung der Tour entgegen allen Warnungen, der mühselige Aufstieg allen Hindernissen zum Trotz, die Euphorie auf dem Gipfel, die siegreiche Heimkehr.
Nicht alle unmittelbar notierten Erlebnisse taugten zur Veröffentlichung, dies zeigte bereits Angevilles Beispiel. Sie selbst bevorzugte jene Geschichten, die sie als autonome Heldin erscheinen liessen, und liess jene weg, die sie als widersprüchlichere, stärker in soziale Netze eingebundene Person zeigten. Das bedeutet aber keineswegs, dass diese für «offizielle» Bergtourenberichte als unpassend erachteten Passagen für die Schreibenden unwichtig gewesen wären. Dazu nochmals ein Beispiel aus Eugen Wenzels Fahrtenbuch, in dem sich auch sehr private Erinnerungen finden: Am 6. April 1923 klagte Wenzel über seine Melancholie: «Spaziergänge. Ich kann nicht sagen, was mir fehlt. Die Energie ist mir fast abhanden gekommen. Man hat gar keinen Mut mehr, etwas Grösseres anzupacken. Noch habe ich keinen ganztägigen Ausflug gemacht. Es langt immer nur zu halbtägigen Spaziergängen in der Umgebung der Stadt.»273 Doch schon bald darauf ging es wieder aufwärts mit ihm, denn auf einer Tour auf den Gletscherducan bei Monstein lernte er seine zukünftige Frau kennen: «Ich beschliesse, auf den Gipfel zu steigen u. auf meine Frage, wer mitmacht, meldet sich ein gewisses Frl. Rösli Hofer, die ich zum 1ten Male sehe. Wir seilen uns an und gehen hinauf. Frl. Rösli geht sehr gut und macht einen feinen Eindruck auf mich.»274 Es blieb nicht dabei, sondern: «Am Samstagmorgen fasse ich urplötzlich den Entschluss, eine Winterbesteigung des Tinzenhorns zu versuchen. Leider fehlt es mir an einem Kameraden und so gehe ich am Mittag auf die Suche. Beim Guggenloch treffe ich Frl. Rösli wie durch ein Wunder u. sie will mitmachen.»275 Schon eine Woche später war aus dem «Fräulein Rösli» das «Rösli» geworden, und eine weitere Woche später konstatierte Wenzel zufrieden: «Ich habe eine Bergfreundin, eine Berglerin gefunden. Rösli. Sie geht sehr gut u. ist ein flotter Kamerad. […] Mit Rösli am Berg zu wandern ist herrlich! Sie ist mir in kurzer Zeit ein ganz unentbehrlicher Freund geworden, sodass ich meine bisherigen fast etwas vernachlässige oder wenigstens in zweite Linie stelle.»276 Hätte er solche Passagen in der SAC-Zeitschrift veröffentlicht, wäre Wenzel das Unverständnis seiner Alpinistenkollegen gewiss gewesen.
***
Alle vier in diesem Kapitel vorgestellten Reisestile – die Pilgerfahrt, das ästhetische Landschaftserlebnis, die wissenschaftliche Expedition und die Suche nach der Idealgesellschaft in den Bergen – blieben bis weit ins 20. Jahrhundert hinein wichtige Bestandteile der alpinistischen Praxis und des alpinistischen Diskurses. Durch die Verwendung dieser Stile sowohl bei der Gestaltung ihrer Bergfahrten wie auch in ihren Tourenberichten distinguierten sich Bergsteiger von Nichtbergsteigern und Einheimischen. Ein «richtiger Alpinist» war nur, wer die relevanten Stile kannte und Elemente aus dieser Palette verwendete. Seit spätestens 1800 war die Fähigkeit, die symbolische Praxis Bergsteigen «richtig» in Szene zu setzen, Teil des von der meist (bildungs)bürgerlichen Elite kontrollierten kulturellen Kapitals, das dazu genutzt werden konnte, die eigene Zugehörigkeit zu dieser herrschenden Gruppe zu bestätigen oder sie zu erlangen. Zu den vier hier vorgestellten Reisestilen kamen ab Mitte des 19. Jahrhunderts drei weitere hinzu, die in der Folge für das Bergsteigen mindestens ebenso wichtig wurden: das Bergsteigen als (symbolische) Eroberung von Territorium, als Schule der Männlichkeit und schliesslich zur Ertüchtigung von individuellem Körper und «Volkskörper». Diese Reisestile werde ich in den Kapiteln zwei bis vier ausführlicher behandeln.