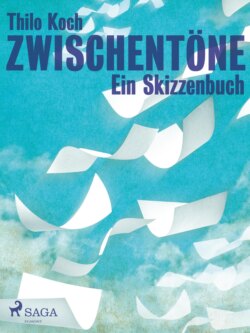Читать книгу Zwischentöne - Ein Skizzenbuch - Thilo Koch - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Oktobertage in Wien
Оглавление»Sie schmausen in Marmor«, sagt Hannerl Matz von den Lipizzanern der Spanischen Reitschule. »Da gehn’s immer über die Straße, und der Verkehr stockt solang.« Wir trafen uns zwischen Burgtheater und Hofburg, sie kommt von den Proben zum »Lear«. Der Mittag ist sonnig, der mildeste Oktober seit Jahren. Johanna geht sehr langsam, die Hände in einem weichen Mantel. Sie ist halb so groß wie auf der Leinwand und hat diese kurzen, schöngeschwungenen Nasenflügel; der Liebreiz der ganzen Erscheinung mildert den feinen Hochmut, der davon ausgehen könnte. Und die Augen, dunkel im blassen, gar nicht zurechtgemachten Gesicht, sprechen vollends anders: eine junge, sinnliche Kraft, eine alte absagende Klugheit, Ehrgeiz und Aufmerksamkeit – und auch Angst?
Wie sehr sie Wienerin ist! »Es gibt keine Erotik mehr in diesen neuen Filmen«, sagt der Star Johanna Matz. Dabei gehört ihre »Jungfrau auf dem Dach« wirklich zu den wenigen Gegenbeispielen. Seit einigem ist Hannerl verheiratet und hat einen Sohn David. Ernsthaft-sachlich hatte sie sich mit »Hackenberg« vorgestellt. Der Gemahl ist Schauspieler, und sie haben eine kleine Wohnung in der City von Wien; an die Filmgagen erinnert ein »Jaguar«.
»Dieses Wien belebt«, sage ich, »und es macht doch müde; überall spüre ich Resignation.« Sie nippt an ihrem Wodka mit Soda: »Wir wissens’ zuviel.«
Wie vertraut mir diese Nonchalance aus Berlin ist. Aber hier kommt noch hinzu ein relativierendes »Geh, schau . . .«
Kann man so Imperialismen überstehen? »Nur so!« antwortet Friedrich Torberg. Nach der Oper gehe ich am »Sacher« vorbei. Er winkt, wie immer Leute um ihn. In drei Tagen lerne ich hier mehr Menschen kennen, die Wien bedeuten, als in drei Jahren Hamburg Hamburger, die Hamburg bedeuten. Das »Café-Haus?« Es ist schon lange nicht mehr »die« Institution. Aber seine Atmosphäre ist noch durchaus da. Torberg beim schwarzen Kaffee und der Orientzigarette, die hier der amerikanischen Virginia widersteht – das ist doch ein Abglanz des alten intellektuellen Wien von Karl Kraus.
Politik und Feuilleton durchdringen, bedingen einander; Witz gehört zur Konsumgüterproduktion, Bildung steht unaufdringlich bereit, wie am Kaffee das Glaserl Wasser, und die Nacht wird zur eigentlichen »Menschheitsbeleuchtung«.
Torberg mag Broch mehr als Musil, das ist bezeichnend. Moralist der eine, und – Nihilist der andere? Aber beide, wie Torberg, »wissen’s zuviel« . . . Und ragen herüber aus den zwanziger Jahren: Emigranten. »Und was heuer fehlt«, sagt Torberg, »das waren, pardon, die Juden für Wien; eine Viertelmillion gab’s hier – viel mehr noch als bei Ihnen in Berlin.« Dennoch, auch heute – Wiens Luft ist voll von jener Legierung aus k. u. k. und Judentum: das Abqualifizieren, der Individualismus, die Melancholie, die Ironie, das Vergesellschaftende, der Sprachsinn. Hofmannsthal als die aristokratisch-konservative Resultante aus alldem: In der Festbeleuchtung des Palazzo Palavicini empfängt der deutsche Botschafter. Ein Minister aus Bonn spricht mit einer österreichischen Prinzessin, einer Enkelin des Erzherzogs. Sie ist jung und hübsch und einfach »liab«. Des Ministers rundes Bayrisch klingt dem Wienerischen verwandt: mein hartes flaches Norddeutsch ist von beiden gleich weit entfernt.
Unter Wiedervereinigung verstehen heute bayrische Minister die nationale Einheit mit Mitteldeutschland, und Österreich hat nach dem Anschlußabenteuer einen spezifischen nationalen Sinn entwickelt, einen kleinösterreichischen für sechs Millionen, den es in imperialen kaiserlichen Zeiten nicht hatte. Seit die Russen es nützlich fanden, ausnahmsweise einmal etwas zu räumen, was sie erobert hatten, seit dem Staatsvertrag von 1955, wächst hier eine zweite Schweiz, dicht am Eisernen Vorhang und zwischen Italien und Deutschland.
Gestreifte Hose und schwarzes Jackett, auch sonst dem »Erfüllungspolitiker« Stresemann nicht unähnlich, stellt sich Julius Raab der deutschen Fernsehkamera. Die Aufnahme ist in dem weißgoldenen Saal, in dem der Wiener Kongreß tagte, wenn er nicht tanzte. Bei allen restaurativen Mängeln: wann jemals wurde ein längerer Friede etabliert in Europa?
Indessen, an die Stelle kaiserlichen Glanzes trat innerhalb von 150 Jahren der biedere Bürgersinn eines Baumeisters aus St. Pölten. Der Bundeskanzler Raab ist Führer einer Volkspartei, der ÖVP. Sein Pressechef sagt zu ihm: »Herr Bundeskanzler, du mußt bitte etwas mehr in die Kamera schauen«, und der Herr Bundeskanzler nickt mit seinem schweren Kopf. Auf den feudalen Teppichen, unter den überlebensgroßen Porträts majestätischer Herrschaften, regiert eine demokratische Lässigkeit – in Preußisch-Bonn unvorstellbar.
Und doch lebt eine eigene bürgerliche Würde in allem; auch darin, wie dieser Bundeskanzler Raab sich ausschweigt. Er residiert königlich – und wohl auch etwas autokratisch – am Ballhausplatz; aber er ist ein schlichter Mann. Geheimdiplomatie empfiehlt der Kanzler im Stresemannanzug seinen deutschen Interviewern. Er lobt die Vertragstreue der Russen, und er klagt die Grenzsperren an zwischen Österreich und Ungarn. Er tut nichts, den Mythos zu nähren, daß er es gewesen sei, der den Staatsvertrag zustande gebracht hätte. »Es hat keinen Zweck, den russischen Bären in den Schwanz zu zwicken«, sagt er zwinkernd.
Raab tritt mit uns auf den Balkon des Ballhauses, auf dem Talleyrand gestanden hat und Metternich und die Majestäten. Unter schweren Lidern und über einem jugendlichen Bärtchen blinzelt er in die Oktobersonne über dem Garten. »Wie schön, daß Wien nicht zerstört wurde«, sage ich. »Oper und Burgtheater und Stephansdom haben schon etwas abbekommen«, entgegnet er in seinem leisen breiten Dialekt, »aber mir ham’s wieder g’richt’.«
Später am Abend gehe ich durch den »Volksgarten« nach Haus. Im Burgtheater »Sappho« vom Nationaldichter Grillparzer. Es war nicht zum Anhören und nicht zum Ansehen. Aber »Weh dem, der lügt« – vom gleichen Autor – soll sehr gut sein. Und das Theater war voll, das Publikum andächtig vor all dem alexandrinischen Stroh. Innen ist »die Burg« billig renoviert, aber äußerlich steht das große Haus noch immer stolz am Ring. Voll lyrischer Süße der gepflegte Garten in seinen letzten Rosen, dem fallenden Laub, den Lichtern der Nacht; weich hupende, gleitende Autos hinter den Hecken und ein schmaler weißer Mond über der Grillparzer-Statue.
Das Gobelin-Foyer der Oper, die luftige Freiterrasse oben, die Aufgänge in Marmor und Gold, die braun befrackten Logenschließer – das ist noch großes 18. Jahrhundert. Hier mag Casanova als Marquis de Seintgalt geglänzt haben, bis die Polizei der prüden Maria Theresia ihn des Landes verwies.
Heute drängen sich Teenager um die Coca-Cola-Batterien des Pausen-Büfetts. Brillanten und Nerze sind vereinzelt an Amerikanerinnen zu bewundern, die allerdings einen Wirtschaftsfaktor ersten Ranges darstellen für Wien.
Vor mir im Parkett ein Pärchen »im Ansaugestadium«; sie machen das aber so lieb und dezent, daß es beinahe hübscher ist als die »Carmen« auf der Bühne. Er hat einen Smoking mit ganz schmalem Seidenkragen, und ihre Ohrringe sind so viel wert wie die Abendgage der Jean Madeira. Auch sie eine Enkelin des Erzherzogs?
Pierre Monteux dirigiert; ich sah ihn einst an seinem angestammten Platz, in San Franzisko. Er ist nun über die Achtzig, und Bizets Feuer dämmt er weise zu besonnenem Genuß. Diese Musik ist evergreen. Glücklicherweise singen sie auf französisch; die Oper ist nur erträglich, wenn man die Worte nicht versteht.
Ein sehr dicker junger Mann ist Herr Qualtinger. In der »Marietta«, dem literarischen Bar-Kabarett Wiens, feiert er Geburtstag. Das Bundesheer wird dort, ohne Schärfe, ironisiert; das Verhältnis der Zarah Leander zu den Nazis (gerade hat sie ihr Comeback in der Josefstadt) wird mit einiger Schärfe karikiert; die Verantwortungslosigkeit einer neuen Jeunesse dorée wird mit bitterem Hohn attackiert; Refrain: »Der Papa wird’s scho richten . . .«
Österreichs Autor Nummer eins, Heimito von Doderer, hält die Geburtstagsrede auf Qualtinger; und Paola Löw, dazu Ehepaar Hackenberg sind in diesem Fall dankbares Publikum. Man kennt einander, sieht einander, trinkt miteinander. Und ist auch boshaft zusammen. Kritiker Hans Weigel sitzt mit Friedrich Torberg und dessen Frau Marietta an einem Tisch – wen wird er morgen auf die gefürchtete Feder spießen?
Die Zeitungen zahlen schlecht, die Bücher bringen hier immer nur Schillinge, wenige. So publizieren sie alle »draußen, im Reich«: Doderer, Torberg, Weigel, Lernet-Holenia. Und Hannerl Hackenberg, geborene Matz, filmt »draußen«. Kabarett läßt sich schlecht exportieren. Kreisslers Chanson vom »guoten aalten Franz« verstehe aber auch ich leicht; es wird mit einem süffisant-intellektuellen Gesicht brillant vorgetragen und hat einen surrealistischen Haut-goût viennois.
Tiefer Nebel, als wir Wien im schwarzen Ford des Presseamtes verlassen. Aber anderthalb Stunden später grelle Sonne über dem Friedhof von Schattendorf. Er ist an zwei Seiten eingefaßt von Stacheldraht und von sechs Reihen Minen. Östlich und südlich ist je ein Wachtturm zu sehen. Durchs Teleobjektiv erkenne ich die Uniformen der ungarischen Doppelposten. Die Stimmung wie bei uns an der Zonengrenze, plus ein Hauch Asien.
Die Sonne ist jetzt sehr warm. Wir sitzen am Rand des Friedhofs im Gras, eine Dorfkirchenglocke läutet, ein neuer österreichischer Posten zieht auf, verschwindet hinter den Grabsteinen.
In Eisenstadt liegt Haydn begraben, wir fahren am Schloß der Esterhazy vorbei und essen Nockerln. Durch slawische Dörfer mit weißen Gänsen und weißen Giebeln; Frauen in Stiefeln und Kopftuch. Gleich hinter Wien fängt der Balkan an, der Osten – obwohl die Russen dawai sind, schon ein paar Jahre, und die Türken viel länger.
Das Bier und der Flughafen machen Schwechat bemerkenswert. Es ist ein Feldflugplatz, Wellblech, Holzstühle, Behelfsfenster, aber daneben verspricht ein Rohbau das neue Empfangs- und Abfluggebäude; bescheidene Maße, aber hübsch und sehr modern. Ich fliege mit der »Alitalia« über München zurück. Eine Maschine der »Aeroflot« wird vorher aufgerufen: nach Moskau. Wien – Drehscheibe zwischen Ost und West, Nord- und Südeuropa. »Es geht uns viel besser«, hat der Taxifahrer gesagt. »Der Schilling steigt sogar a bisserl der D-Mark nach.« Vom Hochhaus-Restaurant aus hab’ ich den »Steffel« gesehen und den Prater, das Riesenrad stand. Der »Dritte Mann« längst abgedreht, die »Vier in einem Jeep« verschwunden. »Wien, Wien, nur du allein . . .«, der Kitsch und der Heurige, die Touristen, die Maderln, Wiener Moden und die Sachertorte in vier genormten Größen.
1,7 Millionen Einwohner, gerade halb soviel wie das heutige Berlin. Aber Wien ist heil und ungeteilt und wieder frei – äußerlich. Ist es auch drinnen heil, und will es mehr, als überleben um jeden Preis? Oder: weiß es zuviel?