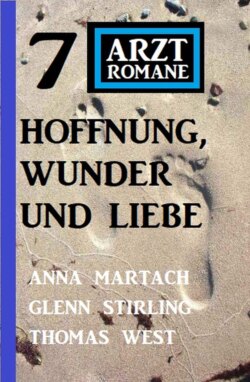Читать книгу Hoffnung, Wunder und Liebe: 7 Arztromane - Thomas West - Страница 34
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление27
Schwester Marianne ließ sich auf einen der Stühle um den Tisch des Personalraums fallen. Müde und ausgepumpt fühlte sie sich. Aber sie hatte es geschafft: Einen ganzen Vormittag lang hatte sie das Opfer eines Verkehrsunfalls gepflegt. Das erste Mal seit fast einem Jahr. Sieben Stunden lang hatte sie bei dem bewusstlosen Patienten im Beatmungszimmer gearbeitet, von einigen kurzen Pausen abgesehen. Sieben Stunden lang hatte sie immer wieder das Bild ihres toten Freundes vor Augen gehabt. Sie war nicht weggelaufen. Und sie hatte nicht eine einzige Beruhigungstablette genommen.
Marianne atmete tief ein und blies geräuschvoll die Luft aus. Bert blickte von seiner Zeitung auf.
„Na, bist geschafft, was?“
Marianne nickte wortlos.
Gemeinsam hatten sie dem Pflegepersonal der Nachmittagsschicht die Patienten übergeben. Jetzt saßen sie hier im Personalraum. Die meisten Kollegen der Frühschicht waren schon nach Hause gegangen. Bert war immer der letzte, der ging. Und sie, Marianne, immer die erste. Jedenfalls seit einem Jahr. Heute war alles anders.
Es war Marianne nicht entgangen, dass ihre Kolleginnen sich verwundert angeschaut hatten, als sie über ihren Patienten berichtete. Schwester Marianne versorgt einen Patienten nach einem Verkehrsunfall? Noch dazu einen so schwer verletzten? Das war lange nicht dagewesen, und die meisten hatten sich daran gewöhnt.
Marianne selbst hatte sich gewundert, wie ruhig und sachlich sie den Verlauf des Vormittags darstellen konnte.
Sie blickte auf die Wanduhr über der Tür. Es war schon nach halb zwei. Zeit, in ihr Zimmer zu gehen. Bert hatte sich wieder in die Zeitung vertieft. Raschelnd blätterte er um. Marianne schenkte sich eine Tasse Kaffee ein.
Der Gedanke an ihr Zimmer, an den einsamen Nachmittag machte ihr Angst. Sie würde allein sein mit ihren Gedanken, allein mit den Eindrücken dieses Vormittags. Was, wenn die Hoffnungslosigkeit und der Schmerz sie wieder überfielen? Was, wenn sie doch noch zusammenbrach?
„He!“, rief Bert plötzlich aus. „Weißt du eigentlich, was für einen prominenten Patienten du hast?“
Verständnislos sah sie ihn an.
„Der ist ein bekannter Regisseur.“ Er reichte ihr die Zeitung und deutete auf einen kleinen Artikel im Kulturteil.
Theaterregisseur Felix Söhnker bei Verkehrsunfall schwer verletzt
lautete die Schlagzeile. Sprachlos starrte Marianne Debras die Schlagzeile an. Sie nahm Bert die Zeitung aus der Hand.
„Theaterregisseur“, murmelte sie und las den Artikel. Zum ersten Mal erfuhr sie etwas über den bewusstlosen Mann, das über die bloßen Personaldaten hinausging. In Köln lebte er, er war unterwegs gewesen zur Gastspielpremiere eines von ihm inszenierten Stückes. Seine Frau hieß Edith mit Vornamen, eine Mathematiklehrerin, und der Unfall war wohl durch Aquaplaning verursacht worden.
Und dann das Foto. Fasziniert hingen die großen, braunen Augen der jungen Frau an dem Gesicht des Mannes. Sie hatte Mühe, es mit dem aufgeschürften und geschwollenen Gesicht des Patienten zu identifizieren, den sie heute Vormittag gepflegt hatte. Doch die weichen Gesichtszüge waren ihr auch an dem Bewusstlosen schon aufgefallen. Ganz anders als Michael. Aber die langen Haare und die Art, wie sie das Gesicht umrahmten, waren ähnlich. Dass sie blond waren, wusste sie aus dieser schrecklichen Begegnung gestern, in der Notaufnahme.
„Theaterregisseur“, murmelte sie wieder.
Auf dem Stationsgang näherten sich Schritte. Dr. Höper und Professor Streithuber gingen an der offenen Tür vorbei. Als der Chefarzt sie im Personalraum sitzen sah, kam er herein.
„Guten Tag, Schwester Marianne, wie geht es Ihnen?“ Er reichte ihr die Hand.
Marianne wusste gar nicht, wie ihr geschah.
„Ich weiß, dass Sie bereits Feierabend haben“, sagte der Professor, „dürfte ich Sie trotzdem bitten, uns zu dem Patienten im Beatmungszimmer zu begleiten?“
Jetzt erst bemerkte er Bert und begrüßte auch ihn mit Handschlag. Marianne nahm aber deutlich wahr, dass der Chef vor allem an ihr interessiert war. Einerseits schmeichelte ihr das, andererseits empfand sie eine ängstliche Unsicherheit. Wollte er sie kontrollieren?
„Ich möchte mir den Mann anschauen“, sagte Walter Streithuber, „und Sie haben ihn den ganzen Tag versorgt und können am besten Auskunft geben.“
Auf dem Weg zum Beatmungszimmer entschuldigte er sich sogar, dass er so spät kam. Das OP-Programm hatte doch länger gedauert, als erwartet.
Der Oberarzt stand bereits am Beatmungsgerät und studierte das Überwachungsprotokoll. Er sah nicht einmal auf, als Marianne mit dem Chef das Zimmer betrat.
Professor Streithuber vertiefte sich in die Verlaufskurve, tastete die Umgebung der Operationswunde am Bauch des Patienten ab und ließ sich von Marianne die Laborwerte und den Verlauf des Vormittags berichten.
Marianne musste beim Anblick des teilweise verbundenen und aufgeschürften Gesichtes an das Bild aus der Zeitung denken. Und sie merkte, dass der Bewusstlose für sie plötzlich nicht mehr nur ein Unfallopfer war, nicht mehr nur irgendein Patient. Er wohnte in Köln, er war Theaterregisseur, seine Frau hieß Edith ...
Während der Chefarzt Felix Söhnker untersuchte und seine Fragen an Marianne stellte, sagte Dr. Höper kein Wort. Mit verschränkten Armen stand er dabei. Ab und zu bedachte er die Schwester mit einem misstrauischen Blick.
„Was meinen Sie, Herr Kollege“, wandte sich der Chef schließlich an den Oberarzt, „sollten wir nicht versuchen, morgen die Muskelrelaxantien und Beruhigungsmittel abzusetzen?“
Um eine wirkungsvolle Beatmung zu gewährleisten, wurden Beatmungspatienten stündlich Medikamente gespritzt, die betäubend und muskellähmend wirkten. Auch Felix Söhnker.
„Sonst wird es schwer zu beurteilen, inwieweit die Bewusstlosigkeit von der Schädelverletzung herrührt.“
Dr. Höper schlug vor, noch einen Tag damit zu warten, und der Professor ließ sich überzeugen.
„Danke, Schwester Marianne“, wieder reichte Walter Streithuber der Schwester die Hand, „und einen schönen Feierabend.“
Als Marianne schon den Stationsgang betreten hatte, rief er ihr noch nach: „Übrigens, Marianne, Sie scheinen ja Ihre Sache sehr gut zu machen – vielen Dank.“
Beflügelt verschwand die junge Frau im Personalraum. Plötzlich hatte sie es sehr eilig, sich umzuziehen. Sie wusste mit einem Mal, dass sie heute Nachmittag etwas vorhatte. Sie würde jemanden besuchen, zu dem sie lange keinen Kontakt gepflegt hatte: Eine alte Freundin aus der Laienspielgruppe.