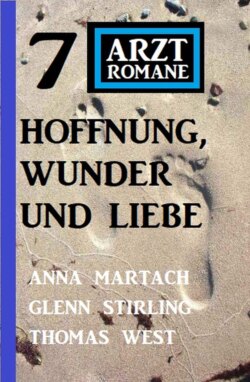Читать книгу Hoffnung, Wunder und Liebe: 7 Arztromane - Thomas West - Страница 38
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление31
„Ich bin Schwester Assisa“, stellte sich die Krankenschwester vor, „ich fahre Sie jetzt auf die chirurgische Station.“
Sie sprach mit einem leicht gebrochenen Akzent. Inderin, schätzte Edith, vielleicht auch Pakistanin. Sie mochte Ende dreißig sein und war etwas mollig. Ihr unglaublich schwarzes Haar trug sie zu einem dicken Zopf geflochten.
Assisa schob Ediths Bett am Aufzug vorbei durch eine offenstehende Glastür. Tausend Gedanken quälten sich durch ihren Kopf.
Warum wollte der Oberarzt, dass der Chefarzt persönlich mit ihr über ihre Verletzungen sprach? War etwas Schlimmes mit ihrem Bein?
Stefan – seit gestern hatte er sich nicht mehr gemeldet. Ein dumpfer Schmerz pochte in ihrer Brust, wenn sie an ihn dachte.
Und Felix, würde er überleben? Wie schwer waren seine Verletzungen? Der Pfleger auf der Intensivstation, Bert hieß er, hatte ihr erzählt, dass Felix an einem Beatmungsgerät hing.
Und dann das Einzelzimmer. Sie war Privatpatientin und hatte einen Anspruch darauf. Der Gedanke, nun für ein paar Tage mit einem jungen Mädchen das Zimmer teilen zu müssen, erregte heftigen Widerwillen in ihr. Sie brauchte ihre Ruhe, sie wollte ungestört mit Stefan zusammen sein, wenn er wieder kommen würde. Würde er bald wiederkommen? Sicher würde er das.
Schwester Assisa öffnete eine breite Tür. 212 war die Zimmernummer. „So, das hier ist Ihr Zimmer.“
Sie schob das Bett hinein. Mit einem kurzen Nicken begrüßte Edith Söhnker das junge Mädchen, das sie mit unverhohlener Neugier und offenstehendem Mund anstarrte. Der Mund hatte einen seltsam schiefen Zug, sie grinste, und ihre Augen schienen Edith unnatürlich groß zu sein.
Assisa befestigte die Fußbremsen des Bettes. Wenigstens einen Fensterplatz, dachte Edith. Auch ein Telefongerät stand schon auf dem Nachttisch. So schnell wie möglich musste Stefan ihre neue Telefonnummer erfahren.
„Das ist Linda“, stellte Schwester Assisa das Mädchen vor. Dann ging sie zu Lindas Bett, beugte sich zu ihr herab und sagte eine Spur zu laut und auffällig langsam: „Das ist Frau Söhnker.“
„Eia! Schön, Fau Söhnke.“ Sie sprach sehr schnell und ein wenig verwaschen.
Edith blickte zu Linda hinüber. Immer noch stand ihr schiefer Mund offen, und immer noch lag ein Grinsen auf ihrem Gesicht. Ein blödes Grinsen, und plötzlich begriff Edith.
Verdammt, sie haben mich zu einer Behinderten gelegt, dachte sie. Empörung flammte in ihr auf. Gleichzeitig aber Scham. Was ist denn so schlimm daran, versuchte eine andere Stimme in ihr sie zu überzeugen. Sie vermied es, Linda anzusprechen. Sie vermied es, überhaupt zu ihr hinüber zu schauen. Obwohl sie die neugierigen Blicke des Mädchens deutlich, geradezu körperlich spürte.
Es war gegen vierzehn Uhr, als der Oberarzt mit dem Professor das Zimmer betrat. Sie erkundigten sich nach ihrem Befinden und versprachen, sich persönlich für ein Einzelzimmer einzusetzen, als Edith sich beschwerte. Schließlich gingen sie auf Ediths Verletzungen ein.
„Die Schnitt- und Quetschwunden in Ihrem Gesicht werden sicher Narben hinterlassen“, sagte Professor Streithuber so einfühlsam wie nur möglich.
Edith war klug genug, diese Feinfühligkeit richtig einzuschätzen: Nicht nur Narben würden die Wunden hinterlassen, entstellt würde sie aussehen, wenn der Verband entfernt und die Fäden gezogen sein würden – hässlich und entstellt. Statt es auszusprechen, erkundigte sie sich mit erstickter Stimme nach ihrem Bein.
„Nun, Sie wissen ja, dass die Kollegen im Zweifel darüber waren, ob sie es nicht besser amputieren“, wieder sprach der Professor leise und vorsichtig.
Amputieren! Zum ersten Mal fiel das Wort. Edith war zutiefst erschrocken. „Amputieren?“, flüsterte sie.
„Glücklicherweise hat der Operateur den Versuch gewagt, das Bein zu retten.“ Professor Streithuber warf Dr. Höper einen Blick zu, den Edith nicht deuten konnte, und der sie noch mehr verunsicherte.
„Und jetzt“, ihre Stimme versagte, „was ist jetzt mit meinem Bein?“
„Keine Angst, wenn sich alles weiter so unkompliziert entwickelt, werden Sie es wohl nicht verlieren.“ Der Professor machte eine Pause und räusperte sich.
Ungläubig starrte Edith ihn an.
„Aber Sie müssen damit rechnen, Frau Söhnker, dass Ihr Bein für immer steif sein wird.“ Wieder schwieg Streithuber einen Moment und sah ernst in Ediths unverbundenes Auge, das sich langsam mit Tränen füllte.
„Unter Umständen werden Sie sogar einen Stock brauchen.“
Alles andere, was der Chefarzt erklärte, ging an ihr vorbei. Nichts mehr konnte sie aufnehmen. Ihr Bein – steif, einen Stock würde sie brauchen ...
Sie merkte auch nicht, dass der Chefarzt seinem Oberarzt ständig durch Blicke bedeutete, doch auch etwas zu sagen. Es fiel ihr auch nicht auf, dass dieser beharrlich schwieg. Erst als die Tür ins Schloss fiel und Edith den schiefen Mund und das blöde Grinsen ihrer Zimmernachbarin sah, kam sie wieder zu sich.
„Stefan“, flüsterte sie, „Stefan!“ Sie warf sich herum und weinte.
Irgendwann griff sie zum Telefon und wählte eine Nummer, die sie seit fast zwei Jahren im Schlaf wählen konnte.