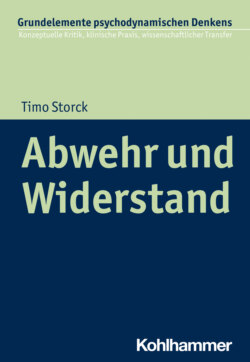Читать книгу Abwehr und Widerstand - Timo Storck - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.2.1 Abwehr im topischen Modell
ОглавлениеIm topischen Modell (gelegentlich als erste Topik bezeichnet) konzipiert Freud das Psychische als in Systemen organisiert und unterscheidet dabei die Systeme Bewusst (Bw), Unbewusst (Ubw) und Vorbewusst (Vbw). Dabei geht es ihm auch um eine Unterscheidung zwischen einem deskriptiv Unbewussten (in systematischer Sicht das Vorbewusste), das bewusstseinsfähig, aber aktuell nicht mit Aufmerksamkeit besetzt ist) und einem dynamisch Unbewusstem (funktionell dem Bewusstsein nicht als solches zugänglich).
Zwischen den Systemen wirkt, wie schon angedeutet, eine Zensur bzw. besser gesagt: Es wirken zwei Zensuren (Freud, 1915e, S. 290): »Wir tun […] gut daran, […] anzunehmen, daß jedem Übergang von einem System zum nächst höheren, also jedem Fortschritt zu einer höheren Stufe psychischer Organisation eine neue Zensur entspreche«. Zum einen gibt es also die Annahme einer Zensur zwischen Ubw und Vbw, welche zum Beispiel die Verdrängung und die Aufrechterhaltung von deren Wirkung plausibel macht, zum anderen aber auch die einer Zensur zwischen Vbw und Bw: Im System Vbw gibt es, so Freuds Annahme, »Abkömmlinge« des Unbewussten, die aber noch auf ihren Eintritt ins Bewusstsein geprüft werden müssen. Während die erstgenannte Zensur darüber entscheidet, was bewusstseinsfähig ist, entscheidet die zweitgenannte darüber, was bewusst wird und als was es das wird.
Der Gedanke einer psychischen Zensur spielt bereits in der Traumdeutung eine Rolle, wenn Freud annimmt, dass im Traum die psychische Zensur herabgesetzt sei, mit der Folge, dass eine größere Offenheit des bewussten Erlebens auch demgegenüber herrscht, was verpönt ist: »Die Erfahrung lehrt uns, daß den Traumgedanken tagsüber d[..]er Weg, der durch das Vorbewußte zum Bewußtsein führt, durch die Widerstandszensur verlegt ist. In der Nacht schaffen sie sich den Zugang zum Bewußtsein«, nachts sinke der »Widerstand ab […], der an der Grenze zwischen Unbewußtem und Vorbewußtem wacht« (Freud, 1900a, S. 547). Es ist weniger an Entstellung erforderlich. Die Zensur wird dabei allerdings »niemals aufgehoben, sondern bloß herabgesetzt« (Freud, 1901a, S. 690), sie bleibt zuständig für eine Entstellung, die Freud als »Zensurveränderung« (1900a, S. 620) bezeichnet. Die Untersuchung der Mechanismen der Traumarbeit (Verdichtung, Verschiebung, sekundäre Bearbeitung) sind ein weiteres Beispiel für Freuds Auseinandersetzung mit Abwehrprozessen als etwas, das bewusstseinsfähige Formen sucht und findet, um die eigene psychische Welt zu erleben. Freud unterscheidet zwischen manifestem Trauminhalt und latenten Traumgedanken, die Traumarbeit produziert aus diesen jenen. Bewusstseinsfähigkeit, Zensur und Entstellung stehen in einem anderen Verhältnis zueinander als im Wachbewusstsein, die Umsetzung in Traumbilder folgt außerdem dem Umstand, dass im Traum/Schlaf der Zugang zur Motilität versperrt ist (a. a. O., S. 573) und sich daher eine leichtere Umsetzung in innere Bilder ergibt.
Die frühe Annahme einer Zensur, insbesondere der zwischen Ubw und Vbw, entsteht also aus der Untersuchung des Traumes, in ihr, so Freud (a. a. O., S. 573), »haben wir […] den Wächter unserer geistigen Gesundheit zu erkennen und zu ehren.« Insbesondere im Wachzustand hilft uns die psychische Zensur dabei, unlustvollen Bedingungen zu entgehen, sozial verträglich zu sein u. a. Die Zensur als »Wächter zwischen dem Unbewußten und dem Vorbewußten« (Freud, 1916/17, S. 307) ist »eine prüfende Instanz […], welche darüber entscheidet, ob eine auftauchende Vorstellung zum Bewußtsein gelangen darf, und unerbittlich ausschließt, […] was Unlust erzeugen oder wiedererwecken könnte« (Freud, 1913j, S. 397).
Wie Freud sich allgemein die Abwehr vorstellt, verdeutlich am besten ein von ihm gezogener Vergleich zu einem öffentlichen Vortrag, den er im Zuge eigener Vorlesungen über die Psychoanalyse verwendet: »Nehmen Sie an, hier in diesem Saale und in diesem Auditorium, dessen musterhafte Ruhe und Aufmerksamkeit ich nicht genug zu preisen weiß, befände sich doch ein Individuum, welches sich störend benimmt und durch sein ungezogenes Lachen, Schwätzen, Scharren mit den Füßen meine Aufmerksamkeit von meiner Aufgabe abzieht. Ich erkläre, daß ich so nicht weiter vortragen kann, und daraufhin erheben sich einige kräftige Männer unter Ihnen und setzen den Störenfried nach kurzem Kampfe vor die Tür. Er ist also jetzt ›verdrängt‹ und ich kann meinen Vortrag fortsetzen. Damit aber die Störung sich nicht wiederhole, wenn der Herausgeworfene versucht, wieder in den Saal einzudringen, rücken die Herren, welchen meinen Willen zur Ausführung gebracht haben, ihre Stühle an die Türe an und etablieren sich so als ›Widerstand‹ nach vollzogener Verdrängung.« (Freud, 1910a, S. 22 f.)
Deutlich wird hier, dass es etwas Störendes (im »Innenraum«) gibt. Die Verdrängung als Form der Abwehr ist das, was den Störenfried nach draußen (also außerhalb des bewussten Erlebens) verfrachtet. Die Dynamik des Psychischen (und der Umstand, dass der Störenfried niemals einfach nur stört, sondern auch Amüsement verspricht) sorgt dafür, dass die Verdrängung/Abwehr (hier weitgehend noch gleichbedeutend verwendet) kein einmaliger Vorgang eines Hausverweises ist: Der Störenfried drängt von draußen wieder hinein und es muss etwas aufgerichtet werden (hier in etwas anderer Weise als später, nämlich in behandlungstechnischer Hinsicht, verwendet: ein Widerstand), das die Wirkung der Verdrängung aufrecht erhält. Abwehr bedeutet nun auch, dass etwas den Störenfried gleichsam neu einkleidet (eine psychische Entstellung bzw. Kompromissbildung) und er in diesem Aufzug unerkannt (d. h. nicht als der erkennbar, der zuvor gestört hat) wieder in den Saal gelassen wird.
Im Freud‘schen Werk ist die terminologische Differenzierung zwischen Abwehr und Verdrängung zunächst unklar beziehungsweise wird beides gleichbedeutend verwendet: Etwas wird vom Bewusstsein ferngehalten. Da das Abgewehrte in Freuds Sicht immer Lust und Unlust nach sich zöge, entsteht ein Dynamismus aus drängenden und verdrängenden Kräften und wie in der Traumarbeit werden auch im Wachbewusstsein beständig Umarbeitungen nötig. Eine solche Konzeption von Ersatz- oder Kompromissbildungen, die dem Motiv des Luststrebens und dem der Unlustvermeidung zugleich gerecht zu werden versuchen, kennzeichnet die Abwehrlehre und dies äußert sich in verschiedenen Abwehrmechanismen in unterschiedlicher Weise. Das führt zum Beispiel zur Konzeption, dass bei der Abwehr in der Regel die Verdrängung und ein weiterer Abwehrvorgang, der für eine Umarbeitung mit dem Ziel der entstellten Bewusstwerdung sorgt, zusammenkommen ( Kap. 3.1).
Die Verdrängung lässt sich in diesem Kontext recht genau bestimmten, zum Beispiel als »Operation, wodurch das Subjekt versucht, mit einem Trieb zusammenhängende Vorstellungen […] in das Unbewußte zurückzustoßen oder dort festzuhalten. Die Verdrängung geschieht in den Fällen, in denen die Befriedigung eines Triebes – der durch sich selbst Lust verschaffen kann – im Hinblick auf andere Forderungen Gefahr läuft, Unlust hervorzurufen.« (Laplanche & Pontalis, 1967, S. 582) Sie ist als solche im Freud‘schen Verständnis aber auch das »Vorbild für andere Abwehroperationen«, da »die Verdrängungsoperation […] sich mindestens als ein Abschnitt bei zahlreichen komplexen Abwehrvorgängen findet« (a. a. O.) (vgl. a. Zepf, 2006b; Moser, 1964).
Dass die Abwehr gelingt, begründet Freud ferner über die Annahme einer »Gegenbesetzung«, worunter er einen »ökonomische[n] Vorgang als Träger zahlreicher Abwehrtätigkeiten des Ichs« versteht: »Er besteht aus der Besetzung von Vorstellungen, Vorstellungssystemen, Verhaltensweisen etc. durch das Ich, die den unbewußten Vorstellungen und Wünschen den Zugang zu Bewußtsein und zur Motilität verwehren können« (Laplanche & Pontalis, 1967, S. 161). Gemeint ist die »Besetzung eines Elements des Systems Vorbewußt-Bewußt, das das Aufkommen der verdrängten Vorstellung [verhindert; TS]« (a. a. O.). Es wird also eine Vorstellung besetzt, damit eine andere nicht bewusst wird, das Vorbewusste verstärkt auf diese Weise »den Gegensatz gegen die verdrängten Gedanken« (Freud, 1900a, S. 610), es ist ein Vorgang, »durch den sich das System Vbw gegen das Andrängen der unbewußten Vorstellung schützt« und es ist dabei »sehr wohl möglich, daß gerade die der Vorstellung entzogene Besetzung zur Gegenbesetzung verwendet wird« (1915e, S. 280). Freud denkt psychoökonomisch: Wenn einer Vorstellung abwehrbedingt die Besetzung entzogen wird, dann muss mit dieser irgendetwas angestellt werden – die Antwortet lautet hier, dass diese Besetzung(senergie) der Abwehr zur Verfügung steht. Die Besetzung einer anderen Vorstellung ist daher sowohl in repräsentatorischer als auch in ökonomischer Hinsicht sinnvoll. Wichtig ist zu beachten, dass mit der Verdrängung hier kein prinzipiell pathologischer, sondern ein allgemeiner Vorgang beschrieben wird. Die Überlegungen sind grundlegend für die Konzeption eines dynamisch Unbewussten. Wie jede andere Abwehroperation betrifft die Verdrängung Elemente der Vorstellungswelt (in der Freud‘schen Terminologie: Triebrepräsentanzen), keine biologischen Elemente und oder andere Personen.
Allerdings werden hier auch die Probleme der Besetzungstheorie und des topischen Modells deutlich. Freud nimmt nämlich auch an (und das muss er auch, wenn das Modell des Seelenlebens ein dynamisches bleiben soll), dass es unbewusste Besetzungen gibt. Die Abwehr entzieht also nicht einfach einer Vorstellung die Besetzung, sondern durch sie ändert sich etwas im Verhältnis von Vorstellungen und Affekten. Hinzu kommt, dass eine solche Personalisierung von Abwehr und Zensur Unklarheiten mit sich bringt, zuallererst: Welchem System ist die Abwehr/Zensur zugehörig?