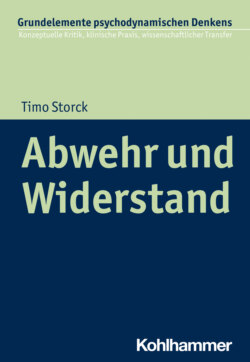Читать книгу Abwehr und Widerstand - Timo Storck - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.1 Die Grundidee der psychischen Abwehr
ОглавлениеIn Freuds Auffassung der Abwehr in allgemeiner Hinsicht (um einzelne Abwehrmechanismen wird es in Kapitel 3.1 gehen, Kap. 3.1) lassen sich drei Merkmale erkennen:
Erstens richtet sie sich auf einen inneren Reiz. Freud schreibt, der »Abwehrvorgang« sei »analog der Flucht«, er stelle »einen Fluchtversuch vor einer Triebgefahr dar« (Freud, 1926d, S. 176). Zieht man allerdings hinzu, dass Freud den Trieb als etwas begreift, das »nicht von außen, sondern vom Körperinnern her angreift«, und daher »auch keine Flucht gegen ihn nützen« kann (Freud, 1915c, S. 212 f.), wird deutlich, dass die hier beschriebene Flucht sozusagen eine Flucht im Erleben ist. Gegen einen unangenehmen äußeren Reiz, etwa ein blendendes Licht, kann ich mich schützen, indem ich mich wegdrehe, eine Hand vor die Augen halte oder schlicht den Raum verlasse. Gegen die »Triebgefahr« kann ich mich nicht derart schützen, allerdings hilft das Bild der Flucht dabei weiter, sich vorzustellen, dass es um ein ähnliches Ausweichen vor Unangenehmen geht, das allerdings die innere Welt umarbeitet: »Die Abwehrvorgänge«, so Freud (1905c, S. 266), »sind die psychischen Korrelate des Fluchtreflexes und verfolgen die Aufgabe, die Entstehung von Unlust aus inneren Quellen zu verhüten«. Es ist jedoch zu beachten, dass die Konzeption von Triebgefahr und Abwehr nicht in a-sozialer, von der Außenwelt unabhängige Weise entsteht und sich vollzieht. Freud meint nämlich, dass die »Triebregungen zu Bedingungen der äußeren Gefahr und damit selbst gefährlich« (1926d, S. 177) werden, insofern die triebbestimmten Handlungen in der Außenwelt bestimmte Folgen haben. Damit ist die Abwehr immer dadurch motiviert, wie sich Triebregung und Realitätsprinzip vereinbaren lassen. Im Kern richtet sie sich dabei auf einen inneren Reiz: Das Bewusstwerden der Triebregung würde Angst, Scham oder Schuldgefühle nach sich ziehen, hätte unangenehme Folgen in der inneren und äußeren Welt.
Damit ist bereits das zweite Merkmal der Abwehr angesprochen: Sie dient der Unlustvermeidung. In der Konflikttheorie ist beschrieben, dass sich ein Gegeneinander aus dem Streben nach Lust bzw. Befriedigung und dem Vermeiden von Unlust ergeben kann. Die Befriedigung eines »Triebes« (besser: Triebwunsches) wäre »an sich lustvoll […], aber sie wäre mit anderen Ansprüchen und Vorsätzen unvereinbar; sie würde also Lust an der einen, Unlust an der anderen Seite erzeugen. Zur Bedingung der Verdrängung ist dann geworden, daß das Unlustmotiv eine stärkere Macht gewinnt als die Befriedigungslust.« (Freud, 1915d, S. 249) Freud entwirft hier ein einfaches Modell dessen, was man Lust-Unlust-Bilanz nennen könnte: Die Abwehr setzt dann ein, wenn das Bewusstwerden einer Vorstellung mehr Unlust als Lust nach sich ziehen würde ( Kap. 2.2 zu einer systemisch-topischen und einer strukturell-instanzenbezogenen Sicht darauf). Unlustvermeidung bedeutet das Vermeiden von unerträglichen Affekten und das Ziel der Abwehr ist es, diese unerträglichen Affekte nicht erleben zu müssen – allerdings im Kontext von etwas, das zugleich auch Lust verspricht. Dazu richtet sie sich auf Triebrepräsentanzen, auf solche psychischen Elemente also, in die sich Triebhaftes hineinvermittelt, das sind bei Freud Vorstellungen und Affekte. Das bedeutet auch, dass nicht »der« Trieb abgewehrt wird – zum einen wäre das widersinnig, weil es sich bei »Trieb« nicht um ein Etwas der biologischen oder repräsentatorischen Welt handelt, sondern um ein Konzept, und zum anderen weil das Konzept sich auf Prozesse der Vermittlung von Physiologie in Erleben bezieht. Dieser Prozess könnte zwar abwehrbedingt unterbrochen sein (das spielt eine Rolle in der Psychodynamik psychosomatischer Erkrankungen), aber die psychische Abwehr richtet sich in der Grundstruktur auf Repräsentanzen, also auf das, was durch die Triebgeschehen genannten Prozesse der psychosomatischen Vermittlung im Erleben entsteht, psychische, durch das Triebgeschehen bewirkte Repräsentanzen in Form von Vorstellungen und Affekten.
Das dritte Merkmal der Abwehr ist, dass es sich bei ihr um unbewusste Vorgänge handelt, die allerdings der Instanz des Ichs zugehörig sind. Dieser Gedanke ist leitend für die Einführung des Instanzenmodells durch Freud und bildet einen von dessen Grundpfeilern. In der Tat führt die Annahme von Abwehrvorgängen gegenüber etwas, das nicht bewusst werden darf, in Schwierigkeiten: Kann es einen bewussten Vorgang geben, dessen Gegenstand unbewusst ist und bleibt? Wäre das nicht so unmöglich, wie auf Aufforderung nicht an einen rosafarbenen Elefanten zu denken? Anders aber: Kann es einen unbewussten Vorgang geben, der genau »weiß«, was sein Ziel ist? Wie unten deutlicher werden wird, gibt Freuds topisches Modell des psychischen Apparates es nicht her, solche zielgerichteten Vorgänge des Systems Ubw zu beschreiben, so dass er ab 1923 die Instanz des Ichs, die in Teilen unbewusst ist, genauer ausformuliert. Zunächst beschreibt er im topischen Modell das Wirken einer »Zensur« zwischen den psychischen »Systemen«, die den Übertritt einer Vorstellung von einem ins andere verhindert – im Instanzenmodell übt diese Funktion das Über-Ich aus, das entscheidet, was für das Bewusstsein annehmbar ist und so mittelbar Abwehrvorgänge motiviert. Als solche ist die Abwehr für Freud ein unbewusster Vorgang »im« Ich (= eine Ich-Funktion) zum »Schutz des Ichs gegen Triebansprüche« (1926d, S. 197).
Die Abwehr zeichnet sich also durch drei Merkmale aus: Sie richtet sich gegen »innere Reize«, dient dem Zweck des Vermeidens unlustvoller Affekte und wirkt unbewusst.