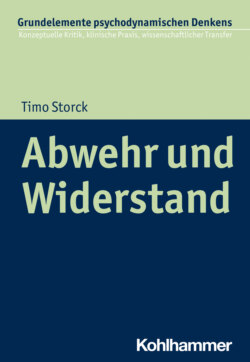Читать книгу Abwehr und Widerstand - Timo Storck - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1 Einleitung
ОглавлениеDer hier vorliegende sechste Band der Reihe »Grundelemente psychodynamischen Denkens« baut auf einigen Überlegungen auf, die in den vorangegangenen Bänden entwickelt worden sind; ich fasse einige der Annahmen knapp zusammen. Dazu gehört auch die Darlegung meines grundlegenden Verständnisses psychoanalytischer Konzepte. Wie jedes andere wissenschaftliche Konzept beruht ein Konzept auch in der Psychoanalyse auf dem Anliegen, Phänomene der in irgendeiner Weise erfahrbaren inneren und äußeren Welt auf den Begriff zu bringen. Konzepte sind dabei Abstrakta, sie sind nicht gegenständlich in der Welt zu finden; so ist das Über-Ich oder die Verdrängung eine konzeptuelle, hoffentlich explikative Bezeichnung für etwas, dessen Wirkungen sich in der Erfahrung (= Empirie, in einem weit gefassten Sinn) zeigen, so etwa das Erleben von Schuldgefühlen oder das Nicht-Erinnern-Können affektiv bedeutsamer Erlebnisanteile. Jeder forscherische Zugang beispielsweise, der etwas messen zu können meint, braucht daher Operationalisierungen der Konzepte, die auf konzeptueller Ebene daher hinreichend genau beschrieben sein sollten (ohne dass dabei auf Spannungsverhältnisse innerhalb des Konzeptverständnisses verzichtet werden sollte). Konzepte sind ferner Teil eines Konzeptzusammenhangs (was zum Beispiel zur Folge hat, dass sich einzelne Konzepte nicht vermittlungslos herauslösen und in einen anderen Kontext setzen lassen) und das in ihnen Gefasste sollte so »sparsam« wie möglich (aber auch so differenziert wie erforderlich) formuliert sein. Bezüglich der psychoanalytischen Konzepte im Besonderen ist hinzuzufügen, dass durch den psychoanalytisch-konzeptbildenden Zugang zum (klinischen) Einzelfall eine Situation entsteht, in der psychoanalytische Konzepte allgemein etwas darüber sagen sollen, wie sich Besonderes darstellt (einen ähnlichen Gedanken äußert z. B. Zepf, 2006a, S. 263), zum Beispiel eine einzelne Behandlung, deren Elemente unter Rückgriff (und Fortentwicklung) allgemeiner Konzepte beschrieben werden. Die Psychoanalyse findet daher ihren Schritt in die Verallgemeinerung in erster Linie in der Konzeptbildung.
Vor dem Hintergrund dieses Verständnisses ist zunächst das Triebkonzept beleuchtet worden (Storck, 2018a). Ein wichtiger zeitgenössischer Nutzen der psychoanalytischen Theorie des Triebes liegt darin, den Übergang von Physiologie in Psychisches zu beschreiben. Es dient dazu, auf den Begriff zu bringen, wie sich physiologienahe Erregungszustände in psychisches Erleben vermitteln, uns dieses sogar aufnötigen. In diesem Sinn beschreibt das Triebkonzept eine Theorie der allgemeinen Motivation: Wie ist Psychisches als solches motiviert? Dabei ist, anders als bei Freud, eine monistische Auffassung des Triebes leitend, es geht weniger um verschiedene Triebarten und spezielle Motivationen, die sich dann als sexuelle oder aggressive enttarnen ließen, sondern in allgemeiner Hinsicht um etwas von der psychosomatischen Grundstruktur des Menschen, was bei Freud (1915c, S. 214) in seiner Formulierung zum Trieb als »Grenzbegriff« zwischen Psyche und Soma angelegt ist. Darüber hinaus handelt es sich nicht um biologische oder ethologische Überlegungen, sondern es lässt sich zeigen, dass sich das Triebkonzept auf ein sozialisatorisches Geschehen bezieht: Erregungszustände finden nicht »a-sozial« statt, sondern treten im Rahmen von Interaktionen bzw. Beziehungen mit anderen auf, in Momenten von Berührung und Nicht-Berührung. Das gibt dem Anderen unweigerlich einen Platz in der Triebtheorie. Das umstrittene Freud’sche Konzept des Todestriebs (vgl. Storck, 2020b) lässt sich als »untertriebener« Aspekt der Triebtheorie verstehen: Während die Sexualität für sich genommen exzessiv und unreglementiert ist (»übertrieben«), wird durch ihre Verschränkung mit dem, was Freud »Todestrieb« nennt, also ein Streben nach Ruhe und Spannungslosigkeit, Befriedigung erst möglich.
Während »Trieb« Teil einer Theorie der allgemeinen Motivation ist, findet die Psychoanalyse ihre Theorie der speziellen Motivation im Konfliktbegriff (Storck, 2018b). Hier wird beschreibbar, wie die Strukturierung des Psychischen mit einem grundlegenden Spannungsfeld in Zusammenhang steht. Es wird dabei deutlich, dass es zum einen um unbewusste psychische Konflikte geht, zum anderen um solche, die mit Lust und Unlust und deren psychischer Dynamik zu tun haben. Der psychoanalytische Begriff der Sexualität ist ein erweiterter: Sexualität beschreibt in ihrer infantilen Form unreglementierte, noch nicht vereinheitlichte leibliche Empfindungen, die in ihrer Grundstruktur mit Lust und Unlust, deren Ansteigen und Absinken zu tun haben. Vor diesem Hintergrund (Sexualität als Lust/Befriedigung, leibliche Interaktion mit Anderen) ist die Freud‘sche Konzeption der psychosexuellen Entwicklungsphasen zu verstehen: Oralität, Analität und das Phallisch-Ödipale sind in ihrer Grundstruktur zwar körpernah konzipiert, in ihrer Vermittlung in Psychisches werden sie allerdings auch zu etwas, das sich »thematisch« begreifen lässt, so dass es dann beispielsweise bei »oralen Themen« um Themen von Versorgung und Bedürfnissen gehen kann. Erst mit Beginn der »reifen«, genitalen Sexualität findet sich das fragmentiert infantil Sexuelle (von Freud daher als »polymorph-pervers« bezeichnet) »gebändigt«. Konflikthaft ist das Geschehen, weil Luststreben und Unlustvermeidung einander in die Quere kommen können; im weiteren Verlauf des vorliegenden Bandes wird dies unter der Perspektive der Abwehr genauer in den Blick kommen (auch im Hinblick darauf, dass sich Konflikte unterschiedlicher psychischer »Reife« unterscheiden lassen). Die Psychoanalyse beschreibt den Menschen grundlegend als konflikthaft, weil sich mit diesen Überlegungen zur Struktur des Psychischen zeigen lässt, in welcher Weise der Umgang mit Motivationen, die in unterschiedliche Richtungen zeigen, als Motor der Entwicklung des Psychischen gesehen werden kann – in besonderer Weise der ödipale Konflikt, der sich im hier vorgeschlagenen Verständnis als etwas darstellt, das sich um die Auseinandersetzung mit Geschlechter- und Generationenunterschieden sowie um die grundlegende Möglichkeit des (passageren) Ausgeschlossenseins aus Beziehungen zwischen anderen dreht. Mit dem Hinweis auf den Konflikt als Motor des Psychischen ist auch gesagt, dass es unbewusste Aspekte des konflikthaften Erlebens sind, um die es der Psychoanalyse geht.
Daher ist es in einem nächsten Schritt der Argumentation um die Konzeption des dynamisch Unbewussten in der Psychoanalyse gegangen (Storck, 2019b). Freuds Anliegen ist es gewesen, mit der von ihm so genannten Metapsychologie eine Theorie des Psychischen zu entwickeln, die ein psychisch Unbewusstes einbezieht – anders als die Psychologie seiner Zeit es tat, etwa sein akademischer Lehrer Franz Brentano, in dessen Intentionalitäts- und Aktlehre es widersinnig erscheinen muss, dass es Unbewusstheit von etwas geben soll. Freud geht es dabei nicht einfach nur um etwas, das nicht im psychischen Erleben auftaucht, sondern um ein dynamisch Unbewusstes, das heißt um etwas, das funktionell, aus guten psychoökonomischen Gründen dem bewussten Erleben nicht (mehr) zugänglich ist, dieses aber umso stärker leitet. Es ist das Zusammentreffen drängender und verdrängender Kräfte, das psychische Mechanismen mobilisiert, die dafür sorgen, dass etwas aus dem Bewusstsein ausgeschlossen wird bzw. dort nur in entstellter Form auftauchen kann. Dass auf diese Weise etwas unbewusst wird, hat mit dem (unbewussten) Ziel der Vermeidung unlustvoller Affekte zu tun. Es zeigt sich auch, dass »unbewusst« keine Substanz oder Essenz beschreibt und sich nicht an einer psychischen Örtlichkeit finden lässt, sondern ein Merkmal von Teilen der Vorstellungswelt ist. »Unbewusst« wird dann zu etwas, das Verhältnisse zwischen Vorstellungen und Affekten beschreibt. In diesem Kontext sind Freuds Modelle des psychischen Apparates wichtig, besonders die sog. erste Topik (bzw. das topische Modell) aus den Systemen Bewusst, Vorbewusst und Unbewusst sowie die sog. zweite Topik (bzw. das Struktur- oder Instanzen-Modell) aus Ich, Es und Über-Ich.
Bei den Überlegungen zu Motivation und Bewusstheit/Unbewusstem sind bis dahin Konzeptionen psychischer Repräsentation implizit geblieben, was darauf folgend in der Untersuchung des Objektbegriffs in der Psychoanalyse genauer ausgearbeitet worden ist (Storck, 2019c). Das Konzept des psychischen Objekts wurzelt terminologisch in der Triebtheorie (als eines der vier Elemente des Triebes, neben Ziel, Quelle und Drang), gemeint ist das Objekt psychischer »Besetzung« (mit Libido oder Aggression, oder einfacher gesagt: mit Affekt), es ist also das Objekt der Vorstellung gemeint. Dabei hat es sich als nützlich erwiesen, vom »Objekt« als Element der subjektiven psychischen Welt zu sprechen und das konkrete Gegenüber in einer interpersonalen Situation nicht als »äußeres Objekt« oder ähnlich zu bezeichnen, sondern als »Gegenüber« oder »andere Person«. Psychoanalytisch lassen sich Mechanismen beschreiben, mittels derer das Objekt psychisch gebildet und verändert wird, nämlich Introjektion (verwoben mit Projektion), Identifizierung oder die Fantasie von Inkorporation, also, etwas vom anderen in sich hineingenommen zu haben. Das macht zum einen das Wechselspiel zwischen Hineinnehmen und Hinaushalten deutlich, zum anderen weist es darauf hin, dass ein »Objekt« immer Teil der subjektiven Innenwelt ist – nicht nur weil die Repräsentanzen der eigenen Person und die von anderen Personen miteinander verbunden sind (als Beziehungsvorstellungen), sondern auch weil es um die Repräsentanzen geht, die das Individuum von sich in Beziehung zu anderen hat. Eine grundlegente Auffassung in der Psychoanalyse (meistens im Zusammenhang von Theorien der Symbolisierung gefasst) besteht darin, sich psychische Entwicklung als etwas vorzustellen, in dem sich Interaktionen in Beziehungsvorstellungen niederschlagen, aus denen sich Vorstellungen (= Repräsentanzen) vom Selbst (vgl. dazu Storck in Vorb. a) und von Anderen (und deren Verbindung durch Affekte) herauslösen lassen und die weitere Interaktionen zwar nicht determinieren, so aber doch unweigerlich bewusst und unbewusst leiten. Es wird deutlich, dass solche Repräsentanzen und der (symbolisierende) Prozess ihrer Bildung und Wirkung unterschiedlich integriert oder psychisch ausgearbeitet sein können, was eine Rolle spielt, wenn auf die »Reife« von Abwehrmechanismen geblickt wird. Außerdem wird im Rekurs auf die Objektkonzeption beschreibbar, wie sich psychische Konflikte nicht allein auf motivationaler, sondern auch auf repräsentationaler Ebene zeigen.
Die zentrale Überlegung, dass Beziehungsvorstellungen dafür leitend sind, wie wir aktuelle Interaktionen erleben und gestalten, taucht auch im Konzept der Übertragung auf (Storck, 2020a). Meistens als ein behandlungstechnischer Begriff verstanden, der sich darauf bezieht, was sich in der analytischen Beziehung aus vorangegangenen Beziehungen wiederholt, somit zeigt und verändert werden kann, beschreibt »Übertragung« zunächst einmal einen Weg des Bewusstwerdens von mit unlustvollen Affekten verbundenen Elementen der inneren Welt. Damit ist gemeint, dass Affekte oder Fantasien sich an Vorstellungen knüpfen, die weniger ängstigend, peinlich oder mit Schuldgefühlen verbunden sind, so dass etwas in ihrem Umfeld bewusst werden »darf«. Freud hat dies für den Behandlungsprozess genutzt, indem er Übertragungsphänomene darin konzipierte und dies ins Zentrum der psychoanalytischen Technik und Veränderungstheorie rückte (verbunden mit anderen Konzepten wie Regression, Wiederholung, Deutung oder Durcharbeiten; vgl. dazu auch Storck in Vorb. b). Es lassen sich also eine weite Begriffsfassung (Übertragung bedeutet, dass Affekte oder Fantasien im Umfeld einer anderen Vorstellung bewusst erlebbar werden) und eine enge Begriffsfassung (Übertragung bedeutet, dass eine Beziehung davon geprägt wird, was in anderen Beziehungen erlebt wurde) unterscheiden. Für unterschiedliche psychische Störungen lassen sich unterschiedliche charakteristische Übertragungsformen und -phänomene beschreiben, zudem wird das Konzept in verschiedenen psychoanalytischen Richtungen unterschiedlich verstanden und führt auch zu unterschiedlichen Handhabungen in der Technik. Zugleich zeigt sich darin, dass Übertragungsphänomene weder auf die klinische Situation, noch auf psychisch kranke Menschen beschränkt sind. Erkennt man an, dass das Konzept sich vor allen Dingen darauf bezieht, dass und wie aktuelle Beziehungen im Licht der vergangenen erlebt und gestaltet werden, dann hat dies auch eine Relevanz dafür, wie Psychoanalytiker ihre Patienten erleben1. Es kann zwischen Gegenübertragung (als zunächst erlebnismäßiger »Beantwortung« der Übertragung des Patienten durch den Analytiker) und Eigenübertragung (als eigene, d. h. patientenunabhängige Anteile, die der Analytiker einbringt) unterschieden werden, wobei wichtig ist, dass es sich um eine konzeptuelle und somit abstrakte Unterscheidung handelt, was die Herausforderung mit sich bringt, in konkreten Situationen das Zusammenwirken beider reflektieren zu können. Die Konzepte Übertragung und Gegenübertragung sollten dabei nicht als etwas missverstanden werden, das sich auf konkret trennbare, womöglich aufeinander folgende Prozesse bezieht – vielmehr geht es um die gemeinsam gestaltete Szene in der analytischen Situation, die demzufolge auch szenisch verstanden wird, um so zu erkennen, was im »Hier-und-Jetzt« der konkreten Begegnung hinsichtlich der Modi des Erlebens von Beziehung und Affekt leitend ist (neben dem methodologischen Konzept des szenischen Verstehens ist hier auch der Begriff der projektiven Identifizierung in seiner behandlungstechnischen Bedeutung wichtig; weiter unten wird er in der Bedeutung als Abwehrmechanismus erläutert, Kap. 3.1.16).
Einige Fragen sind dabei bislang offen geblieben, in erster Linie solche, die sich darauf beziehen, wie nun etwas unbewusst wird oder wie die (Abwehr-!) Prozesse, die für Unbewusstheit sorgen, ihrerseits motiviert sind. Wie lässt es sich auf den Begriff bringen, dass es in irgendeiner Weise zielgerichtete Prozesse gibt, die allerdings, um überhaupt etwas unbewusst werden oder bleiben lassen zu können, ihrerseits unbewusst sind? Ein weiteres Feld, das genauer beleuchtet werden muss, ergibt sich aus der Erkenntnis, dass es in analytisch-therapeutischen Veränderungsprozessen nicht damit getan ist, Patienten darauf hinzuweisen, dass ihnen etwas unbewusst ist, und was – und sei es noch so sehr in der aktuellen Beziehung spürbar. Denn der Annahme folgend, dass bewusste Erlebensweisen, und insbesondere psychopathologische Symptome, Versuche sind, mit psychischen Konflikten umzugehen, muss auch angenommen werden, dass einmal gefundene psychische Kompromissbildungen (aus unterschiedlichen Motiven, zur Bewältigung motivationaler und repräsentationaler Konflikte) nicht so leicht aufgegeben werden. Der Behandlungsprozess muss also einen Umgang damit finden, dass sich Widerstandsphänomene zeigen, die sich gegen die Veränderung, die in erster Linie auch als Verunsicherung erlebt wird, richten.
1 Ich werde im Folgenden kapitelweise zwischen einer durchgängigen Verwendung des generischen Maskulinums und des generischen Femininums wechseln (außer in Zitaten). Sofern nicht explizit ausgewiesen, etwa in einem Fallbeispiel, sind dabei jeweils alle Geschlechter gemeint.