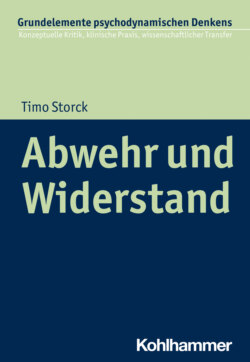Читать книгу Abwehr und Widerstand - Timo Storck - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.2.2 Abwehr im Instanzen-Modell
ОглавлениеSoweit bewegen sich die Freud‘schen Überlegungen im Rahmen des topischen Modells. Es geht um Systeme und Zensuren zwischen diesen. Mit Beginn der 1920er Jahre allerdings wird eine Veränderung in Freuds Konzeption dessen, wie der psychische Apparat aufgebaut ist, erforderlich, in erster Linie unter der Perspektive der Abwehr. Denn die Abwehrvorgänge erfüllen nicht die Merkmale, die Freud für Inhalte und Vorgänge des Systems Ubw annimmt: nämlich das Herrschen des Lustprinzips bzw. des Primärvorgangs, freie Verschiebbarkeit von Besetzungen, Zeitlosigkeit. Außerdem: Wie könnte ein Vorgang sich selbst erzeugen oder zum Gegenstand nehmen (denn das müsste ja so oder so ähnlich angenommen werden, wenn die Abwehr im System Ubw operieren würde)? Freud (1923b, S. 244) stellt also fest: »Wir haben im Ich selbst etwas gefunden, was auch unbewußt ist, sich gerade so benimmt wie das Verdrängte, das heißt starke Wirkungen äußert, ohne selbst bewußt zu werden«. Gemeint ist damit die Abwehr, die einerseits eine Art von Organisiertheit oder Gesteuertheit aufweist (immerhin gibt es eine Art von Intentionalität oder Zielrichtung), andererseits selbst unbewusst sein muss, damit das Abgewehrte unbewusst werden oder bleiben kann. Freud meint also: »Von diesem Ich gehen auch die Verdrängungen aus« (a. a. O., S. 243).
Das zweite große Problem, das zu einer Re-Formulierung des psychischen Apparates durch Freud führt, hängt mit der Frage zusammen, »wo« die Zensuren zwischen den Systemen arbeiten: Gehören sie jeweils einem zu? Liegen sie an deren Grenzen? Freud folgert daher zum einen in Richtung der Annahme unbewusster Anteile des Ichs und zum anderen in Richtung der Formulierung des Über-Ichs als »zensurierender« Instanz. So formuliert er sein Struktur- oder Instanzen-Modell aus Ich, Über-Ich und Es (Freud, 1923b). Das Über-Ich wird dabei verstanden als Gewissensinstanz, die das Ich (bzw. hier eher: das Selbst; vgl. Storck, in Vorb. a) prüft und beurteilt. Es entscheidet darüber, wann jemand Schuldgefühle, aber auch Stolz erlebt. Dabei können Strafangst oder Gewissensangst als wichtiger Motor von Abwehrvorgängen beschrieben werden, dahingehend, dass die Abwehr zur Bewältigung eines Konflikts aus Wunsch und internalisiertem Verbot einsetzt. Das Erleben des Wunsches zieht Schuldgefühle nach sich bzw. ein ›schlechtes Gewissen‹. Bei Freud (1917a, S. 8) heißt es: »Irgendwo im Kern seines Ichs hat er [der Mensch; TS] sich ein Aufsichtsorgan geschaffen, welches seine eigenen Regungen und Handlungen überwacht, ob sie mit seinen Anforderungen zusammenstimmen.« An anderer Stelle formuliert er: »Wir waren […] gezwungen anzunehmen, daß sich im Ich selbst eine besondere Instanz differenziert hat, die wir das Über-Ich heißen […Es] kann sich dem Ich gegenüberstellen, es wie ein Objekt behandeln und behandelt es oft sehr hart. Es ist für das Ich ebenso wichtig, mit dem Über-Ich im Einvernehmen zu bleiben, wie mit dem Es« (Freud, 1926e, S. 253 f.). Das Über-Ich differenziert sich aus dem Ich, es ist eine »Stufe im Ich« und wird durch Internalisierungsprozesse gebildet, verwendet dabei allerdings Energie, die aus dem Es stammt (was z. B. bedeutet, dass die Strenge des Über-Ichs, trotz seiner Genese aus der Internalisierung elterlicher Gebote und Verbote, nicht deren Strenge wiedergibt, sondern die Triebstärke). Die Beziehung des Über-Ichs zum Ich umfasst Gebote – »So […] sollst du sein« – und Verbote – »So […] darfst du nicht sein« (Freud, 1923b, S. 262). Außerdem lässt sich, auch wenn Freud dies so nicht konsistent tut, zwischen dem Über-Ich (verbunden mit Gewissen, Schuld oder Strafe) und dem Ich-Ideal (Idealbilder, verbunden mit Scham) unterscheiden, wobei letzteres manchmal als ein Aspekt des erstgenannten gilt.
Im Rahmen dieses Modells erklärt sich die Abwehr nun dadurch, dass Es-Strebungen mit den Forderungen des Über-Ichs kollidieren (oder mit den Bedingungen der sozialen Realität), so dass das Ich gefordert ist, Abwehr zu mobilisieren, um bewusstseinsfähige Kompromissbildungen zu finden, d. h. eine Umarbeitung, die sowohl Es als auch Über-Ich hinreichend zufrieden stellt und/oder realitätsgerecht handeln zu können und so Scham, Angst, Schuld oder andere unlustvolle Affekte und Konsequenzen zu vermeiden.