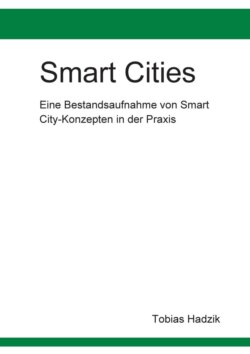Читать книгу Smart Cities - Tobias Hadzik - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.1.2 Problemlagen und Herausforderungen urbaner Zentren
ОглавлениеIm Jahr 2014 lebten 54 % der Weltbevölkerung in Städten. Bis zum Jahr 2050 soll dieser Anteil auf 66 % ansteigen.21 Von rd. 7,2 Mrd. Menschen in 201422 (in 2015 waren es rd. 7,3 Mrd. Menschen) wird die Weltbevölkerung auf rd. 9,7 Mrd. Menschen in 2050 anwachsen.23 Die Städte unserer Welt werden zu diesem Zeitpunkt rd. 6,4 Mrd. Menschen beherbergen. Bislang leben in urbanen Zentren rd. 3,9 Mrd. Menschen. Die zunehmende Urbanisierung stellt die Städte, aber auch Gesellschaften als Ganzes, vor große Herausforderungen. Die städtischen Systeme einschließlich der Daseinsvorsorge werden in hohem Maße belastet und ggf. überlastet. Wohnraummangel, eine Gefährdung der Wasser- und Energieversorgung, logistische Engpässe, eine steigende Umweltverschmutzung und weitere negative Effekte können die Folge sein. Städte müssen aber auch auf weitere gesellschaftliche Entwicklungen, wie den demographischen Wandel, reagieren.24
In der EU und in China hat die zunehmende Verstädterung u. a. zu Energie- und Wasserknappheit, Verkehrsstaus, Problemen mit der Müllentsorgung sowie Gefahren durch die Beanspruchung und Alterung der Infrastruktur geführt.25
In der dritten Welt vollzieht sich das Wachstum der Städte unkontrolliert. Verstärkt sind Menschen in diesen Städten konfrontiert mit Ausbeutung, Krankheit, Gewaltverbrechen, Arbeitslosigkeit, Unterbeschäftigung und extremer Armut. Gerade für diese Städte ist es eine Herausforderung, das weitere Wachstum von Elendsvierteln zu verhindern, sauberes Wasser bereitzustellen, Abwässer und Abfälle hygienisch zu entsorgen und die Luftqualität zu verbessern.26 Der Umgang mit Slums führt aber weltweit vor Augen, dass Staat und Stadtregierung in diesen Vierteln nur fiktiv und sehr punktuell die Kontrolle haben. Es sind eher sogenannte Slum Lords oder das organisierte Verbrechen. Die Lebenswirklichkeit des Großteils der Bevölkerung ist durch Selbstorganisation, Schutzlosigkeit, Gewalt, Willkür und Perspektivlosigkeit geprägt.27
Um die negativen Folgen der Urbanisierung zu reduzieren, benötigen Städte effizientere Infrastruktursysteme.28 Besonders in Afrika und Asien sind die Infrastruktur, die öffentlichen Dienstleistungen und die Absatzmärkte aufgrund des rapiden Bevölkerungswachstums häufig überfordert.29
In städtischen Regionen wurden im Jahr 2011 rund 75 % der erzeugten Energie verbraucht und etwa 80 % aller Treibhausgase emittiert.30 Europäische Städte mit mehr als 5.000 Einwohnern beherbergen circa 350 Mio. Menschen, also rd. drei Viertel der Europäer. Auf diese Siedlungen entfallen rd. 70 % des Energieverbrauches der EU.31 Die Energie wird gerade durch den Betrieb von Gebäuden und im Verkehr verbraucht. Auf diese städtischen Systeme lässt sich ein hoher Anteil der CO2-Emmissionen zurückführen.32
Die Freisetzung von Treibhausgasen, insbesondere Kohlendioxid (CO2), ist die Hauptursache für den Klimawandel. Der Weltklimarat, Intergovernmental Panel of Climate Change (IPCC), hat die weitere Erderwärmung in seinem fünften Sachstandsbericht nach unterschiedlichen Szenarien prognostiziert. Er geht lediglich für ein Szenario mit sehr ambitionierter Klimapolitik von einer Erwärmung um weniger als 2°C aus. Für das schlechteste Szenario mit fast ungebremsten Emissionen kann der Wert gegen Ende des Jahrhunderts 5,4°C übersteigen.33
In Deutschland haben auch andere Faktoren Einfluss auf die Anforderungen an urbanes Leben bzw. die hierfür erforderlichen Entwicklungen. Nach der Reaktorkatastrophe in Fukushima im Jahr 2011 hat die Bundesregierung beschlossen, den Atomausstieg bis zum Jahr 2022 zu vollziehen. Für die stärkere Nutzung von erneuerbaren Energien sollen vor allem die Stromnetze ausgebaut werden.34 Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2014) schreibt vor, insbesondere im Interesse des Klima- und Umweltschutzes eine nachhaltige Entwicklung der Energieversorgung zu ermöglichen. Dazu soll der Anteil des aus erneuerbaren Energien erzeugten Stroms am Bruttostromverbrauch in Deutschland auf 18 % im Jahr 2020, 40 % bis 45 % bis zum Jahr 2025, 55 % bis 60 % bis zum Jahr 2035 und 80 % im Jahr 2050 erhöht werden.35
Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen, sozialen und technologischen Veränderungen sowie der Globalisierung stehen Städte vor der Herausforderung, gleichzeitig ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und nachhaltige Stadtentwicklung zu betreiben. Dies wird einen massiven Einfluss auf alle Fragen zur urbanen Qualität, wie Wohnen, Wirtschaft, Kultur, Sozial‐ und Umweltbedingungen, haben.36 Konkrete Fragen sind beispielsweise, wie das urbane Verkehrs- und Transportwesen effizient gestaltet, die Energieversorgung organisiert oder der Zugang zu Bildung sichergestellt werden können. Dies sind nur einige Problematiken, mit denen sich eine Stadt auseinandersetzen muss.37