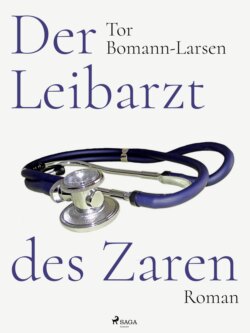Читать книгу Der Leibarzt des Zaren - Tor Bomann-Larsen - Страница 11
Ostersamstag, den 21. April
ОглавлениеDer Zar nahm vor dem Mittagessen ein Bad, die Zarin danach. Säuberung statt einer Beichte. Nach dem Tee wurden die Ikonen hereingetragen und auf den Schreibtisch gestellt. Um acht Uhr war endlich Messe. Meine Demütigungen trugen Früchte, Awdejew hatte allergnädigst einen Popen besorgt und aus der Stadt einen Diakon geholt, doch mussten wir ohne einen Chor auskommen. Alle Gefangenen, der ranghöchste Offizier und einzelne Gardesoldaten nahmen daran teil.
Ich konnte sehen, wie dem Zaren zwischen Bart und Kragen die Adern anschwollen, und auch die Zarin ließ unverkennbar Zeichen eines inneren Drucks erkennen. Nur die Großfürstin Maria ließ den Tränen freien Lauf; sie strömten über ihr ebenmäßiges Gesicht. Bisher hatten sie noch nie die Trennung vom Zarewitsch und den drei Großfürstinnen so stark empfunden wie während des kirchlichen Rituals, bei dem sie immer gemeinsam niederknien, bei dem sie füreinander beten. Auch ich vermisste schmerzlich die klaren Stimmen der Großfürstinnen.
Alexandra Fjodorowna hat meine Treue lange mit einem Anflug von Unglauben betrachtet. Das liegt an mehreren Dingen, ganz besonders aber an einem Umstand, an der Affäre mit der Wyrubowa, die sich an dem Tag ereignete, als Minister Kerenskij zum ersten Mal ins Alexander-Palais kam.
Die Masernepidemie neigte sich ihrem Ende zu, doch Maria und Anastasia Nikolajewna ging es immer noch sehr schlecht. Ich war selbst davon überzeugt, dass Großfürstin Maria wegen der hinzugetretenen Komplikationen die Krankheit nicht überstehen würde. Anna Wyrubowa war ebenfalls stark angegriffen gewesen, doch wie die drei anderen befand sie sich auf dem Weg der völligen Genesung.
Die Hofdame ist die engste Freundin der Zarin. Es ist ein fast symbiotisches Verhältnis, obwohl die Wyrubowa viel jünger ist. Das ihr am äußersten Rand des Schlossparks angewiesene Haus könnte man als Rasputins Botschaft in Zarskoje Selo bezeichnen. Anna Wyrubowa war das Bindeglied zwischen der Zarin, der im Niedergang begriffenen Autokratie und dem Retter aus Sibirien. Wer würde der halb hysterischen Frauengestalt, die nach einem Zugunglück auf Krücken umherwankte, normalerweise irgendeine politische Bedeutung zusprechen? So weit war es inzwischen gekommen, dass gerade diese leicht übergewichtige Figur ein wesentlicher Bestandteil des staatstragenden Systems geworden war.
Schon bei seinem ersten Besuch hatte sich Justizminister Kerenskij vorgenommen, sie festnehmen zu lassen. Sie berief sich vermutlich auf medizinische Immunität. Einer der Adjutanten in dem lautstarken Gefolge des Ministers legte mir die Frage vor, inwieweit die Hofdame in einer Verfassung sei, die es vertretbar mache, sie aus dem Palast zu entfernen. Ich beantwortete die Anfrage absolut klinisch als Arzt. Meiner Einschätzung nach habe sie wie drei der Zarenkinder die Krankheit überwunden und könne sich vom Krankenlager erheben. Folglich machte ich keine medizinischen Einwände geltend. Das löste bei Alexandra Fjodorowna einen flammenden Zornausbruch aus:
»Wie können Sie so etwas sagen, Sie, der Sie selbst Kinder haben!«
Erst im Nachhinein habe ich diesen Hinweis auf die Kinder verstanden. Dass sie die Wyrubowa als ihre Tochter betrachtete. Nicht einmal die Freundin war ihr ebenbürtig. Man brachte die unglückliche Frau direkt vom Alexanderpalais zur Peter-Pauls-Festung. Eine Art von Rekonvaleszenz, mit deren Anordnung ich selbstverständlich nie einverstanden gewesen wäre.
Bei dem gleichen Ministerbesuch und in Gegenwart der Zarin wurde ich gebeten, auch über den Gesundheitszustand Ihrer Majestät Bericht zu erstatten. Selbstverständlich war es äußerst beklemmend, gegenüber einem wildfremden Eindringling im Palast medizinische Einzelheiten über die Frau auszubreiten, die noch wenige Tage zuvor die Herrscherin des Reiches gewesen war. Es machte auch der Umstand nicht leichter, dass sich Kerenskij, obwohl er nicht nur Minister, sondern auch Rechtsanwalt war, aus Anlass der Audienz wie ein Fabrikarbeiter oder ein gemeiner Soldat gekleidet hatte; als er dann noch eine Positur à la Napoleon einnahm, gab mir das das dumpfe Gefühl, in einem historischen Tableau eine Nebenrolle zu spielen. Es kam mir vor, als hätte der Verfasser des Stücks aus schierer Unwissenheit den Sturz der Bourbonen mit dem Eintritt des Korsen in die Geschichte verwechselt. Ich gab nichtsdestoweniger eine möglichst objektive Beschreibung des nervösen Herzens ab, das in allen Jahren die körperliche Leistungsfähigkeit der Zarin verringert hatte, fügte aber hinzu, dass der gegenwärtige Zustand der Patientin so gut sei, wie man unter den besonders belastenden Umständen erwarten könne. Es war nicht schwer zu sehen, dass die nüchterne, undramatische Beschreibung der Leiden Ihrer Majestät ihr sehr hart zusetzte. Gleichwohl hatte ich meine Aussage auf die einzig akzeptable Art und Weise gemacht. Ein Arzt mag im Dienst des Zaren oder des Volkes stehen, doch die allerhöchste Loyalität schuldet er stets seinem Beruf.
Ohne Glaubwürdigkeit kann niemand heilen.
Wie die meisten Ärzte ziehe ich Patienten ohne medizinische Neigungen vor. Wenn Alexandra Fjodorowna sich in die graue Tracht mit dem roten Kreuz auf der Brust kleidet, geschieht es aus einer inneren Neigung heraus, aus Leidenschaft und nicht um der Genesung der Kranken willen. Selbst ihre Freunde hat Alexandra Fjodorowna mit dem Instinkt einer Krankenschwester ausgewählt. Am auffälligsten war dies bei der jungen Hofdame Prinzessin Orbeliani, die ihr ständiges Krankenzimmer im Palast eingerichtet bekam, nachdem sie von einem unheilbaren Rückenleiden befallen wurde. Aber auch auf Anna Wyrubowa wurde die Zarin erst dann aufmerksam, als diese als junges Mädchen schwer an Typhus erkrankt war. Die Zarin begann, sie in regelmäßigen Abständen zu besuchen. Die Patientin ihrerseits bewunderte die hochgewachsene schlanke Majestät, als wäre diese eine Florence Nightingale. Auch während ihrer misslungenen kurzen Ehe verblieb sie in der Rolle der Leidenden, bis hin zu dem Zugunglück, nach dem Rasputin ihr prophezeite, sie werde überleben, jedoch mit Krücken. Vielleicht war ich der Erste, der sie wie einen gesunden Menschen behandelte, als ich zuließ, dass Kerenskijs Männer sie vom Krankenbett in die Gefängniszelle brachten. Ich empfinde immer noch keine sonderliche Reue. Hierin liegt vielleicht meine Sünde, nicht in der Handhabung der Diagnose, sondern in dem Fehlen von Reue?
Nachdem ich Anna Wyrubowa geopfert hatte, hatte die Zarin wohl erwartet, dass ich mich schon recht bald aus dem sinkenden Zarenpalast retten würde. Seitdem habe ich zweimal meine Treue bekräftigt. Falls notwendig, werde ich es auch ein drittes Mal tun, aber niemals dadurch, dass ich meinen Arztberuf verrate.
Die Gefangenschaft wurde am 8. März 1917 eingeleitet, fünf Tage nach der Abdankung in Pskow. An jenem Morgen war die gesamte Belegschaft des Palasts im Audienzsaal des Schlosses zusammengetrommelt und vor die Wahl gestellt worden, zu bleiben oder den Palast zu verlassen, da die Tore zur Umwelt definitiv geschlossen werden würden. Für jeden Einzelnen war dies eine Wahl, entweder den Dienst beim Zaren, der nicht mehr Zar war, fortzusetzen oder hinauszugehen, um sich unter den Parolen der neuen Zeit einen Platz in der großen Umwälzung zu suchen. Die meisten gingen. Exakt um vier Uhr wurden die eisernen Tore geschlossen, und damit war die Zeitenwende endgültig, die Amputation ein Faktum.
Am Morgen danach rollte der kaiserliche Hofzug zum letzten Mal mit dem Zaren an Bord auf das Bahngleis in Zarskoje Selo. Nach den schicksalsschweren Ereignissen in Pskow war Seine Majestät nicht in die Hauptstadt weitergereist, sondern hatte sich zum Hauptquartier in Mogilew zurückbegeben, um sich vom Generalstab und der Armee zu verabschieden. Deutlicher als alles andere war dies Ausdruck dafür, dass der Entschluss des Zaren militärischer Natur war. In erster Linie hatte er nicht als Herrscher Russlands abgedankt, sondern als Oberbefehlshaber der russischen Armee.
Erst als der Zar den Bahnsteig in Zarskoje betrat, löste sich die Umgebung des Alleinherrschers auf. Auf dem Weg von den blauen Waggons des kaiserlichen Hofzugs bis zu dem wartenden Automobil des Palastkommandanten verlor Nikolaj Alexandrowitsch sein gesamtes Gefolge bis auf den Fürsten Dolgorukow. Ein einziger Mann bildete das Gefolge der einstigen Majestät, als man diese hinter dem Eisengitter einsperrte und mit ihrem reduzierten Hofstaat und ihrer versammelten Familie wiedervereinigte.
Die Epidemie war überwunden, und jetzt musste, soweit möglich, eine Desinfektion der kaiserlichen Gemächer vorgenommen werden. In diesem Zusammenhang mussten auch der Zarewitsch und die Töchter des Zaren geschoren werden. Die prachtvollen Haarmähnen der Großfürstinnen, die normalerweise dick und schwer Schultern und Rücken bedeckten, fielen der Schere zum Opfer. Nach der Typhusepidemie von 1913 hatten wir eine entsprechende Operation durchgeführt, aber da stand die Dynastie noch auf der Höhe ihrer Macht. Jetzt war der Effekt ein ganz anderer: Die Prinzessinnen sahen aus wie Strafgefangene. Sofort fertigte man einige praktische Perücken an, die den ganzen Sommer über die Köpfe der Töchter bedeckten und später durch Kopftücher ersetzt wurden, bis die Großfürstinnen in Tobolsk mit ihren ungewohnten, fast jungenhaften Frisuren auftreten konnten.
Ich habe, glaube ich, schon geschrieben, dass der Zar kraft seines Leibes über Russland herrschte. Nachdem er das allerhöchste Amt niedergelegt hatte, geschah das Merkwürdige, dass er sich umgehend in einen körperlich arbeitenden Menschen verwandelte, was ganz seiner Natur entsprach. Zunächst nahm er sich vor, Spatenstich für Spatenstich den Schnee von den vielen Wanderwegen im Schlosspark zu entfernen (innerhalb des Radius, in dem er sich unter strenger Bewachung bewegen durfte), worauf er sich über das meterdicke Eis auf dem Kanal um den Palast herum hermachte. Mit Eispickeln bewaffnet sorgte er dafür, dass der Kanal eisfrei wurde, damit die Ruder- und Paddelsaison möglichst schnell beginnen konnte. Als das Eis getaut und die Schneeschmelze vorbei war, ging er daran, die Erde zu bearbeiten, und brachte den anwesenden Hofstaat dazu, einen großen Acker umzugraben, um die Versorgung des Palasts mit Kartoffeln und Gemüse zu sichern. Und als die Pflanzen dann im Boden waren und der Sommer kam, konnte er sich endlich dem Holzfällen widmen.
Diesen Umständen zum Trotz glaube ich sagen zu können, dass diese ersten Monate nach der Abdankung vielleicht zu den glücklicheren Perioden im Leben des Nikolaj Alexandrowitsch gehörten. Er war zwar hinter dem Gitterzaun des Parks eingesperrt, aber gleichzeitig von dem gnadenlosen Druck des Reiches befreit, der auf ihm lastete. Von dem Druck der Minister, der Duma, des Generalstabs, der Großfürsten und der Dokumentenmassen auf seinem Schreibtisch. Jetzt war er auf die Ebene hinabgestiegen, auf der seine natürlichen Begabungen lagen. Er konnte sich den Freuden des Familienlebens widmen, einer einfachen, zielbewussten Muskelarbeit, Spatenstichen, dem Eishacken, Axthieben. Es war vielleicht demütigend, entehrend und ungerecht, aber dennoch eine Wohltat.
Ein entthronter Herrscher konnte seine kaiserliche Residenz nicht mehr bewohnen. Sollte er nach Norden evakuiert werden, nach Murmansk, um von dort nach Westen ins Exil nach England weiterzureisen; sollte man ihn nach Süden schicken auf die Krim, wo schon eine Reihe von Angehörigen der Romanows in ihren Sommerpalästen Zuflucht gesucht hatten; oder nach Osten in das ferne Sibirien, in einen der vielen vergessenen Orte, in die die Zaren selbst so viele ihrer politischen Gegner verbannt hatten?
Ich brachte die Frage bei Kerenskij schon Ende April zur Sprache und legte ihm meine medizinischen Argumente für das günstige Klima auf der Krim dar. Der Justizminister wies den Gedanken nicht zurück, ließ mich aber wissen, dass er nicht imstande sei, eine Deportation nach Süden durchzuführen. Was aus den ersten und in vielerlei Hinsicht naheliegendsten Plänen einer Evakuierung zur Familie der Majestäten in England wurde, habe ich nie in Erfahrung bringen können. Vermutlich konnte es sich weder das parlamentarisch regierte Großbritannien noch die Republik Frankreich leisten, die russischen Verbündeten aus den Tagen der Alleinherrschaft aufzunehmen, denn weder der britische noch der französische Soldat hatte doch sein Blut im Schützengraben für die Wiederkehr der Autokratie geopfert?
Die Ungewissheit schwebte über dem Alexanderpalast, bis der Herbst näher rückte und das Gemüse auf den umgegrabenen Rasenflächen herangereift war. Das Einzige, woran wir uns halten konnten, als wir Zarskoje endlich verlassen sollten, war der Bescheid, wir sollten »reichlich warme Kleidung einpacken«.
Am letzten Tag des Juli kam Großfürst Michail kurz vor Mitternacht in den Palast. Er wurde im Adjutantenzimmer des Zaren von dem Rechtsanwalt »Napoleon« empfangen, der nach einem misslungenen Bolschewikenaufstand einige Wochen zuvor vom Justizminister zum Ministerpräsidenten befördert worden war; er trug immer noch seine schmucklose Soldatenkleidung und versuchte, Russland vom Büro des Zaren im Winterpalais aus zu regieren. Die beiden kaiserlichen Brüder sollten sich zum ersten Mal seit jenem Tag im Februar wiedersehen, an dem Großfürst Michail seinen Bruder vergeblich angefleht hatte, eine verantwortungsbewusste Regierung zu ernennen. Der Ministerpräsident wohnte der Begegnung in der Rolle bei, für die er gekleidet war, als Gefangenenwärter.
Der Palast befand sich im Aufbruch, und ich persönlich war mit eigenen Angelegenheiten beschäftigt, doch man erzählte mir, dass zwischen den beiden Brüdern nicht viele Worte gewechselt worden seien. Wie es hieß, sei das auf die indiskrete Anwesenheit Kerenskijs zurückzuführen. Das glaube ich nicht. Welche Formulierungen hätten ihnen zu Gebote stehen sollen, wenn der Ministerpräsident den Anstand besessen hätte, draußen zu warten? Keiner der beiden war ein Mann des Wortes, Großfürst Michail noch weniger als Seine Majestät. Zwei gutherzige, ein wenig schüchterne Gardeoffiziere, was konnten sie sagen, als sie nur noch ein verlorenes Imperium gemein hatten?
Sie umarmten einander, und zumindest der Großfürst weinte; außerdem soll sich auch Alexej Nikolajewitsch im Adjutantenzimmer gemeldet und darum gebeten haben, seinen Onkel sprechen zu dürfen. Leider wurde das Ersuchen abgelehnt. So nahe war Russland einem letzten Drei-Zaren-Treffen.
Die eigentliche Abreise aus Zarskoje Selo verlief nicht einfacher als an dem Tag, an dem wir von Tobolsk aufbrachen. Die Bahnhofsbediensteten hatten sich geweigert, für die Ausreise der Zarenfamilie die Strecke freizugeben, und so mussten wir die ganze letzte Nacht im Kuppelsaal des Alexanderpalasts auf Kisten und Koffern sitzen, bevor die neue Staatsmacht endlich ihren Willen durchsetzte und die Bahnstrecke freigegeben wurde. Da war es am Morgen des 1. August 1917 schon sechs Uhr geworden.
Zwei Tage zuvor hatten wir den dreizehnten Geburtstag des Zarewitsch gefeiert. Es war das letzte Mal, dass das große Kleinod der Familie Romanow, die Snamenskij-Ikone der Heiligen Jungfrau mit dem Kind im Bauch, zur Genesung von Alexej Nikolajewitsch und zu seinem Segen in den Palast gebracht wurde.
Bis zum Tag vor der Abreise war der Zar damit beschäftigt gewesen, draußen im Schlosspark einige gewaltige Kiefern zu fällen und zu zerhacken, während die Zarin und die Dienerschaft so viel von den Wertsachen des Palasts einpackten, wie überhaupt möglich war. Es war ein großes Gefolge mit gewaltigem Gepäck, das im Licht des Sonnenaufgangs durch die Tore geleitet wurde, um unter Aufsicht von Kerenskijs blutunterlaufenen Augen in die Waggons verfrachtet zu werden, die uns nach Sibirien bringen sollten. Der plombierte Rote-Kreuz-Zug führte die japanische Flagge. Eine vielsagende Tarnung, denn die Niederlage gegen Japan war der Anfang vom Ende gewesen.
Mögen auch Millionen tapferer Soldaten mit Bleikugeln in der Brust gefallen sein, trage ich noch immer die Auszeichnungen, die ich während des Krieges gegen die gelbe Gefahr als Sanitätsarzt empfing. Die Medaillen sind ein Teil der alten Ordnung so wie die Daten in dem abgelegten Kalender. Ich bringe es nicht über mich, sie abzunehmen, denn der Zar würde sofort nach ihnen fragen. Welche Antwort sollte ich geben?
Der Verlust des Krim-Paradieses Liwadia lastete schwer auf uns. Seine Majestät versuchte, sich darüber zu freuen, dass die Großfürstinnen und der Zarewitsch die nordöstlichsten Teile des Reichs ihrer Vorväter kennenlernen würden. Umso größer war die Enttäuschung, als die Vorhänge jedes Mal zugezogen wurden, wenn der schwerbewaffnete Rote-Kreuz-Zug sich etwas näherte, was an Bebauung erinnern konnte. Es fiel dem Zaren schwer, einzusehen, dass es nicht immer die Aussicht war, die verschlossen werden sollte – unsere Wärter wünschten auch, jeden Einblick unmöglich zu machen. Obwohl er sein ganzes Leben mit Morddrohungen gelebt hatte, fiel es Nikolaj Alexandrowitsch schwer, zu begreifen, dass seine Umgebung eine Gefahr darstellen konnte. Er glaubte, die Abdankung hätte ihn gerettet, dass er mit dem Verzicht auf die Macht seine Bedeutung als Bombenziel verloren hätte, seinen Sinn als Zielscheibe.
Nach viertägiger Bahnfahrt kamen wir nach Tjumen auf der anderen Seite des Ural, von wo aus uns der regelmäßig verkehrende Dampfer Russ in gut vierundzwanzig Stunden zur Gouvernementshauptstadt Tobolsk brachte, einer Stadt aus Holzhäusern mit weiß verputzten Kirchen jenseits des Eisenbahnnetzes.
Auf halbem Weg zwischen Tjumen und Tobolsk versammelte sich die Zarenfamilie in der Nachmittagssonne auf dem Deck des Flussdampfers. Am linken Ufer lag das Dorf Pokrowskoje, Rasputins Heimatort. Bei diesem Anblick erfüllte sich eine Prophezeiung. Wie zufällig ließ die Zarin eine Bemerkung fallen. Ihre Wege kreuzten sich.
Schon bald läuten die Kirchenglocken. Ich bin endlich müde.