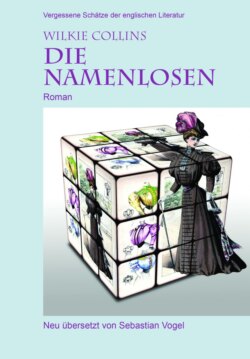Читать книгу Die Namenlosen - Уилки Коллинз, Elizabeth Cleghorn - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеKapitel 11
Sie Sonne sank tiefer; kühl und frisch wehte die westliche Brise ins Haus. Während der Abend hereinbrach, kam das fröhliche Läuten der Dorfkirchenglocke immer näher. Feld und Blumengarten spürten den Einfluss der Tageszeit und verströmten ihren süßesten Duft. Die Vögel in Norahs Vogelgehege sonnten sich in der abendlichen Stille und sangen ihr dankbares Lebewohl an den sterbenden Tag.
Die erbarmungslose Routine des Hauses war in ihrem Fortschreiten nur vorübergehend ins Stocken geraten und ging auf entsetzliche Weise ihren täglichen Gang. Die von Panik befallenen Dienstboten suchten blinde Zuflucht in den Pflichten, die der Stunde angemessen waren. Der Diener deckte leise den Tisch für das Abendessen. Die Zofe saß da, in sinnlosem Zweifel wartend, neben sich die Kannen mit heißem Wasser für die Schlafzimmer in ihrer gewöhnlichen Ordnung aufgereiht. Der Gärtner, der die Anweisung erhalten hatte, mit den Rechnungen für das über seine Pflichten hinaus ausgegebene Geld zu seinem Herrn zu kommen, sagte, sein Charakter sei ihm lieb und teuer, und ließ die Papiere zur vorbezeichneten Zeit zurück. Die Gewohnheit, die niemals nachgibt, und der Tod, der niemanden verschont, trafen auf den Trümmern menschlichen Glücks zusammen – und der Tod musste zurückstehen.
Schwer hatten sich die Gewitterwolken der Heimsuchung über dem Haus zusammengezogen – schwer, aber noch nicht ganz dunkel. Um fünf Uhr an diesem Abend hatte das Entsetzen des Verhängnisses seinen Schlag geführt. Noch bevor eine weitere Stunde verstrichen war, folgte auf die Mitteilung über den Tod des Ehemannes die Ungewissheit über die tödliche Gefahr für die Ehefrau. Hilflos lag sie auf ihrem verwitweten Bett; ihr Leben und das ihres ungeborenen Kindes standen auf des Messers Schneide.
Nur ein Kopf blieb noch im Besitz seiner Kräfte – ein lenkender Geist bewegte sich hilfreich in dem Trauerhaus.
Wären Miss Garth’ jüngere Jahre so ruhig und glücklich verlaufen wie ihr späteres Leben in Combe-Raven, sie wäre vielleicht unter den grausamen Notwendigkeiten dieses Tages zusammengebrochen. Aber die Gouvernante war in ihrer Jugend durch familiäres Elend auf eine harte Probe gestellt worden; jetzt erfüllte sie ihre entsetzlichen Pflichten mit dem standhaften Mut einer Frau, die zu leiden gelernt hatte. Allein hatte sie die Prüfung auf sich genommen, den Töchtern zu sagen, dass sie nun vaterlos waren. Allein bemühte sie sich darum, ihnen Kraft zu geben, da sich nun die grausige Gewissheit des Verlustes in ihren Geist einprägte.
Die geringsten Befürchtungen hatte sie wegen der älteren Schwester. Die Qual von Norahs Trauer hatte sich nach außen durch die natürliche Erleichterung der Tränen Bahn gebrochen. Nicht so bei Magdalen. Tränenlos und sprachlos saß sie in dem Zimmer, in dem die Eröffnung über den Tod ihres Vaters zuerst zu ihr gedrungen war; ihr Gesicht, unnatürlich versteinert wie durch den fruchtlosen Kummer des hohen Alters – eine weiße, unveränderliche Leere – war furchtbar anzusehen. Nichts munterte sie auf, nichts erweichte sie. Sie sagte nur: „Sprecht mich nicht an; fasst mich nicht an. Lasst es mich allein ertragen“ – und verfiel wieder in Schweigen. Die erste große Trauer, die das Leben der Schwestern verdüstert hatte, veränderte, so schien es, schon jetzt ihren alltäglichen Charakter.
Die Dämmerung brach herein und schwand dahin; hell kam die Sommernacht. Als das erste sorgsam bedeckte Licht im Krankenzimmer entzündet wurde, traf der Arzt ein, den man aus Bristol geholt hatte, und beriet sich mit dem medizinischen Betreuer der Familie. Er konnte keinen Trost spenden und sagte nur: „Wir müssen alles versuchen und hoffen. Der Schreck, der sie getroffen hat, als sie die Nachricht vom Tod ihres Mannes mithörte, hat ihre Kraft zu einer Zeit geschwächt, da sie ihrer am meisten bedarf. Nichts, was sie retten könnte, soll unversucht gelassen werden. Ich bleibe heute Nacht hier.“
Während er sprach, öffnete er eines der Fenster, um frische Luft hereinzulassen. Der Blick ging auf den Fahrweg vor dem Haus und die Straße dahinter. Kleine Menschengruppen standen vor der Pforte und blickten hinein. „Wenn diese Personen den geringsten Lärm machen, muss man sie wegschicken“, sagte der Arzt. Aber es war nicht nötig, sie wegzuschicken: Es waren nur die Arbeiter, die auf dem Anwesen des Toten gearbeitet hatten, hier und da auch einige Frauen und Kinder aus dem Dorf. Alle dachten an ihn, manche sprachen von ihm, und es beflügelte ihren trägen Geist, sein Haus anzusehen. Die meisten feinen Herren hier in der Gegend seien nett zu ihnen (sagten die Männer), aber keiner sei so gewesen wie er. Die Frauen flüsterten einander zu, wie großherzig er gewesen sei, wenn er in ihre Hütten kam. „Er war ein fröhlicher Mann, die arme Seele, und hat immer an uns gedacht. Nie ist er zur Essenszeit hereingekommen und hat uns angestarrt. Die anderen helfen uns und schimpfen mit uns – aber er hat immer nur gesagt: Beim nächsten Mal wird es besser!“ So standen sie und sprachen von ihm und sahen sein Haus und seine Ländereien an und gingen behäbig zu Zweien und Dreien weg mit dem vagen Gefühl, dass der Anblick seines freundlichen Gesichts sie nie wieder trösten würde. Noch der stumpfsinnigste Kopf unter ihnen wusste an diesem Abend, dass die harten Wege der Armut jetzt, da er fort war, noch härter zu gehen sein würden.
Ein wenig später brachte man an die Schlafzimmertür die Nachricht, der alte Mr. Clare sei allein zum Haus gekommen und warte in der Diele, um zu hören, was der Arzt sagte. Miss Garth war nicht in der Lage, selbst hinunterzugehen; sie schickte eine Nachricht. Er sagte zu dem Diener: „Ich werde in zwei Stunden wiederkommen und noch einmal fragen.“ Dann ging er langsam hinaus.
Er war nicht nur in allen anderen Dingen nicht wie gewöhnliche Männer, sondern auch der plötzliche Tod seines alten Freundes hatte in ihm keine erkennbare Veränderung herbeigeführt. Das Gefühl, das aus dem Erkundigungsgang sprach und ihn zu dem Haus geführt hatte, war das einzige Anzeichen menschlichen Mitgefühls, das dem schroffen, unzugänglichen Mann entschlüpfte.
Als die zwei Stunden verstrichen waren, kam er wieder; dieses Mal empfing ihn Miss Garth.
Sie schüttelten sich schweigend die Hand. Sie wartete; sie sehnte sich danach, ihn von seinem alten Freund sprechen zu hören. Nein: Er erwähnte weder den Unfall, noch spielte er auf den entsetzlichen Todesfall an. Er fragte nur: „Geht es ihr besser oder schlechter?“; mehr sagte er nicht. Verbarg sich der Tribut an seine Trauer um den Ehemann streng unterdrückt hinter dem Ausdruck seiner Sorge um die Ehefrau? Die Natur des Mannes, die das strikte Gegenteil der Welt und ihrer Gebräuche war, mochte eine solche Deutung seines Betragens rechtfertigen. Er wiederholte seine Frage: „Geht es ihr besser oder schlechter?“
Miss Garth antwortete:
„Nicht besser; wenn überhaupt, ist es eine Veränderung zum Schlechteren.“
Sie sprach diese Worte am Fenster des Frühstückszimmers, das sich zum Garten hin öffnete. Nachdem Mr. Clare die Antwort auf seine Erkundigung gehört hatte, hielt er inne, trat nach draußen auf den Weg, drehte sich dann ganz plötzlich um und sprach noch einmal:
„Hat der Doktor sie aufgegeben?“, fragte er.
„Er hat uns nicht verheimlicht, dass sie in Gefahr ist. Wir können nur für sie beten.“
Der alte Mann legte die Hand auf Miss Garth’ Arm, während sie ihm antwortete, und sah ihr eindringlich ins Gesicht.
„Sie glauben an Gebete?“, fragte er.
Mis Garth trat betrübt von ihm zurück.
„Diese Frage hätten Sie mir ersparen können, mein Herr, in so einer Zeit.“
Er nahm keine Notiz von ihrer Antwort; seine Blicke waren immer noch fest auf ihr Gesicht gerichtet.
„Beten Sie!“, sage er. „Beten Sie, wie sie noch nie gebetet haben, dass Mrs. Vanstones Leben erhalten bleibt.“
Er ging. Seine Stimme und sein Betragen deuteten auf eine unaussprechliche Angst vor der Zukunft hin, die seine Worte nicht eingestanden hatten. Miss Garth folgte ihm bis in den Garten und rief nach ihm. Er hörte sie, drehte sich aber nicht um. Vielmehr beschleunigte er seine Schritte, als wolle er ihr aus dem Weg gehen. Sie sah ihn im warmen sommerlichen Mondlicht über den Rasen gehen. Sie sah seine weißen, dürren Hände, sah sie plötzlich vor dem schwarzen Hintergrund des Strauchwerks, wie er sie hob und über seinem Kopf rang. Sie fielen wieder herunter – die Bäume hüllten ihn in Dunkelheit – er war fort.
Miss Garth ging zurück zu der leidenden Frau. Auf ihrer Seele lastete eine Befürchtung mehr.
Es war jetzt nach elf Uhr. Seit sie die Schwestern gesehen und mit ihnen gesprochen hatte, war ein wenig Zeit vergangen. Die Erkundigungen, die sie an eine Dienerin richtete, förderten nur die Information zutage, dass beide in ihren Zimmern seien. Sie schob ihre Rückkehr an das Krankenbett der Mutter hinaus, um tröstende Worte zu den Töchtern zu sprechen, bevor sie sich für die Nacht von ihnen verabschiedete. Norahs Zimmer lag am nächsten. Leise öffnete sie die Tür und sah hinein. Die kniende Gestalt am Bett war für sie ein Zeichen, dass die vaterlose Tochter in ihrer Trübsal Gottes Hilfe gefunden hatte. Als sie das sah, füllten sich ihre Augen mit dankbaren Tränen. Sanft schloss sie die Tür und ging weiter zu Magdalens Zimmer. Dort hielt der Zweifel ihren Fuß an der Schwelle fest; bevor sie hineinging, wartete sie einen Augenblick.
Aus dem Zimmer drang ein Geräusch an ihr Ohr – das eintönige Rascheln eines Frauenkleides, jetzt fern, jetzt nah, unaufhörlich wandernd von einem Ende des Fußbodens zum anderen. Das Geräusch teilte ihr mit, dass Magdalen in der Abgeschiedenheit ihres Zimmers hin und her ging. Miss Garth klopfte. Das Rascheln hörte auf; die Tür wurde geöffnet, und das traurige junge Gesicht sah sie an, festgefroren in kalter Verzweiflung; die großen, hellen Augen blickten mechanisch in die ihren, so leer und tränenlos wie zuvor.
Der Anblick traf die treue Frau, die das Mädchen von Kindheit an erzogen und geliebt hatte, mitten ins Herz. Sie nahm Magdalen zärtlich in die Arme.
„Ach, mein Liebes“, sagte sie, „immer noch keine Tränen! Könnte ich dich doch sehen, wie ich Norah gesehen habe! Sprich mit mir, Magdalen – versuche, ob du mit mir sprechen kannst.“
Sie versuchte es und sprach:
„Norah“, sagte sie, „hat keine Gewissensbisse. Er hat nicht Norahs Interessen gedient, als er in den Tod ging: Er hat meinen gedient.“
Mit dieser entsetzlichen Antwort drückte sie ihre kalten Lippen auf Miss Garth’ Wange.
„Lassen Sie es mich allein tragen“, sagte sie und schloss sanft die Tür.
Wieder wartete Miss Garth auf der Schwelle, und wieder ging das raschelnde Geräusch des Kleides hin und her – einmal nahe, einmal fern, hin und her mit einer grausamen, mechanischen Regelmäßigkeit, die noch die wärmste Sympathie frösteln ließ und noch die kühnste Hoffnung einschüchterte.
Die Nacht ging vorüber. Wenn am Morgen noch keine Besserung eintrat, darauf hatte man sich geeinigt, sollte am nächsten Tag der Londoner Arzt gerufen werden, den Mrs. Vanstone vor einigen Monaten konsultiert hatte. Es war keine Veränderung zum Besseren zu erkennen, und man schickte nach dem Arzt.
Als der Vormittag voranschritt, kam Frank vom Cottage und holte Erkundigungen ein. Hatte Mr. Clare seinen Sohn mit der Pflicht betraut, die er tags zuvor selbst erfüllt hatte, weil er nicht willens war, nach dem, was er zu Miss Garth gesagt hatte, noch einmal mit ihr zusammenzutreffen? Es mochte so sein. Frank konnte kein Licht in die Frage bringen. Er sah blass und bestürzt aus. Seine ersten Fragen nach Magdalen zeigten, wie sehr seine schwache Natur durch die Katastrophe erschüttert worden war. Er war nicht fähig, seine eigenen Fragen zu formulieren. Die Worte erstarben ihm auf den Lippen, und die Tränen traten ihm aus freien Stücken in die Augen. Zum ersten Mal wurde Miss Garth seinetwegen warm ums Herz. Kummer trägt etwas Edles in sich – er nimmt jedes Mitgefühl an, ganz gleich, woher es kommt. Sie munterte den jungen Mann mit einigen freundlichen Worten auf und nahm zum Abschied seine Hand.
Noch vor dem Mittag kam Frank mit einer zweiten Nachricht zurück. Sein Vater wünschte zu wissen, ob Mr. Pendril nicht an diesem Tag in Combe-Raven erwartet wurde. Wenn man mit der Ankunft des Anwalts rechnete, habe Frank die Anweisung, am Bahnhof bereitzustehen und ihn zum Cottage zu bringen, wo ein Bett zu seiner Verfügung stehen werde. Die Nachricht war für Miss Garth eine Überraschung. Sie zeigte, dass Mr. Clare mit den Absichten vertraut war, deretwegen sein verstorbener Freund nach Mr. Pendril geschickt hatte. War das umsichtige Angebot der Gastfreundschaft von Seiten des alten Mannes ein weiterer indirekter Ausdruck des menschlichen Kummers, den er auf so unnatürliche Weise verheimlichte? Oder war er sich einer geheimen Notwendigkeit für Mr. Pendrils Gegenwart bewusst, über die man die hinterbliebene Familie in vollkommener Unkenntnis gelassen hatte? Miss Garth war zu betrübt und hoffnungslos, als dass sie sich bei einer dieser Fragen hätte aufhalten können. Sie sagte zu Frank, Mr. Pendril werde um drei Uhr erwartet, und schickte ihn mit dankenden Worten wieder weg.
Kurz nachdem er gegangen war, wurden die Ängste um Magdalen, die ihr Geist jetzt zu empfinden in der Lage war, durch eine Nachricht gelindert, die besser war als ihr Erlebnis in der letzten Nacht sie zu hoffen geneigt gemacht hatte. Norahs Einfluss hatte ihre Schwester aufgerichtet, und Norahs geduldiges Mitgefühl hatte den eingeschlossenen Kummer befreit. Magdalen hatte in der Anstrengung, die sie erleichtert hatte, schwer gelitten – zwangsläufig gelitten angesichts einer Natur wie der ihren. Die heilenden Tränen waren nicht sanft gekommen; sie waren mit quälender, leidenschaftlicher Heftigkeit hervorgebrochen – aber Norah war nicht von ihrer Seite gewichen, bis der Kampf vorüber war und die Ruhe eingesetzt hatte. Diese besseren Neuigkeiten hatten Miss Garth ermutigt, sich in ihr Zimmer zurückzuziehen und die Ruhe zu suchen, die sie so dringend brauchte. Ermattet an Körper und Seele, schlief sie aus schierer Erschöpfung – schlief schwer und traumlos mehrere Stunden. Zwischen drei und vier Uhr am Nachmittag wurde sie von einer Dienerin geweckt. Die Frau hatte einen Umschlag in der Hand – einen Umschlag, hinterlassen von Mr. Clare dem Jüngeren mit einer Nachricht, die verlangte, man solle das Schreiben unverzüglich Miss Garth aushändigen. Der Name, der an der unteren Ecke des Kuverts geschrieben stand, lautete „William Pendril“. Der Anwalt war eingetroffen.
Miss Garth öffnete das Kuvert. Nach einigen einleitenden Sätzen des Mitgefühls und Beileids teilte der Verfasser mit, er sei bei Mr. Clare angekommen; anschließend äußerte er, offensichtlich in seiner beruflichen Funktion, eine höchst verblüffende Bitte.
„Wenn“, so schrieb er, „im Befinden von Mrs. Vanstone irgendeine Veränderung zum Besseren eintreten sollte – ob es sich um eine Besserung für eine gewisse Zeit handelt oder um die dauerhafte Genesung, auf die wir alle hoffen –, ersuche ich Sie dringend, mich sofort darüber in Kenntnis zu setzen. Es ist von höchster Wichtigkeit, dass ich mit ihr spreche, sofern sie genügend Kraft aufbringt, um mir für fünf Minuten ihre Aufmerksamkeit zu schenken, und sofern sie in der Lage ist, nach Ablauf dieser Zeit mit ihrem Namen zu unterschreiben. Darf ich Sie bitten, mein Anliegen in strengster Vertraulichkeit an die verantwortlichen Mediziner weiterzuleiten? Diese werden verstehen, und auch Sie werden verstehen, welche entscheidende Bedeutung ich diesem Gespräch beimesse, wenn ich Ihnen sage, dass ich es eingerichtet habe, alle anderen geschäftlichen Ansprüche, die an mich gestellt wurden, ihm unterzuordnen; und dass ich mich in Bereitschaft halte, um Ihrer Aufforderung zu jeder Stunde bei Tag oder bei Nacht nachzukommen.“
Mit diesen Worten endete der Brief. Miss Garth las ihn zweimal. Beim zweiten Lesen gingen die Bitte, die der Anwalt hier an sie richtete, und die Abschiedsworte, die Mr. Clare am Tag zuvor über die Lippen gekommen waren, in ihrem Geist eine unbestimmte Verbindung ein. Neben dem ersten und vordringlichen Anliegen der Genesung von Mrs. Vanstone gab es ein zweites, ein ungewisses Interesse, das Mr. Pendril und Mr. Clare bekannt war. Wen betraf es? Die Kinder? Waren sie durch eine neue Widrigkeit bedroht, die durch die Unterschrift ihrer Mutter abgewendet werden konnte? Was bedeutete das? Bedeutete es, dass Mr. Vanstone gestorben war, ohne ein Testament zu hinterlassen?
In ihrer Betrübnis und Verwirrung war Miss Garth nicht in der Lage, so für sich selbst zu überlegen, wie sie in glücklicheren Zeiten überlegt hätte. Hastig eilte sie in den Vorraum von Mrs. Vanstones Zimmer; und nachdem sie Mr. Pendrils Stellung zur Familie erläutert hatte, drückte sie seinen Brief den Medizinern in die Hand. Beide antworteten ohne Zögern in dem gleichen Sinn. Mrs. Vanstones Zustand machte ein Gespräch, wie der Anwalt es wünschte, zu einem Ding der völligen Unmöglichkeit. Wenn sie sich von ihrer derzeitigen Erschöpfung erholte, werde man Miss Garth sofort über die Besserung in Kenntnis setzen. Vorerst jedoch lasse sich die Antwort an Mr. Pendril in einem Wort zusammenfassen: unmöglich.
„Ihnen ist klar, welche Wichtigkeit Mr. Pendril dem Gespräch beimisst?“, sagte Miss Garth.
Ja: Beiden Ärzten war es klar.
„Mein Geist ist verirrt und verwirrt in dieser entsetzlichen Ungewissheit, meine Herren. Kann einer von Ihnen erraten, warum die Unterschrift gewünscht wird? Oder was der Gegenstand des Gesprächs sein könnte? Ich habe Mr. Pendril nur dann gesehen, wenn er früher hier zu Besuch war: Ich habe keinen Anspruch, der es rechtfertigen würde, dass ich ihn befrage. Würden Sie sich den Brief noch einmal ansehen? Glauben Sie, er bedeutet, dass Mr. Vanstone nie ein Testament gemacht hat?“
„Ich glaube kaum, dass er das bedeuten kann“, sagte einer der Ärzte. „Aber selbst wenn wir annehmen, dass Mr. Vanstone ohne letzten Willen verstorben ist, trägt das Gesetz hinreichend Sorge für die Interessen seiner Witwe und seiner Kinder…“
„Tut es das auch“, warf der andere Mediziner ein, „wenn das Eigentum in Ländereien besteht?“
„In diesem Fall bin ich nicht sicher. Wissen Sie zufällig, Miss Garth, ob Mr. Vanstones Vermögen aus Geld oder aus Land besteht?“
„Aus Geld“, erwiderte Miss Garth. „Das habe ich ihn bei mehr als einer Gelegenheit sagen hören.“
„Dann kann ich Ihre Seele erleichtern, indem ich aus eigener Erfahrung spreche. Wenn er ohne Testament stirbt, spricht das Gesetz ein Drittel seines Vermögens seiner Witwe zu, und der Rest wird gleichmäßig unter seinen Kindern geteilt.“
„Aber wenn Mrs. Vanstone…“
„Wenn Mrs. Vanstone sterben sollte“, fuhr der Arzt fort, womit er die Frage vollendete, die zum Abschluss zu bringen Miss Garth selbst nicht das Herz gehabt hatte, „glaube ich, dass ich recht habe, wenn ich Ihnen sage, dass das Vermögen im Zuge der gesetzlichen Erbfolge an die Kinder gehen würde. Welche Notwendigkeit auch für das Gespräch bestehen mag, das Mr. Pendril wünscht, ich sehe keinen Anlass, es mit der Frage nach dem mutmaßlichen Fehlen von Mr. Vanstones Testament in Verbindung zu bringen. Aber um der Zufriedenheit Ihrer eigenen Seele willen richten Sie die Frage unter allen Umständen an Mr. Pendril selbst!“
Miss Garth zog sich zurück, um so zu verfahren, wie der Arzt es ihr geraten hatte. Nachdem sie Mr. Pendril die medizinische Entscheidung übermittelt hatte, die ihm vorerst das gewünschte Gespräch versagte, fügte sie eine kurze Erklärung über die juristische Frage an, die sie den Ärzten vorgelegt hatte; dabei wies sie taktvoll auf ihr natürliches Bestreben hin, über die Motive in Kenntnis gesetzt zu werden, die den Anwalt zu seiner Anfrage veranlasst hatten. Die Antwort, die sie erhielt, war reserviert bis zum Äußersten und hinterließ bei ihr keine günstige Meinung über Mr. Pendril. Er bestätigte die Interpretation der Gesetze durch die Ärzte nur in sehr allgemeinen Begriffen und brachte seine Absicht zum Ausdruck, im Cottage zu warten in der Hoffnung, dass eine Wendung zum Besseren Mrs. Vanstone doch noch in die Lage versetzen werde, ihn zu empfangen; er schloss seinen Brief ohne die leiseste Andeutung über seine Motive und über die Existenz oder Nichtexistenz von Mr. Vanstones Testament.
Die betonte Vorsicht in der Antwort des Anwalts rumorte unbehaglich in Miss Garth’ Kopf, bis das lange erwartete Ereignis des Tages ihre sämtlichen Gedanken wieder auf die alles bestimmende Angst um Mrs. Vanstone lenkte.
Am frühen Abend traf der Arzt aus London ein. Er stand lange am Bett der leidenden Frau und beobachtete sie; noch länger blieb er in der Beratung mit seinen medizinischen Standesgenossen; wieder ging er in das Krankenzimmer, bevor Miss Garth zu ihm vordringen konnte, damit er ihr mitteilte, zu welcher Einschätzung er gelangt war.
Als er zum zweiten Mal in den Vorraum kam, nahm er schweigend auf einem Stuhl an ihrer Seite Platz. Sie sah ihm ins Gesicht, und die letzte schwache Hoffnung erstarb in ihr, bevor seine Lippen sich öffneten.
„Ich muss die harte Wahrheit aussprechen“, sagte er sanft. „Alles, was getan werden kann, ist getan worden. Die nächsten höchstens vierundzwanzig Stunden werden der Ungewissheit ein Ende machen. Wenn die Natur in dieser Zeit keine Anstrengung unternimmt – es bekümmert mich, das zu sagen – müssen Sie auf das Schlimmste vorbereitet sein.“
Diese Worte sagten alles: Sie prophezeiten das Ende.
Die Nacht verging; und sie durchlebte sie. Der nächste Tag kam; und sie bestand fort, bis die Uhr fünf zeigte. Zu dieser Stunde hatte die Nachricht vom Tod ihres Mannes ihr den tödlichen Schlag versetzt. Als die Stunde wiederum gekommen war, ließ die Gnade Gottes sie zu ihm in eine bessere Welt gehen. Ihre Töchter knieten an ihrem Bett, als ihre Seele entschwand. Sie verließ beide, ohne von ihrer Gegenwart zu wissen, barmherzig und glücklich unempfindlich gegen den Schmerz des letzten Lebewohl.
Ihr Kind überlebte, bis der Abend hereinbrach und der Sonnenuntergang sich am stillen westlichen Firmament verdüsterte. Als die Dunkelheit kam, flackerte das Licht des zerbrechlichen kleinen Lebens – das von Anfang an schwach und matt gewesen war – und verlosch. Alles, was irdisch war an Mutter und Kind, lag in dieser Nacht in demselben Bett. Der Todesengel hatte sein grausiges Werk getan; und die beiden Schwestern blieben allein auf der Welt zurück.