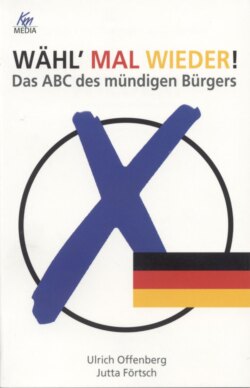Читать книгу Wähl' mal wieder! - Ulrich Offenberg - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Reformen in Deutschland
ОглавлениеDie vernichtende Niederlage Preußens gegen Napoleon und eine enorme Staatsverschuldung zwangen schließlich auch Deutschlands mächtigstes Reich zu den lange ersehnten Reformen. Die so genannte „Städteverordnung“ von 1808 gewährte den Kommunen erstmalig Selbstverwaltungsrechte. Das Bürgerrecht erhielt nun, unabhängig von seinem Stand, auf Antrag, wer über Grundbesitz, ein bestimmtes Einkommen oder einen Gewerbebetrieb verfügte.
Das war nun noch nicht die ideale, reine Form der Demokratie, aber immerhin ein Anfang. Der schlichte Landarbeiter, die Fabrik- und Bergarbeiter, die täglich ums Überleben kämpften, sowie die Besitzlosen blieben weiterhin ohne Einfluss in der Politik. Und die Frauen? Die sollten nur brav viele gesunde Kinder gebären und sich um die Versorgung ihrer Männer kümmern. Politik galt als reine Männersache. Dabei hatte gerade das mutige Handeln der preußischen Königin Luise bei Napoleon vor dem Tilsiter Frieden 1807 gezeigt, dass auch Frauen durchaus über politischen Instinkt verfügten und im Grunde die geborenen Diplomaten waren.
Wer geglaubt hatte, dass nach Napoleons Sturz die Demokratiein Europa zum Siegeszug ansetzen würde, sah sich gründlich getäuscht. Der so genannte Wiener Kongress zementierte die absolute Macht der Herrscherhäuser. Deutschland wurde kein Nationalstaat, wie viele hofften, sondern nur zum Deutschen Bund: ein loser Staatenbund souveräner Fürsten, die verbissen an ihren alten Privilegien festhielten. Die am 8. Juni 1815 paraphierte Bundesakte forderte zwar in Artikel 13, in allen Bundesstaaten eine Verfassung zu schaffen, aber besonders eilig hatten es die Landesherren damit nicht. In Preußen und in Österreich, den stärksten Mächten Mitteleuropas, wurde diese Forderung überhaupt nie verwirklicht. Letztlich lag es im Ermessen der Landesherren, welche politischen Mitwirkungsmöglichkeiten ihre Untertanen erhielten.
Die revolutionäre Bewegung in Deutschland, die Forderung nach demokratischer Mitbestimmung, wurde überwiegend von den Studenten getragen, die sich zu Burschenschaften zusammengeschlossen hatten. Das Bürgertum forderte zwar einerseits mehr Rechte für sich, andererseits war es aber nicht bereit, für diese Rechte auch zu kämpfen. Ein großer Teil zog sich nach den napoleonischen Kriegen und dem Wiener Kongress, der die Restauration Europas zur Folge hatte, resigniert in die Häuslichkeit zurück. Heim und Familie, Ruhe und Ordnung, das waren die Ideale, die sie anstrebten. Das Biedermeier für die Biedermänner.
Kommt uns das nicht irgendwie bekannt vor? Haben nicht auch heute viele den Wunsch, sich idyllische Nischen zu suchen, die Politik als schmutziges Geschäft abzutun? Am Stammtisch massiv Luft abzulassen anstatt auch mit eigener Stimme und eigenem Tun die Politik zu beeinflussen? – Damals jedenfalls duckten die Bürger vor der Obrigkeit, beschäftigten sich allenfalls heimlich mit liberal-demokratischen Gedanken.
Dennoch wehte um 1818 ein Hauch von Demokratie durch Deutschland. Vor allem die südlichen Staaten erhielten Verfassungen und folgten damit der Aufforderung des Deutschen Bundes. Zwar wurde die Souveränität der deutschen Fürsten nicht angetastet, der Adel dominierte nach wie vor. Aber immerhin: Der Keim der Demokratie war gelegt.