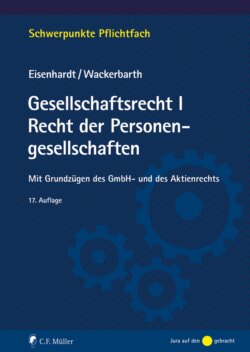Читать книгу Gesellschaftsrecht I. Recht der Personengesellschaften, eBook - Ulrich Wackerbarth - Страница 22
1. Personengesellschaften und Körperschaften
Оглавление21
Fast alle der oben genannten Vereinigungsarten lassen sich auf zwei Grundtypen zurückführen, die beide im BGB geregelt sind:
| - | die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (§§ 705 ff. BGB) |
| - | und den Verein (§§ 21 ff. BGB). |
Die auf dem Grundtyp der BGB-Gesellschaft beruhenden Gesellschaften sind Personengesellschaften; diejenigen Vereinigungen, die auf den Verein zurückzuführen sind, sind Körperschaften. Die Personengesellschaften sind: die BGB-Gesellschaft, die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft, die Partnerschaftsgesellschaft und die stille Gesellschaft. Der Zusammenschluss beruht auf dem persönlichen Vertrauen, das sich die einzelnen Gesellschafter entgegenbringen und dem Vertrag, den sie untereinander geschlossen haben. Deshalb ist der Fortbestand einer Personengesellschaft grundsätzlich von der unveränderten Zusammensetzung des Personenkreises abhängig, der sich zu der Gesellschaft zusammengeschlossen hat.
Das bedeutet u.a.:
| - | im Zweifel endet die Gesellschaft mit dem Tode eines Gesellschafters (§ 727 BGB); |
| - | grundsätzlich muss sich keiner der Gesellschafter gegen seinen Willen einen anderen Gesellschafter aufzwingen lassen. |
Beispiel:
Der Anteil an einer OHG, einer typischen Personengesellschaft, kann ohne die Zustimmung aller Gesellschafter nicht auf eine andere Person, die bisher nicht Gesellschafter war, übertragen werden. Dieser Grundsatz dient lediglich dem Schutz der Gesellschafter. Er kann deshalb durch eine davon abweichende Regelung im Gesellschaftsvertrag abgeändert werden.
22
Die gesetzlichen Regelungen über Personengesellschaften sind im BGB, im HGB und im Partnerschaftsgesellschaftsgesetz (PartGG) enthalten. Die Vorschriften über die BGB-Gesellschaft finden auch auf die OHG, die KG, die Partnerschaftsgesellschaft und die stille Gesellschaft Anwendung, soweit das HGB und das PartGG im Verhältnis zum BGB nicht Sonderregelungen enthalten (s. § 105 Abs. 3 und § 161 Abs. 2 HGB). Das heute angewandte Recht der Personengesellschaften ist zu wesentlichen Teilen das Resultat einer systematischen Neuordnung des Gesellschaftsrechts, die auf einer von Wissenschaft und Rechtsprechung dominierten Rechtsfortbildung beruht.[1] Das gilt insbesondere für das im BGB (§§ 705 ff.) geregelte Recht der BGB-Gesellschaft, in dem viele Bestimmungen Ausdruck überholter Vorstellungen sind.
Zur Rechtslage nach dem MoPeG:
Der Gesetzgeber hat nun mit dem Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts vom 10.8.2021[2] (i.F. MoPeG) auf diese Rechtsfortbildung reagiert und sie durch eine Reform des Personengesellschaftsrechts weitgehend in das geschriebene Recht übernommen. Das MoPeG hat u.a. einige systematische Folgen, die in Rn. 34 erläutert werden. Die Vorschriften des MoPeG treten erst am 1.1.2024 in Kraft, werden aber gleichwohl im Folgenden dargestellt, zum einen, da sie zum Verständnis des geltenden Rechts beitragen und zum anderen, um über die künftige Rechtslage zu informieren. Soweit Vorschriften aus dem MoPeG zitiert werden, wird das Gesetz als BGB-E bezeichnet. Die „Rechtslage nach dem MoPeG“ wird durch Einschübe in eckigen Klammern vom Rest des Textes abgesetzt (wie dieser Absatz). Vor den Darstellungen zur BGB-Gesellschaft und zur OHG finden Sie Synopsen, um die wesentlichen Vorschriften nach dem Inkrafttreten der Reform wiederfinden zu können.
23
Der Verein (§§ 21 ff. BGB) ist eine Körperschaft des Privatrechts. Körperschaften sind auf Dauer angelegte Zusammenschlüsse von Personen, die einen überindividuellen Zweck verfolgen und deren Bestand vom Wechsel der Mitglieder unabhängig ist. Diese Elemente betonen vor allem die Unabhängigkeit der Körperschaft von ihren Mitgliedern. Der Zweck eines Vereins (z.B. sportliche Freizeitgestaltung) soll die Einzelpersönlichkeiten der Mitglieder überdauern. Der Verein besteht auch weiter, wenn ein oder mehrere Mitglieder ausscheiden. Auch ein vollständiger Mitgliederwechsel ist grundsätzlich denkbar und möglich.
24
Der im Vereinsregister eingetragene Verein (e.V., § 21 BGB) ist zugleich der im BGB geregelte Prototyp der Juristischen Person, die das BGB in den §§ 21 ff. den zuvor in den §§ 1 ff. geregelten natürlichen Personen (Menschen) gegenüberstellt. Juristische Personen sind wie natürliche Personen rechtsfähig und können daher selbst am Rechtsverkehr teilnehmen (näher Rn. 27 ff.). Zu den Verbänden, die auf den eingetragenen Verein zurückzuführen und ebenfalls Körperschaften und juristische Personen sind, gehören u.a. die Aktiengesellschaft und die Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
25
Die juristische Person, wie z.B. eine GmbH oder eine Aktiengesellschaft, kann auch dann noch bestehen, wenn nur ein Mitglied vorhanden ist. Das bedeutet z.B., dass eine Aktiengesellschaft oder eine GmbH weiterbesteht, wenn sich die Anteile auf Grund des Ausscheidens der anderen Gesellschafter in einer Person vereinigen. Eine GmbH und eine AG können sogar als Ein-Personen-„Gesellschaft“ gegründet werden (vgl. dazu Rn. 846 ff.). Daran zeigt sich, dass das Gesellschaftsrecht (i.w.S.) nicht nur das Zusammenwirken mehrerer Gesellschafter, also das Recht der Gesellschaften (Gesellschaftsrecht i.e.S.) regelt, sondern darüber hinaus bestimmte Organisationsformen zur Verfügung stellt, derer sich auch Einzelpersonen bedienen können.
26
Wenn man das „Gesellschaftsrecht“ derart weit versteht, dann muss man das Recht der Stiftung (§§ 80 ff. BGB) in die Betrachtung miteinbeziehen, da die Stiftung ebenfalls eine Organisationsform für einen Rechtsträger ist, der am Wirtschaftsleben teilnimmt. Als rechtlich verselbständigtes Vermögen hat die Stiftung jedoch keine Mitglieder (sie ist also weder Gesellschaft noch Körperschaft), wohl aber ist sie juristische Person und damit selbständig Träger von Rechten und Pflichten.