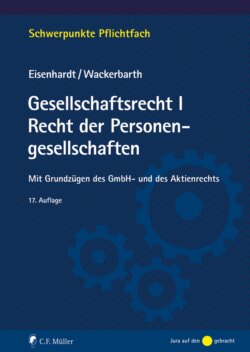Читать книгу Gesellschaftsrecht I. Recht der Personengesellschaften, eBook - Ulrich Wackerbarth - Страница 26
c) Theorien der Juristischen Person
Оглавление31
Die Betrachtungsweise, dass eine juristische Person durch ihre Organe handelt, geht auf Otto von Gierkes Theorie der realen Verbandspersönlichkeit zurück, mit der v. Gierke die soziale Realität der Verbände anerkennen und weitgehende Gleichbehandlung von natürlichen und juristischen Personen im allgemeinen Rechtsverkehr rechtfertigen wollte.[3] Dem steht die Fiktionstheorie entgegen, die maßgeblich von Friedrich Carl von Savigny vertreten wurde[4]. Ihr zufolge ist die Rechtsfigur der juristischen Person nur ein rechtlicher Kunstgriff, eine Fiktion, um gerade die Teilnahme von Organisationen am Rechtsleben zu erleichtern, indem ein Rechtssubjekt erschaffen wird, das als Zurechnungsendpunkt für Rechte und Pflichten dienen kann. Die juristische Person handelt danach gerade nicht selbst, sondern ihr wird nur das Handeln anderer zugerechnet.
Beide Theorien haben auf bestimmte Aspekte der juristischen Person hingewiesen, ohne dass damit notwendig konkrete Konsequenzen verbunden sind. V. Gierke hat insbesondere klargemacht, dass Verbände nicht bloß abstrakte Gebilde sind, sondern eine soziale Realität haben. Die Fiktionstheorie weist auf fortbestehende Unterschiede zu natürlichen Personen, d.h. Menschen hin. Eine absolute Gleichbehandlung von natürlichen und juristischen Personen kommt schon deshalb nicht in Betracht, weil man eine juristische Person nicht für eventuelle Straftaten ins Gefängnis sperren kann (um es zu veranschaulichen). Vor der weitgehenden „Anthropomorphisierung“ von Verbänden muss aber auch deshalb gewarnt werden, weil die juristische Person im Alltag gerne als Schutzschild verwendet wird, um das Handeln der hinter ihr stehenden natürlichen Personen zu verdecken.
32
Im Privatrecht werden natürliche und juristische Personen jedenfalls weitgehend gleichbehandelt. Grundsätzlich sind juristische Personen, wie z.B. eine Aktiengesellschaft, sogar Träger des Allgemeinen Persönlichkeitsrechts aus Artt. 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 GG. Allerdings ist diese Rechtsträgerschaft inhaltlich begrenzt. Die Begründung dafür ergibt sich aus dem Entstehungsgrund, nämlich der Ableitung des Persönlichkeitsschutzes aus Art. 1 und 2 GG zur Ausfüllung einer Lücke. Nach Ansicht des BGH[5] ist eine Ausdehnung der Schutzwirkung des Persönlichkeitsrechts über natürliche Personen hinaus auf juristische Personen nur insoweit gerechtfertigt, als sie aus ihrem Wesen als Zweckschöpfung des Rechts und ihren Funktionen dieses Rechtsschutzes bedürfen. Dies ist der Fall, wenn juristische Personen in ihrem „sozialen Geltungsanspruch als Arbeitgeber oder als Wirtschaftsunternehmen betroffen werden“[6]. Letztlich werden also stets die hinter der juristischen Person stehenden Handelnden und Interessen im Blick behalten.