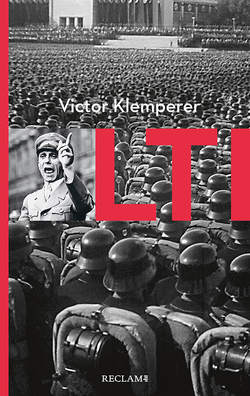Читать книгу LTI - Victor Klemperer - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
[53]VI Die drei ersten Wörter nazistisch
ОглавлениеDas allererste Wort, das sich mir als spezifisch nazistisch, nicht seiner Formung, aber seiner neuen Anwendung nach, aufdrängte, verbindet sich für mich mit der Bitterkeit des ersten durch das Dritte Reich verursachten Freundesverlustes.
Dreizehn Jahre zuvor waren wir und T. gleichzeitig nach Dresden und an die Technische Hochschule gekommen, ich als Professor, er als beginnender Student. Er war fast so etwas wie ein Wunderkind. Wunderkinder enttäuschen häufig, er aber schien über das gefährlichste Alter der Wunderkindschaft bereits unversehrt hinaus zu sein. Kleinstbürgerlicher Herkunft und sehr arm, war er während des Krieges romanartig entdeckt worden. Ein berühmter auswärtiger Professor wollte sich im Prüffeld einer Leipziger Fabrik eine neue Maschine vorführen lassen; durch Einziehungen zum Heeresdienst herrschte Mangel an Ingenieuren, der gerade allein anwesende Monteur wußte nicht Bescheid, der Professor ärgerte sich – da kroch ein verschmierter Lehrjunge unter der Maschine hervor und gab die nötigen Auskünfte. Er hatte sich durch Aufmerksamkeit auf Dinge, die ihn nichts angingen, und durch eigenes nächtliches Studium die nötigen Kenntnisse verschafft. Nun griff der Professor helfend ein, die ungemeine Energie des Jungen wurde durch den Erfolg noch gesteigert, und sehr kurze Zeit danach bestand der Volksschüler fast am selben Tage seine Prüfung als Schlossergeselle und als Abiturient. Danach bot sich ihm die Möglichkeit, seinen Unterhalt im technischen Beruf zu erwerben und gleichzeitig zu studieren. Seine mathematisch-technische Begabung bewährte sich weiter: in ganz jungen Jahren und ohne die übliche Abschlußprüfung des Diplomingenieurs erhielt er einen hohen Posten.
Aber was ihn mir nahebrachte, mir, dem leider alles Mathematisch-Technische so unergründlich fernliegt, das war die Allseitigkeit seines Bildungsstrebens und Nachdenkens. Er kam in unser Haus, er wurde aus dem Hausgenossen einigermaßen zum [54]Pflegesohn, er nannte uns, halb im Scherz, aber doch auch sehr im Ernst, Vater und Mutter, wir hatten wohl einigen Anteil an seiner Bildung. Er heiratete frühzeitig, und das herzlich nahe Verhältnis zwischen uns blieb unverändert. Daß es durch politische Meinungsverschiedenheiten je gestört werden könnte, kam keinem von uns vier Beteiligten je in den Sinn.
Und dann drang der Nationalsozialismus nach Sachsen. Ich bemerkte bei T. erste Anzeichen der veränderten Gesinnung. Ich fragte ihn, wie er mit diesen Leuten sympathisieren könne. »Sie wollen doch nichts anderes als die Sozialisten«, sagte er, »sie sind doch auch eine Arbeiterpartei.« – »Siehst du denn nicht, daß sie auf Krieg zielen?« – »Höchstens auf einen Befreiungskrieg, der der gesamten Volksgemeinschaft und so auch den Arbeitern und kleinen Leuten zugute kommen muß …«
Ich begann an der Weite und Stärke seiner Vernunft zu zweifeln. Ich suchte ihn von einer anderen Seite her stutzig zu machen. »Du hast jahrelang in meinem Hause gelebt, du weißt doch, wie ich denke, du meintest doch oft, einiges von uns gelernt zu haben und in deinen sittlichen Wertungen mit uns übereinzustimmen – wie kannst du nach alledem zu einer Partei halten, die mir um meiner Abstammung willen das Deutschtum und das Menschentum abspricht?« – »Du nimmst das viel zu ernst, Babba.« – (Das Sächsische sollte wohl dem Satz, der Diskussion überhaupt, eine leichte Note geben.) – »Der Judenrummel dient nur Propagandazwecken. Du wirst sehen, wenn Hitler erst am Ruder ist, dann hat er anderes zu tun als auf die Juden zu schimpfen …«
Aber der Rummel tat doch seine Wirkung – auch auf unseren Pflegesohn. Ich fragte ihn einige Zeit später nach einem jungen Mann, den er kannte. Er zuckte die Achseln: »Bei der AEG, du weißt ja, was das bedeutet? … Nicht? … ›Alles echte Germanen?‹« Und er lachte und war verwundert, daß ich nicht mitlachte.
Und dann, nachdem wir uns eine Weile nicht gesehen, lud er uns telefonisch zum Essen ein, es war kurz nach Hitlers Regierungsantritt. »Wie geht es bei euch im Betrieb?« fragte ich. »Sehr schön!« antwortete er, »gestern hatten wir einen ganz großen Tag. In [55]Okrilla saßen ein paar freche Kommunisten, da haben wir eine Strafexpedition veranstaltet.« – »Was habt ihr?« – »Na, Spießruten laufen lassen durch Gummiknüttel, und ein bißchen Rizinus, nichts Blutiges, aber immerhin ganz wirksam, eine Strafexpedition eben.«
Strafexpedition ist das erste Wort, das ich als spezifisch nazistisch empfand, ist das allererste meiner LTI, und ist das allerletzte, das ich von T. gehört habe; ich hing den Hörer hin, ohne die Einladung nur erst abzulehnen.
Was ich mir irgend an brutaler Überheblichkeit und an Verachtung fremder Menschenart denken konnte, drängte sich in diesem Wort Strafexpedition zusammen, es klang so kolonial, man sah ein umstelltes Negerdorf, man hörte das Klatschen der Nilpferdpeitsche.
Später, nur leider nicht dauernd, hatte diese Erinnerung bei aller Bitterkeit doch auch etwas Tröstliches für mich. »Ein bißchen Rizinus«: Es war so ganz deutlich, daß diese Unternehmung faschistische Gepflogenheiten der Italiener nachahmte; der ganze Nazismus schien mir nichts als italienische Infektion. Der Trost verging vor der sich entschleiernden Wahrheit, wie Frühnebel vergehen; die Kern- und Todsünde des Nazismus war deutsch und nicht italienisch.
Aber auch die Erinnerung an das nazistische (oder faschistische) Wort Strafexpedition wäre ohne die Verbindung mit dem persönlichen Erlebnis bestimmt für mich wie für Millionen anderer verflogen, denn es gehört nur den Anfangszeiten des Dritten Reichs an, ja es ist durch die bloße Gründung dieses Régimes überholt und unnütz geworden wie der Fliegerpfeil durch die Fliegerbombe. An die Stelle der halb privaten und sonntagssportlichen Strafexpeditionen trat sofort die reguläre und amtliche Polizeiaktion, und an die Stelle des Rizinus das Konzentrationslager. Und sechs Jahre nach dem Beginn des Dritten Reichs wurde die zur Polizeiaktion gewordene innerdeutsche Strafexpedition überlärmt vom Toben des Weltkrieges, den sich seine Entfeßler auch als eine Art Strafexpedition gegen allerhand mißachtete Völker gedacht hatten. So [56]verklingen Worte. – Dagegen die beiden anderen, die den Gegenpol bezeichneten – Du bist nichts, und ich bin alles! –, sie bedürfen keiner persönlichen Erinnerung, um im Gedächtnis zu haften, sie blieben bis zuletzt und werden in keiner Geschichte der LTI vergessen werden.
Die nächste Sprachnotiz meines Tagebuches heißt: Staatsakt. Goebbels inszeniert ihn, den ersten einer kaum noch übersehbaren Reihe, am 21. März 1933 in der Potsdamer Garnisonkirche. (Merkwürdige Fühllosigkeit der Nazis gegen satirische Komik, der sie sich selbst aussetzen; man möchte bisweilen wirklich an ihre subjektive Unschuld glauben! Das Glockenspiel der Garnisonkirche: »Üb’ immer Treu und Redlichkeit!« haben sie zu ihrem Berliner Rundfunkzeichen gemacht, und die Posse ihrer fiktiven Reichstagssitzungen haben sie in einem Theatersaal, in der Krolloper, angesiedelt.)
Wenn das LTI-Verbum »aufziehen« irgendwo mit Recht angewendet wird, dann sicherlich hier; das Gewebe der Staatsakte wurde immer nach dem gleichen Muster aufgezogen, in zwei Ausführungen freilich, mit oder ohne Sarg im Mittelpunkt. Die Pracht der Banner, Aufmärsche, Girlanden, Fanfaren und Chöre, der Redeumkörperungen, blieb sich durchweg gleich, lehnte sich durchweg an das Mussolinische Vorbild. Im Kriege schob sich der Sarg immer häufiger ins Zentrum, und die schon etwas erschlaffte Anziehungskraft dieses Werbemittels straffte sich wieder durch Anrüchigkeit. So oft ein gefallener oder tödlich verunglückter General sein Staatsbegräbnis erhielt, ging das Gerücht, er sei beim Führer in Ungnade geraten und auf dessen Befehl beseitigt worden. Daß solche Gerüchte entstehen konnten, legt – einerlei ob sie der Wahrheit entsprachen oder nicht – gültiges Zeugnis ab für den Wahrheitsgehalt, den man der LTI beimaß, für den Lügengehalt, den man ihr zutraute. Die größte Lüge aber, die ein Staatsakt je ausdrückte, und eine inzwischen erwiesene Lüge, war die Leichenfeier für die sechste Armee und ihren Marschall. Hier sollte aus der Niederlage Kapital für künftigen Heroismus geschlagen werden, indem man treues Aushalten bis in den Tod denen [57]nachsagte, die sich gefangengegeben hatten, um sich nicht wie abertausende ihrer Kameraden für eine sinnlose und verbrecherische Sache schlachten zu lassen. Diesem Staatsakt hat Plievier in seinem Stalingradbuch erschütternd satirische Wirkung abgewonnen.
Rein sprachlich ist das Wort doppelt aufgeblasen. Einmal sagt es aus und bestätigt damit eine wirkliche Gegebenheit, daß Ehrungen, die der Nationalsozialismus vergibt, staatliche Anerkennungen sind. Es enthält also das L’Etat c’est moi des Absolutismus. Sodann aber fügt es zur Aussage den Anspruch. Ein Staatsakt ist etwas zur Staatsgeschichte Gehöriges, also etwas, das dauernd im Gedächtnis eines Volkes bewahrt werden soll. Ein Staatsakt hat besonders feierliche historische Bedeutung.
Und hier ist nun das Wort, mit dem der Nationalsozialismus vom Anfang bis zum Ende übermäßige Verschwendung getrieben hat. Er nimmt sich so wichtig, er ist von der Dauer seiner Institutionen so überzeugt, oder will so sehr davon überzeugen, daß jede Bagatelle, die ihn angeht, daß alles, was er anrührt, historische Bedeutung hat. Historisch ist ihm jede Rede, die der Führer hält, und wenn er hundertmal dasselbe sagt, und wenn er gar nichts mit all seinen Worten sagt; historisch ist jede Zusammenkunft des Führers mit dem Duce, auch wenn sie gar nichts an den bestehenden Verhältnissen ändert; historisch ist der Sieg eines deutschen Rennwagens, historisch die Einweihung einer Autostraße, und jede einzelne Straße und jede einzelne Strecke jeder einzelnen Straße wird eingeweiht; historisch ist jedes Erntedankfest, historisch jeder Parteitag, historisch jeder Feiertag jeglicher Art; und da das Dritte Reich nur Feiertage kennt – man könnte sagen, es habe am Alltagsmangel gekrankt, tödlich gekrankt, ganz wie der Körper tödlich krank sein kann an Salzmangel –, so hält es eben alle seine Tage für historisch.
In wieviel Schlagzeilen, in wie vielen Leitartikeln und Reden ist das Wort gebraucht und um seinen ehrwürdigen Klang gebracht worden! Man kann ihm gar nicht Schonung genug angedeihen lassen, wenn es sich erholen soll.
Vor dem häufigen Gebrauch von Staatsakt ebenso zu warnen, ist überflüssig, da wir ja keinen Staat mehr haben.