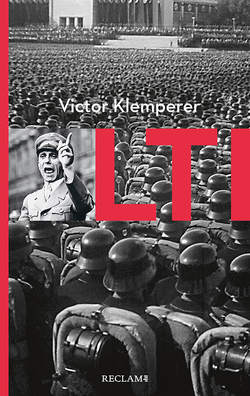Читать книгу LTI - Victor Klemperer - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
[89]XIII Namen
ОглавлениеEs gab einen alten Gymnasialwitz, der sich von Generation zu Generation forterbte; jetzt, da nur noch in den wenigsten Mittelschulen Griechisch gelehrt wird, dürfte er ausgestorben sein. Der Witz hieß: Wie ist das deutsche Wort Fuchs aus dem gleichbedeutenden griechischen alopex entstanden? In dieser Entwicklungsreihe: alopex, lopex, pex, pix, pax, pucks, Fuchs. Daran hatte ich seit meiner Matura, seit einigen dreißig Jahren, nicht mehr gedacht. Am 13. Januar 1934 aber tauchte das plötzlich mit solcher Frische aus der Vergessenheit, als hätte ich es tags zuvor das letztemal zitiert. Das geschah beim Lesen des Semesterrundschreibens Nr. 72. Magnifizenz teilte darin mit, daß unser Kollege, der a. o. Professor und nationalsozialistische Stadtverordnete Israel »mit Erlaubnis des Ministeriums« den alten Namen seiner Familie wieder angenommen habe. »Sie hieß im 16. Jahrhundert Oesterhelt, und das ist in der Lausitz über Uesterhelt, Isterhal (auch Isterheil und Osterheil), Istrael, Isserel u. a. durch Verstümmelung zu Israel entwickelt worden.«
Damit war ich zum erstenmal auf das Namenkapitel der LTI hingewiesen. Sooft ich später an dem neuglänzenden Namenschild Oesterhelt vorüberging – es war an irgendeinem Gartentor des Schweizer Viertels angebracht –, machte ich mir Vorwürfe, auch dieses Sonderkapitel wieder vor allem sub specie Judaeorum anzusehen. Es erschöpfte sich ja keineswegs in den jüdischen Dingen allein, es ist auch kein Kapitel, das allein der LTI angehört.
In jeder Revolution, ob sie nun Politisches und Soziales betrifft oder die Kunst oder die Literatur, sind immer zwei Tendenzen wirksam: einmal der Wille zum völlig Neuen, wobei der Gegensatz zu dem bisher Gültigen schroff betont wird, sodann aber auch das Bedürfnis nach Anknüpfung, nach rechtfertigender Tradition. Man ist nicht absolut neu, man kehrt zurück zu dem, wogegen die abzulösende Epoche gesündigt hat, zurück zur Menschheit oder [90]zur Nation oder zur Sittlichkeit oder zum wahren Wesen der Kunst usw., usw. Beide Tendenzen zeigen sich deutlich in Namengebungen und Umbenennungen.
Daß man den gesamten Ruf- und Familiennamen eines Vorkämpfers des neuen Zustandes zum Vornamen eines neugeborenen Kindes oder einer neu zu benennenden Person macht, ist wohl im wesentlichen auf Amerika und auf das schwarze Amerika beschränkt. Die große englische Revolution bekennt sich zum Puritanismus und schwelgt in alttestamentlichen Namen, die sie gern durch einen Bibelspruch verstärkt (Josua – lobe den Herrn, meine Seele). Die Große Französische Revolution sucht ihre Idealgestalten im klassischen, insbesondere römischen Altertum, und jeder Volkstribun legt sich und seinen Kindern ciceronianische und taciteische Namen zu. Und ganz so betont ein guter Nationalsozialist seine Bluts- und Seelenverwandtschaft mit den Germanen, mit den Menschen und Göttern des Nordens. Die Wagnermode und ein längst vorhandener Nationalismus haben vorgearbeitet, die Horst, Sieglinde usw. sind bei Hitlers Auftauchen schon reichlich vorhanden; neben dem Wagnerkult und nach ihm, und vielleicht stärker als er, hat dabei gewiß auch die Jugendbewegung, das Singen der Wandervögel mitgewirkt.
Aber das Dritte Reich macht beinahe zu Pflicht und Uniform, was bisher Mode oder Gepflogenheit neben anderen Gepflogenheiten war. Wenn sich der Führer der nazistischen Jugend Baldur nennt, wie sollte man da zurückbleiben? Noch 1944 finde ich in einer Dresdener Zeitung unter neun Geburtsanzeigen sechs mit nachdrücklich germanischen Namen: Dieter, Detlev, Uwe, Margit, Ingrid, Uta. Doppelnamen, durch Bindestrich aneinandergekettet, sind in ihrer Volltönigkeit, ihrem zweifachen Bekennen, ihrem rhetorischen Charakter also (und damit denn in ihrer Zugehörigkeit zur LTI), höchst beliebt: Bernd-Dietmar, Bernd-Walter, Dietmar-Gerhard … Charakteristisch für die LTI ist auch die häufige Anzeigenform: Klein-Karin, Klein-Harald; man mischt zum Heroischen des Balladennamens ein bißchen süßes Gefühl, das gibt einen herrlichen Ködergeschmack.
[91]Ist es eine starke Übertreibung, wenn ich von Uniformierung rede? Vielleicht insofern nicht, als eine Reihe eingebürgerter Vornamen teils anrüchig geworden, teils geradezu verboten ist. Sehr ungern gesehen sind christliche Vornamen; sie bringen ihren Träger leicht in den Verdacht, der Opposition anzugehören. Kurz vor der Dresdener Katastrophe fiel eine Nummer des »Illustrierten Beobachters«, ich glaube vom 5. Februar 1945, als Einwickelpapier in meine Hände. Darin stand ein erstaunlicher Artikel: »Heidrun«. Erstaunlich in dieser offiziellst nazistischen Zeitung (der Beilage des»Völkischen Beobachters«).
Ein paarmal im Laufe dieser Jahre bin ich an eine merkwürdige Grillparzerszene erinnert worden. »Der Traum ein Leben«, letzter Akt. Der junge Held ist unrettbar in blutige Schuld verstrickt, die Sühne unausbleiblich. Da hört man eine Uhr, und er murmelt: »Horch!, es schlägt! Drei Uhr vor Tage. / Kurze Zeit, so ist’s vorüber.« Er ist auf einen Augenblick halb erwacht, er ahnt, daß ihn nur ein Traum, ein erzieherischer, nur eine unverwirklichte Möglichkeit seines Ichs gequält hat. »Truggestalten, Nachtgebilde; / Krankenwahnwitz, willst du lieber, / Und wir sehen’s, weil im Fieber.«
Ein paarmal, aber nie lichter als in diesem späten Heidrunartikel, klingt das »Drei Uhr vor Tage«, das halbe Bewußtsein ihres Verschuldens, aus Veröffentlichungen der Hitleranhänger; nur als sie, viel zu spät, erwachten, da war ihr Krankenwahnwitz nicht als Spuk verflogen; sie hatten wirklich gemordet … In dem Heidrunartikel also verspottet der Autor seine Pgs gleich auf doppelte Weise. Wenn Eltern, schreibt er, vor ihrem Austritt aus der Kirche (wie er ja für SS-Leute und ganz orthodoxe Nazisten notwendig war), wenn sie, in einer undeutscheren Phase ihres Lebens also, den Fehler begangen hatten, ihre Erstgeborene Christa zu taufen, so suchten sie später das arme Geschöpf wenigstens mit Hilfe der Rechtschreibung einigermaßen zu entlasten, indem sie es dazu anhielten, seinen halborientalischen Namen mit deutschem Anfang »Krista« zu schreiben. Und zur vollen Sühne wurde dann die zweite Tochter gut germanisch und heidnisch »Heidrun« genannt, worin [92]Müller und Schulze eine Germanisierung von Erika vermuteten. In Wahrheit aber sei Heidrun die »Himmelsziege« der Edda, die Met in den Eutern trage und begehrlich hinter dem Bock herrenne. Ein recht unpassender nordischer Name somit für ein junges Mädchen … Ob die Warnung des Artikels noch irgendein Kind bewahrt hat? Er ist spät erschienen, kein Vierteljahr vor dem Zusammenbruch. Im Suchdienst des Radios bin ich erst vor wenigen Tagen einer schlesischen Heidrun begegnet …
Während Christa und ihresgleichen bei aller Anrüchigkeit immerhin in das Standesamtsregister gelangen, sind die dem Alten Testament entnommenen Namen verboten: kein deutsches Kind darf Lea oder Sara heißen; kommt einmal ein weltfremder Pfarrer darauf, einen solchen Namen anzumelden, so verweigert der Standesbeamte die Eintragung, und die Beschwerde des Pfarrers wird höheren Orts entrüstet zurückgewiesen.
Man suchte den deutschen Volksgenossen weitgehend vor derartigen Namen zu schützen. Im September 1940 sah ich an den Litfaßsäulen die Anzeige einer Kirche: »Held eines Volkes; Oratorium von Händel.« Darunter stand, ängstlich klein gedruckt und in Klammern: »Judas Makkabaeus; neugestalteter Druck.« Etwa um dieselbe Zeit las ich einen kulturhistorischen Roman, der aus dem Englischen übersetzt war: The Chronicle of Aaron Kane. Der Verlag Rütten & Loening, derselbe, bei dem die große Beaumarchais-Biographie des Wiener Juden Anton Bettelheim erschienen ist! – der Verlag entschuldigte sich auf der ersten Seite, die biblischen Namen der Personen entsprächen ihrem Puritanismus und der Zeit- und Landessitte, weswegen sie also nicht geändert werden könnten. Ein anderer englischer Roman – ich weiß den Autor nicht mehr – hieß im Deutschen: »Geliebte Söhne.« Der auf der Innenseite in winziger Schrift angegebene Originaltitel lautet: »O Absalom!« Im Physikkolleg mußte der Name Einstein verschwiegen, durfte auch die Maßeinheit »ein Hertz« nicht mit diesem jüdischen Namen bezeichnet werden.
Weil man aber den deutschen Volksgenossen nicht nur vor den jüdischen Namen beschützen will, sondern noch viel mehr vor [93]jeder Berührung mit den Juden selber, so werden diese aufs sorgfältigste abgesondert. Und eines der wesentlichsten Mittel solcher Absonderung besteht in der Kenntlichmachung durch den Namen. Wer nicht einen unverkennbar hebräischen und gar nicht im Deutschen eingebürgerten Namen trägt, wie etwa Baruch oder Recha, der hat seinem Vornamen ein »Israel« oder »Sara« beizufügen. Er hat das seinem Standesamt und seiner Bank mitzuteilen, er darf es bei keiner Unterschrift vergessen, er hat alle seine Geschäftsfreunde darauf hinzuweisen, daß sie ihrerseits es nicht vergessen, wenn sie Post an ihn richten. Wenn er nicht gerade mit einer arischen Frau verheiratet ist und Kinder von ihr hat – die arische Frau allein hilft ihm nichts –, muß er den gelben Judenstern tragen. Das Wort »Jude« darin, dessen Buchstaben der hebräischen Schrift angeähnelt sind, wirkt wie ein an der Brust getragener Vorname. An der Korridortür klebte unser Name doppelt, über dem meinen der Judenstern, unter dem meiner Frau das Wort »arisch«. Auf meinen Lebensmittelkarten stand erst ein einzelnes großes J, später wurde das Wort »Jude« schräg über die Karte gedruckt, zuletzt stand auf jedem winzigen Abschnitt jedesmal das volle Wort »Jude«, etliche sechzigmal auf ein und derselben Karte. Wenn von mir amtlich die Rede ist, heißt es immer »der Jude Klemperer«; wenn ich mich auf der Gestapo zu melden habe, setzt es Püffe, falls ich nicht »zackig« genug melde: »Hier ist der Jude Klemperer.« Man kann die Verächtlichmachung noch steigern, indem man mit Hilfe des Apostrophs an die Stelle der Aussageform die des herrischen Anrufs setzt: von meinem beizeiten nach Los Angeles emigrierten Musikervetter las ich eines Tages in der Zeitung: »Jud’ Klemperer aus dem Irrenhaus entsprungen und wieder eingefangen.« Wenn die verhaßten »Kremljuden« Trotzki und Litwinow genannt werden, heißen sie immer Trotzki-Braunstein und Litwinow-Finkelstein. Wenn Laguardia, der verhaßte Bürgermeister von New York, genannt wird, heißt es immer: »der Jude Laguardia« oder mindestens »der Halbjude Laguardia«.
Und wenn es einem jüdischen Ehepaar trotz aller Bedrängnis dennoch einfallen sollte, ein Kind in die Welt zu setzen, so dürfen [94]sie ihrem Wurf – ich höre noch, wie der Spucker eine feine alte Dame anbrüllte: »Dein Wurf ist uns entkommen, du Judensau, dafür wollen wir dich fertigmachen!«, und sie machten sie dann auch fertig, am nächsten Morgen ist sie aus ihrem Veronalschlaf nicht mehr aufgewacht –, so dürfen die Eltern ihrer Nachkommenschaft keinen irreführenden deutschen Vornamen geben; die nationalsozialistische Regierung stellt ihnen eine ganze Reihe jüdischer Vornamen zur Auswahl. Seltsam sehen sie aus, die wenigsten unter ihnen haben die volle Würde des Alttestamentlichen.
In seinen Studien aus »Halbasien« erzählt Karl Emil Franzos, wie die galizischen Juden im 18. Jahrhundert zu ihren Namen gekommen sind. Es war eine Maßnahme Josephs II. im Sinne der Aufklärung und Humanität; aber viele Juden sträubten sich aus orthodoxer Abneigung, und höhnische Subalternbeamte zwangen dann den Widerspenstigen lächerlich machende und peinliche Familiennamen auf. Der Hohn, der damals gegen die Absicht des Gesetzgebers wirksam wurde, ist von der nazistischen Regierung absichtlich in Rechnung gestellt worden; sie wollte die Juden nicht bloß absondern, sondern auch »diffamieren«.
Als Mittel hierfür bot sich ihr der Jargon dar, der den Deutschen seinen Wortformen nach als eine Verzerrung der deutschen Sprache erscheint, und der ihnen rauh und häßlich klingt. Daß sich gerade im Jargon die durch Jahrhunderte bewahrte Anhänglichkeit der Juden an Deutschland ausdrückt, und daß ihre Aussprache sich weitgehend mit der eines Walter von der Vogelweide und Wolfram von Eschenbach deckt, das weiß natürlich nur der Germanist von Metier, und ich möchte den Professor der Germanistik kennen, der während der Nazizeit in seinem Seminar darauf aufmerksam gemacht hätte! So also kamen auf die Liste der den Juden überlassenen Vornamen die dem deutschen Ohr teils peinlich, teils lächerlich tönenden jiddischen Koseformen, die Vögele, Mendele usw.
Im letzten Judenhaus, das wir bewohnt haben, las ich jeden Tag ein charakteristisches Türschild, auf dem sich nebeneinander Vater und Sohn anzeigten: Baruch Levin und Horst Levin. Der Vater brauchte das Israel nicht hinzuzusetzen – Baruch allein war [95]jüdisch genug, das stammte noch aus polnischem und orthodoxem Judengebiet. Der Sohn wiederum durfte das Israel deshalb beiseite lassen, weil er Mischling war, weil es seinen Vater derart zum Deutschtum hinübergezogen hatte, daß er eine Mischehe eingegangen war. Es hat eine ganze jüdische Horstgeneration gegeben, deren Eltern sich im Betonen und Überbetonen ihres fast schon Teutschtums nicht hatten genugtun können. Diese Horstgeneration hat weniger unter den Nazis gelitten als ihre Eltern – ich meine natürlich seelisch gelitten, denn vor dem KZ und dem Gasofen gab es keinen Generationsunterschied, Jude war Jude. Aber die Baruchs haben sich aus dem Land ihrer Liebe ausgetrieben gefühlt. Während die Horsts – es gab zahlreiche Horsts und Siegfrieds, die als Volljuden das Israel zusetzen mußten –, während diese Jüngeren dem Deutschtum gleichgültig und zu einem beträchtlichen Teil geradezu feindselig gegenüberstanden. Sie waren in der gleichen Atmosphäre der pervertierten Romantik aufgewachsen wie die Nazis, sie waren Zionisten …
Nun bin ich doch wieder in die Betrachtung jüdischer Dinge gedrängt worden. Ist es meine Schuld oder die des Themas? Es muß doch auch nichtjüdische Seiten haben. Es hat sie auch.
Der Wille zur Tradition in der Namengebung griff selbst auf Zeitgenossen über, die dem Nazismus im übrigen fernstanden. Ein Oberstudiendirektor, der lieber in Pension ging, als daß er sich der Partei anschloß, erzählte mir gern von den frühen Heldentaten seines kleinen Enkels Isbrand Wilderich. Ich fragte, wie der Junge zu seinem Namen gekommen sei. Die Antwort lautete wörtlich: »So hieß ein Mann unserer aus Holland stammenden Sippe im siebzehnten Jahrhundert.« Durch den bloßen Gebrauch des Wortes Sippe machte der Rektor, den frommer Katholizismus gegen hitlerische Verführung schützte, seine nazistische Infektion deutlich. Sippe, ein neutrales Wort der älteren Sprache für Verwandtschaft, für Familie im weiteren Sinn, danach zum Pejorativ herabsinkend wie August, hebt sich zu feierlicher Würde, Sippenforschung wird Ehrenpflicht jedes Volksgenossen.
Die Tradition wird dagegen rücksichtslos beiseite geschoben, [96]wo sie dem nationalen Prinzip feindlich gegenübersteht. Hierbei kommt eine typisch deutsche Eigenschaft ins Spiel, die man oft als Pedanterie verspottet hat, die Gründlichkeit. Ein großer Teil Deutschlands ist von Slawen besiedelt worden, und die Ortsnamen entsprechen dieser historischen Gegebenheit. Dem nationalen Prinzip des Dritten Reiches und seinem Rassenstolz aber widerstrebt es, andere als germanische Ortsnamen zu dulden. So wird die Landkarte bis ins kleinste gesäubert. Aus einem Artikel der »Dresdener Zeitung« vom 15. November 1942: »Deutsche Ortsnamen im Osten«, notierte ich mir: Es wurde in Mecklenburg bei vielen Dörfern der Zusatz »Wendisch« gestrichen, es wurden in Pommern 120, im Brandenburgischen rund 175 slawische Ortsnamen verdeutscht, insbesondere germanisierte man die Spreewaldnester. In Schlesien brachte man es auf ganze 2700 verdeutschende Änderungen, und im Regierungsbezirk Gumbinnen, wo vor allem die »niederrassigen« litauischen Endungen anstößig wirkten, und wo man zum Exempel Berninglauken zu Berningen »aufnordete«, im Bezirk Gumbinnen wurden von insgesamt 1851 Gemeinden volle 1146 umbenannt.
Der Wille zur Tradition wiederum tritt hervor, wo er sich bei Straßenbenennungen deutschtümelnd betätigen kann. Die ältesten und unbekanntesten Ratsherren und Bürgermeister werden ausgegraben und schulmeisterlich genau an die Straßenschilder geschrieben. Auf der Südhöhe hier in Dresden heißt eine neuangelegte Straße Tirmannstraße, und unter dem Namen steht: »Magister Nikolaus Tirmann, Bürgermeister, gestorben 1437«, und ähnlich liest man auf anderen Straßenschildern der Vororte: »Ratsherr im 14. Jahrhundert« oder »Schreiber einer Stadtchronik im 15. Jahrhundert« … War Joseph ein zu katholischer Name, oder wollte man nur Platz schaffen für einen romantischen und somit betont deutschen Maler? Jedenfalls wurde die Josephstraße in Dresden zur Caspar-David-Friedrich-Straße, trotzdem dies eine mehr als halbe postalische Unmöglichkeit ergab: als wir in einem Judenhaus dieser Straße wohnten, bekamen wir wiederholt Briefe mit der Anschrift: Friedrichstraße bei Herrn Caspar David.
[97]Eine Mischung aus Liebe zu mittelalterlicher Zunft- und Ständeordnung und zu moderner Reklame spricht aus den Poststempeln, in denen Städte einen spezialisierenden Zusatz erhalten. »Messestadt Leipzig« ist alt und keine nazistische Erfindung, aber nazistisch neu ist der Stempel: »Cleve, Werkstatt der guten Kinderschuhe«. In meinem Tagebuch notierte ich: »Stadt des Volkswagenwerks bei Fallersleben«, wo denn der Stempel neben Berufsständischem und industrieller Reklame einen deutlich politischen Sinn birgt: er hebt eine besondere industrielle Siedlung heraus, eine betrügerische Lieblingsgründung des Führers; denn was als verheißender Volkswagen das Geld der kleinen Leute anlockte, war in Wahrheit von Anfang an als Kriegswagen geplant. Unverhüllt politisch und rein propagandistisch waren die Ruhmesstempel: »München, die Stadt der Bewegung«, und »Nürnberg, die Stadt der Parteitage«.
Nürnberg lag im »Traditionsgau«, womit man wohl ausdrücken wollte, daß die ruhmreichen Anfänge des Nationalsozialismus gerade in diesem Bezirk zu suchen waren. »Gau« für Provinz ist wieder ein Anknüpfen ans Teutschtum, und indem man dem »Warthegau« rein polnische Gebietsstücke eingliederte, legalisierte man den Raub fremden Landes durch deutsche Namengebung. Ähnlich lag es mit der Bezeichnung Mark für Grenzland. Ostmark: das zog Österreich zu Großdeutschland, Westmark: das gliederte Holland an. Schamloser noch spreizte sich der Erobererwille, wenn Lodz, das polnische, den eigenen Namen verlor und nach seinem Eroberer im ersten Weltkrieg in Litzmannstadt umgewandelt wurde.
Doch indem ich diesen Namen schreibe, sehe ich einen besonderen Stempel vor mir: Litzmannstadt-Getto. Und nun drängen sich Namen vor, die in die Höllengeographie der Weltgeschichte eingegangen sind: Theresienstadt und Buchenwald und Auschwitz usw. Und daneben taucht ein Name auf, den die wenigsten kennen werden – er ging nur uns Dresdener an, und die er am nächsten anging, sind alle verschwunden. Judenlager Hellerberg: dort brachte man in elenden Baracken, elenderen als den für die russischen Gefangenen bestimmten, den zusammengeschmolzenen Rest der [98]Dresdener Juden im Herbst 1942 unter, von dort aus wurde er wenige Wochen später in den Auschwitzer Gastod geschickt; nur wir paar in Mischehe Lebenden blieben zurück.
Da bin ich doch wieder beim jüdischen Thema angelangt. Ist es meine Schuld? Nein, es ist die Schuld des Nazismus, und nur dessen Schuld.
Aber wenn ich nun schon ins (sozusagen) Lokalpatriotische geraten bin, nachdem ich mich innerhalb des großen, wahrhaftig zu einer Doktordissertation ausreichenden Themas bei bloßen Zufallsnotizen und Andeutungen begnügen mußte – vielleicht gibt es eine Postdirektion, die das Material vervollständigen könnte –, dann will ich doch auch eine kleine Urkundenfälschung berichten, die mich persönlich angeht, die an meiner Lebensrettung mitgeholfen hat. Ich bin ja gewiß, daß mein Fall nicht der einzige sein wird. Die LTI war eine Gefängnissprache (der Gefangenenwärter und der Gefangenen), und zur Sprache der Gefängnisse gehören unweigerlich (als Akte der Notwehr) die Versteckworte, die irreführenden Mehrdeutigkeiten, die Fälschungen, usw., usw.
Waldmann war besser daran als wir, nachdem man uns aus der Dresdener Vernichtung heraus gerettet und in den Fliegerhorst Klotzsche gebracht hatte. Wir hatten den Judenstern heruntergerissen, wir hatten das Weichbild Dresdens verlassen, wir hatten mit Ariern zusammen im Innern eines Wagens gesessen, kurzum: wir hatten ein ganzes Büschel von Todsünden begangen, deren jede uns den Tod eintragen mußte, den Tod am Galgen, wenn wir der Gestapo in die Hände fielen. »Im Dresdener Adreßbuch«, sagte Waldmann, »stehen acht Waldmanns, und ich bin der einzige Jude unter ihnen – wem soll mein Name auffallen?« Aber mit dem meinen war es eine andere Sache. Jenseits der böhmischen Grenze ein verbreiteter Judenname – Klemperer hat nichts mit dem Klempnerhandwerk zu tun, es bedeutet den Klopfer, den Gemeindediener, der morgens an die Türen oder Fenster der Frommen klopft und sie zum Frühgebet weckt –, war er in Dresden nur durch ganz wenige wohlbekannte Exemplare vertreten, und ich war der einzige nach so vielen Schreckensjahren dort Übriggebliebene. Der [99]angebliche Verlust sämtlicher Papiere konnte mich verdächtig machen, und um den Verkehr mit Behörden ließ sich auf die Dauer nicht herumkommen: wir brauchten Lebensmittelkarten, brauchten Fahrkarten – wir waren noch sehr kultiviert, wir glaubten noch an die Notwendigkeit solcher Karten … Fast gleichzeitig erinnerten wir uns eines Apothekerfläschchens für mich. Das Rezept, ärztlich hingekritzelt, hatte meinen Namen an zwei leicht zu verändernden Stellen gänzlich verändert. Ein Punkt genügte, um aus dem »m« ein »in« zu machen, und ein Millimeterstrich verwandelte das erste »r« in ein »t«. So wurde aus Klemperer: Kleinpeter. Eine Poststelle, die die Menge solcher Kleinpeter im Dritten Reich registriert hätte, dürfte es kaum geben.